Kanton in China, frühes 19. Jahrhundert. Ein Junge liegt im Sterben, alle anderen Bewohner des Hauses sind bereits der Cholera zum Opfer gefallen. Da erscheint ein geheimnisvoller Engländer, drückt ihm einen Silberbarren auf die Brust und flüstert ein paar Worte. Schlagartig geht es dem Jungen besser. Silber ist Magie. Und Magie ist Macht. Der chinesische Junge wird nach England gebracht und zum Übersetzer ausgebildet. Denn ohne Übersetzer, die die Silberbarren gravieren, hat die Macht des britischen Empires keine Zukunft.
In Rebecca F. Kuangs Fantasyroman „Babel“ ist die fantastische Welt ganz nah an der wirklichen: Das Britische Empire beherrscht die Welt mit Hilfe einer Kriegsflotte und Handelskompanien. Gutmeinende Menschen freuen sich über die Abschaffung der Sklaverei in Britannien, schwören aber auf Kolonien. China wird mit Opium vollgepumpt.
Als der chinesische Junge, der nun Robin Swift heißt und dessen wahrer Name nur noch eine ferne Erinnerung für ihn ist, alt genug ist, tritt er in Oxford ein Studium als Übersetzer an. In dem Turm, der das Institut für Übersetzungen beherbergt und den alle nur „Babel“ nennen, trifft er auf die anderen Studierenden seines Jahrgangs – einen Inder, eine auf Haiti geborene junge Frau und eine Engländerin, die einzige Weiße in der Gruppe. Sie ist es auch, die (obwohl sie sich gegen viele sexistische Widerstände zu ihrem Studienplatz kämpfen musste) keinerlei Probleme zu haben scheint mit dem, was sich den Studenten nach und nach enthüllt: Babel ist die Grundlage des britischen Kolonialismus.
Das Prinzip ist simpel: Wenn man ein Wortpaar findet, das in der Übersetzung Gleiches bedeutet, dabei aber die Nuancen verschiebt, und es in einen Silberbarren eingraviert, entsteht Magie. Diese Silberbarren können dann im Garten eingegraben werden und für schönste Blüten sorgen, sie können Kutschen unfallfrei machen, sie können Krankheiten heilen (aber nicht die der Armen, das wäre zu teuer, in den Londoner Arbeitervierteln grassieren Krankheiten wie Cholera wie eh und je). Silberbarren können Dampfmaschinen betreiben (die dann die Arbeiterklasse um ihre Jobs bringen) und vor allem machen sie die britische Marine zur mächtigsten der Welt. Und die braucht das Empire, denn ohne Kolonien wird die Macht Britanniens verfallen. Von dort kommen fast alle der Kinder, die sie zu Übersetzern ausbilden. Und aus den Kolonien kommt das Silber.
Doch Robin und seine Freunde wollen nicht länger Handlanger der Unterdrückung sein. Sie schmieden einen verwegenen Plan. Und haben (neben einem Geheimbund, wie es sich für einen Fantasyroman gehört) die streikenden Arbeiter Englands an ihrer Seite.
Kolonialismus ist heutzutage nicht mehr besonders woke (außer, wenn Israel ihn betreibt). Entsprechend häufig finden sich auch Romane, die sich mit dem Erbe des Kolonialismus befassen, die einen besser, die anderen schlechter. Rebecca F. Kuang nähert sich dem Thema aus einer ganz besonderen Richtung. Auch wenn es sich bei ihrem Roman um einen aus dem Genre Fantasy handelt, ist die Geschichte Europas und ganz besonders Britanniens allgegenwärtig. Eines der ersten Bücher, aus dem Robin auf Geheiß des geheimnisvollen Engländers, der sein Vormund wird, etwas liest, ist Adam Smith’ „Der Wohlstand der Nationen“, in dem er gegen den Kolonialismus argumentiert – gepaart mit dem Hinweis von Kuang, dass die Sichtweise von Smith nur von wenigen geteilt wurde.
Kuang nimmt auch den Opiumkrieg auseinander, beschreibt Sinn und Zweck der britischen Strategie, China mit der Droge zu überfluten. Dabei entlarvt sie wie nebenbei Argumentationen, die genauso in der gestrigen „Tagesschau“ hätten fallen können wie in Debatten des 19. Jahrhunderts: „Freier Handel. So lautete die britische Argumentationskette – freier Handel, freier Wettbewerb, freies Spiel für alle. Doch dazu kam es nie, nicht wahr? ‚Freier Handel‘ bedeutete in Wahrheit britische Vorherrschaft. Denn was war frei an einem Handel, der hauptsächlich auf der Überlegenheit einer Seemacht beruhte, die den Zugang übers Meer sicherstellte?“ Was genau machen deutsche Fregatten nochmal im Pazifik?
Mit „Babel“ ist Rebecca F. Kuang ein höchst lesenswertes Buch gelungen. Diejenigen, die sich für Sprache, die Etymologie der Worte und das Übersetzen interessieren, ist es eine helle Freude, die Protagonisten beim Erstellen der magischen Wortpaare zu begleiten. Seine Kraft entfaltet „Babel“ aber da, wo es sich mit den politischen – und den moralischen – Verhältnissen auseinandersetzt. Nicht umsonst hat Kuang einem ihrer Kapitel ein Zitat vorangestellt, das vielen ein Begriff ist, dessen Aktualität es sich aber noch mal vor Augen zu führen lohnt: „Der Kolonialismus ist keine Denkmaschine, kein vernunftbegabter Körper. Er ist die Gewalt im Naturzustand und kann sich nur einer noch größeren Gewalt beugen.“ Das schrieb Frantz Fanon 1961 in „Die Verdammten dieser Erde“. Viele Länder befreiten sich aus dem Kolonialismus, die Ausbeutung dieser Länder durch den Westen hielt in fast allen Fällen an. Dem israelischen Siedlungskolonialismus bescheinigt man heute selbst bei Völkermord noch das „Recht auf Selbstverteidigung“.
Vor dieser von Fanon benannten nötigen Gewalt, vor den Folgen ihrer Taten schrecken einige von Robins Verbündeten im Buch zurück. Ihr Widerstand soll moralisch integer sein und niemandem weh tun.
„,Aber das ist doch gerade das Perfide‘, widersprach Robin. ‚Genau so funktioniert Kolonialismus. Uns wird eingeredet, dass die Folgen des Widerstands komplett unsere Schuld wären, dass die Unmoral im Widerstand selbst bestünde statt in den Umständen, die den Widerstand erfordern.‘“ Über diesen Mechanismus sollte die deutsche Linke gerade in Bezug auf Palästina auch mal wieder nachdenken.
Rebecca F. Kuang
Babel
Eichborn Verlag, 736 Seiten, 18 Euro

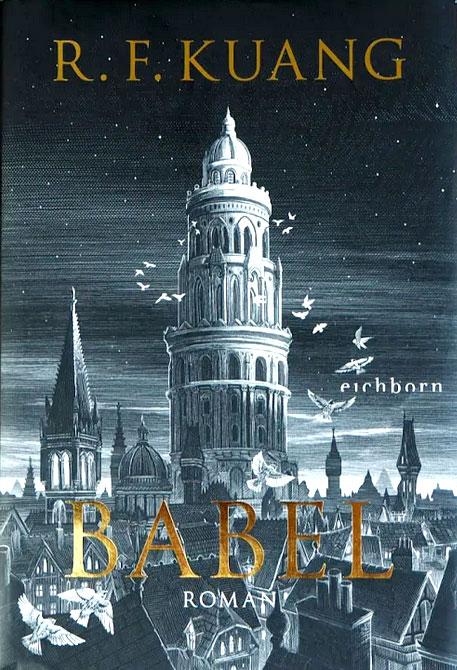

![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)





