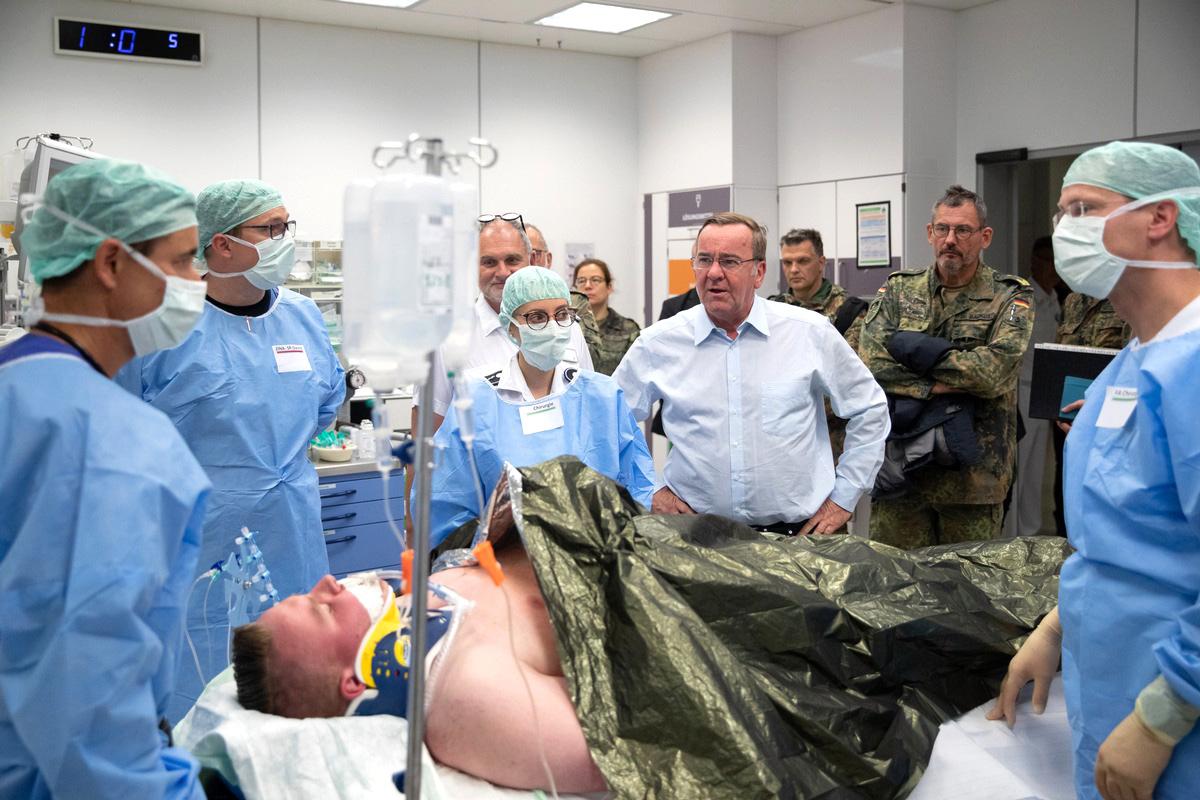Vor einer Woche erzielte der Goldpreis mit 2.942,7 Dollar je Unze ein „Allzeithoch“, wie es so niedlich genannt wird. Als sei damit das Ende aller Zeiten bereits angekommen. Was gerade den Goldpreis in letzter Zeit so in Schwung gebracht hat, ist unklar.
In der „Financial Times“ (FT) erschien dazu ein Artikel, der Donald Trump auch daran die Schuld gab. Seit Trumps Amtsantritt am 20. Januar sei der Goldpreis um 7 Prozent gestiegen. Da Trump als Gegner der Globalisierung mit Zöllen gegen den freien Welthandel vorgehe, suchten die Investoren (= Anleger oder Spekulanten) Schutz im Gold gegen die resultierenden Risiken (schwaches Wachstum und Inflation). Wahnsinnig plausibel erscheint die Erklärung nicht. Denn in den Jahren hoher Inflationsraten 2021 bis 2023 in den USA und Westeuropa bewegte sich der Goldpreis nicht besonders auffällig nach oben. Der steile Anstieg kam erst im vergangenen Jahr, als die Inflation wieder zurückging. Er trieb den Goldpreis, in Dollar gerechnet, um ein gutes Drittel bis fast an 2.800 Dollar heran.
Der Autor des FT-Artikels nennt einen konkreten Grund für den Preisanstieg am Jahresende bis vergangene Woche. Viele Goldeigentümer wollen ihr physisches Metall nicht mehr der Verwahrung durch die Bank von England anvertrauen, stehen bildlich gesprochen Schlange vor deren Kellergewölben und betteln um die Herausgabe. Nicht erwähnt wird der mögliche Grund für das sonderbare Verhalten. Ohne das beweisen zu können, könnte die Tatsache, dass die Zentralbank Britanniens das Venezuela gehörende Gold nicht rausrückte und vor britischen Gerichten damit durchkam und ähnliche andere Fälle dem Renommee der Bank als internationale Goldverwahranstalt Schaden zugefügt haben.
Gesichert ist ein weiterer Trend: Seit dem „Einfrieren“ der 230 Milliarden auf den Dollar- und Eurokonten der russischen Zentralbank im Februar 2022 sind Zentralbanker in aller Welt weniger geneigt, Überschüsse in Dollar oder Euro zu halten. Als Alternative bietet sich nur Gold an, was die Nachfrage nach dem Metall hochtreibt. Warum sie allerdings erst 2024 richtig in Schwung kam, bleibt – mir jedenfalls – ein Rätsel.
Die UZ-Redaktion hatte mir als Thema der Kolumne den „Kontrast zwischen Wirtschaftswachstum beziehungsweise -prognosen und den steigenden Aktienkursen“ vorgeschlagen. Ich bin beim Nachdenken über diese Frage schon mal beim Rohstoff Gold steckengeblieben. Denn Gold fungiert immer noch als internationale Geldware. Aktien sind vielfältiger. Ihre Bewegung steht im Zentrum des Kapitalmarktes. Langfristig sollten die Aktienkurse mit der Menge der abgesaugten Profite und der unterschiedlichen Profitrate der verschiedenen Branchen und Regionen zusammenhängen. Sie tun das wahrscheinlich auch auf geheimnisvolle Weise. Dass deutsche Aktien im Rezessionsjahr 2024 ein ähnlich munteres Jahr wie US-amerikanische erlebten, wo dort das BIP ja um enorme 2,8 Prozent wuchs, bleibt ein Rätsel.


![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)