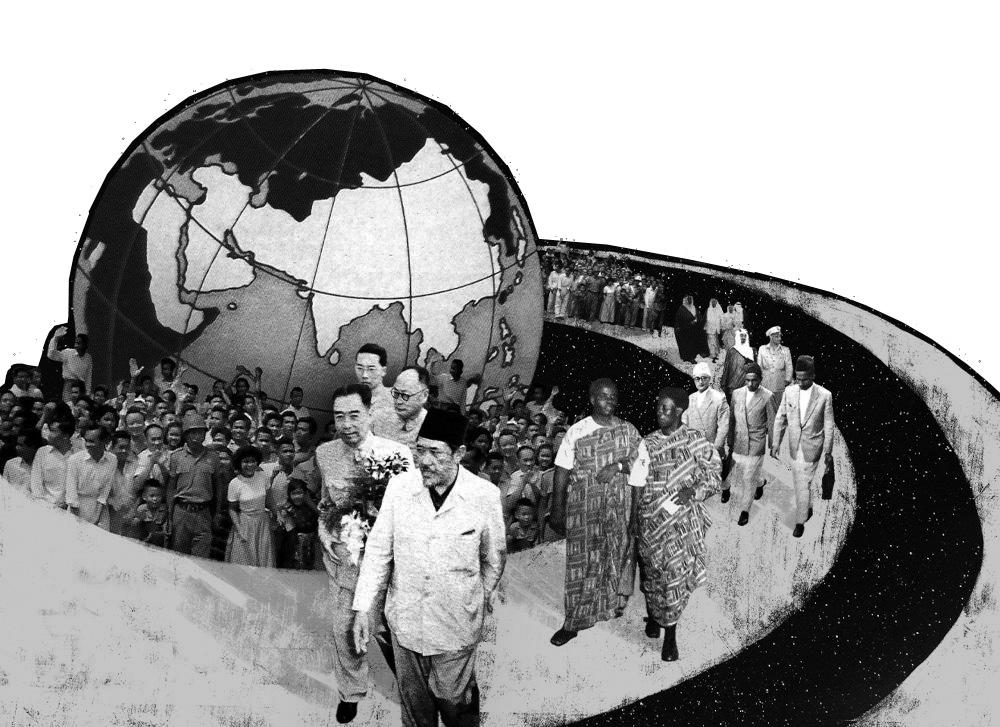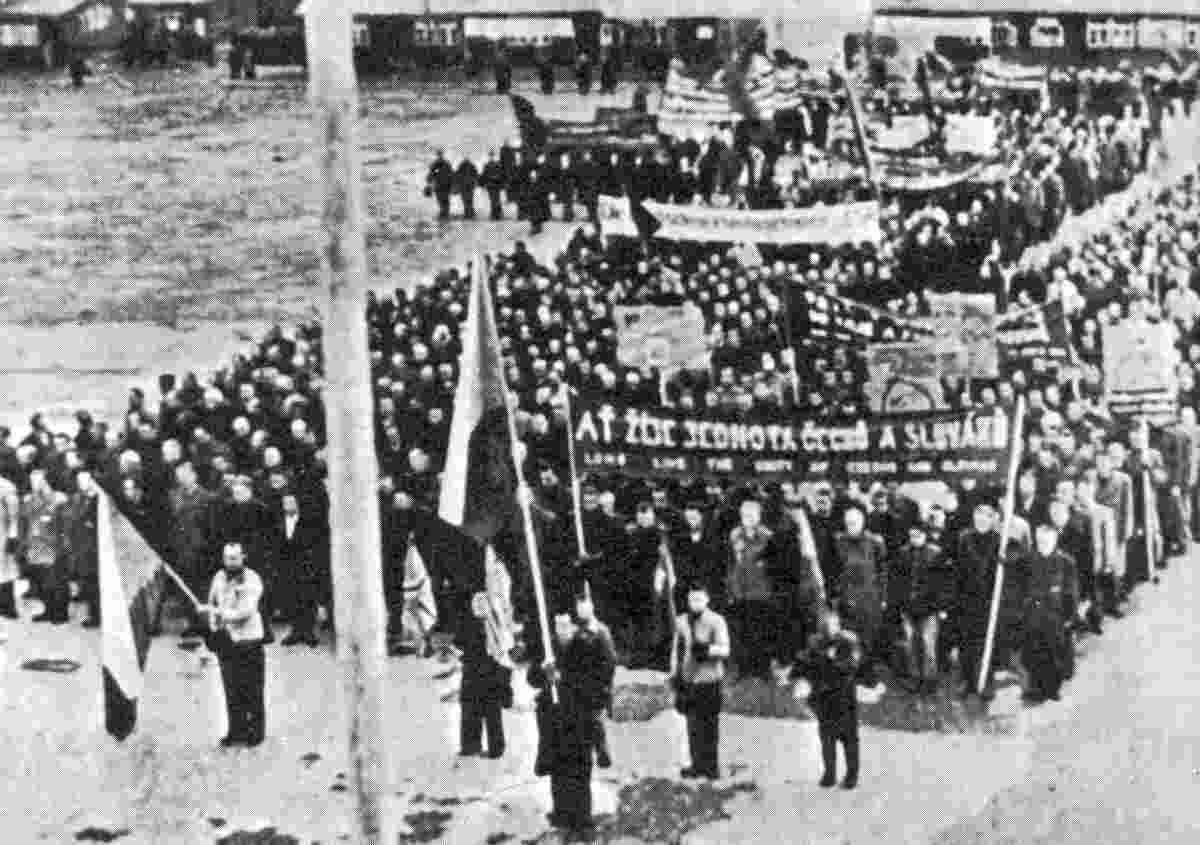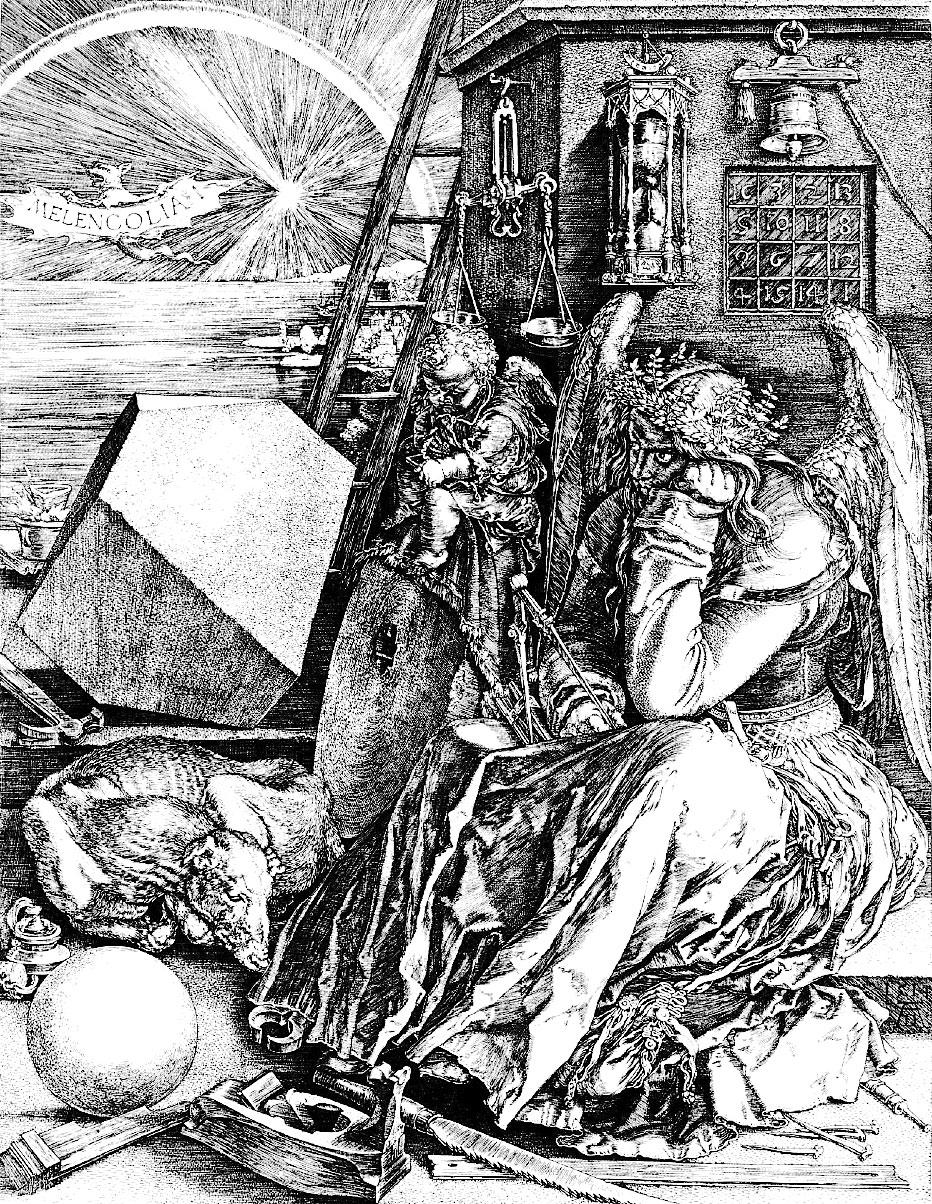Mit gerade einmal 26 Jahren hielt Karl Marx in einem Notizbuch einige Gedanken fest, die er mit dem Titel „1. ad Feuerbach“ versah. Sie waren nie für den Druck bestimmt und dienten der theoretischen Selbstverständigung des jungen Philosophen. Dieses als „Feuerbachthesen“ bekannt gewordene Dokument ist nach dem „Kommunistischen Manifest“ und dem „Kapital“ wohl eines der bekanntesten Dokumente des Marxismus. Das dürfte auch an seiner kurzen, prägnanten Form liegen. Ihre große Bedeutung haben die „Feuerbachthesen“ allerdings nicht, weil sie durch eben diese Form auch als bessere Kalendersprüche taugen würden. Im Gegenteil markieren diese elf Thesen einen Meilenstein in der Entwicklung des Historischen Materialismus.
Ludwig Feuerbach
Entscheidende philosophische Impulse bekam Marx – neben Hegel – von Ludwig Feuerbach. Dessen 1841 veröffentlichtes Werk „Das Wesen des Christentums“, seine „Vorläufigen Thesen zur Reform der Philosophie“ und die 1843 erschienenen „Grundsätze der Philosophie der Zukunft“ hatten eine spürbare Wirkung auf das Marxsche Denken. Feuerbach stellte den Menschen und sein „Wesen“ ins Zentrum seiner Philosophie. Der Mensch mache in der Religion, in Gott, sein eigenes Wesen zum Gegenstand. „Der Gegenstand des Menschen ist nichts anderes als sein gegenständliches Wesen selbst.“ Er bete sein eigenes Wesen an. Die Religion sei „das erste und zwar indirekte Selbstbewusstsein des Menschen“ und habe keinen eigenen Inhalt. Der Mensch sei Anfang, Mittelpunkt und Ende der Religion. Mit Blick auf die Philosophie forderte Feuerbach „die Anschauung der Dinge und Wesen in ihrer objektiven Wirklichkeit“. Der 1992 verstorbene marxistische Theoretiker Josef Schleifstein urteilte mit Blick auf Feuerbach, „eine tiefere, kraftvollere Sprache gegen die Religion und alles übernatürliche, spiritualistische Denken war in Deutschland nie gehört worden“.
In den Schriften, die Marx bis Mitte der 1840er Jahre verfasste, ist der Einfluss Feuerbachs nicht zu übersehen. Gleichwohl ging er schon über dessen Philosophie hinaus. Das lässt sich anhand der 1844 – also etwa ein Jahr vor der Abfassung der „Feuerbachthesen“ – verfassten „Ökonomisch-philosophischen Manuskripte“ veranschaulichen. In dem philosophischen Teil der Schrift beschäftigte sich Marx unter anderem mit dem Begriff der „Gattung“. Der Mensch sei ein „Gattungswesen“. Zum einen mache er „praktisch und theoretisch die Gattung, sowohl seine eigene als die der übrigen Dinge, zu seinem Gegenstand“. Außerdem verhalte er „sich zu sich als einem universellen, darum freien Wesen“.
Gesellschaftliches Leben
Die Kategorien „Gattung“ und „Gattungswesen“ spielten schon bei Feuerbach eine zentrale Rolle. Der Mensch habe ein Bewusstsein, weil er sich zu sich selbst als Gattung verhalten könne – also weil er sich fragen könne, was den Menschen ausmacht. Feuerbach fragte, nachdem er das festgestellt hatte, was denn das Wesen des Menschen, also sein „Gattungswesen“, sei. Seine Antwort: „Die Vernunft, der Wille, das Herz.“ Die „Liebe“ solle eine „unmittelbare“ werden. Der Mensch soll „den Mensch um des Menschen willen lieben“. Durch das Einschieben eines Dritten – Gott – „hebe (man) das Wesen der Liebe auf“. Der junge Marx nutzte in den „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten“ noch die Begriffe Feuerbachs wie „Gattungswesen“. Den Charakter seines „Gattungswesens“ bestimmte er aber völlig anders. „Das Gattungsleben, sowohl beim Menschen als beim Tier, besteht physisch einmal darin, dass der Mensch (wie das Tier) von der unorganischen Natur lebt.“ Die Natur sei der „unorganische Leib des Menschen“. Mit diesem müsse er „in beständigem Prozess bleiben (…), um nicht zu sterben“. Als „Gattungsleben“ und „Gattungscharakter“ bestimmte Marx – schon weit über Feuerbach hinausgehend – „das produktive Leben“.
In eben dieser Schrift hob Marx auch die Bedeutung der Gesellschaft für das Individuum hervor. Die strikte Trennung von gemeinschaftlicher und individueller Tätigkeit verwarf er. Auch dann, wenn der Mensch eine Tätigkeit ausführe, die auf den ersten Blick als eine rein individuelle erscheine – wie zum Beispiel das Verfassen eines Textes –, sei der Verfasser nichtsdestoweniger „gesellschaftlich, weil als Mensch tätig“. Denn sowohl Sprache als auch Material, das ich als Verfasser nutze, ist mir „als gesellschaftliches Produkt gegeben, mein eigenes Dasein ist gesellschaftliche Tätigkeit“. Marx schlussfolgerte: „Das Individuum ist das gesellschaftliche Wesen. Seine Lebensäußerung ist daher eine Äußerung und Bestätigung des gesellschaftlichen Lebens.“
Entfremdete Arbeit
Eines der Kapitel der „Ökonomisch-philosophischen Manuskripte“ trägt den Titel „Die entfremdete Arbeit“. Das Verhältnis des Arbeiters zu den Produkten seiner Arbeit sei „Entfremdung“, „Entäußerung“. Denn das Produkt der Arbeit trete dem Produzenten als „fremdes Wesen“, als „unabhängige Macht“ gegenüber.
Da das produktive Leben, also die Arbeit, das Gattungswesen des Menschen sei, sei er durch die Entfremdung von eben dieser auch seiner Gattung entfremdet. Der Fortschritt über Feuerbach hinaus besteht darin, dass Marx die Entfremdung des Menschen von seinem „Wesen“ in der Sphäre der praktischen Tätigkeit verortete. Er ging noch weiter: Die Industrie sei „das aufgeschlagene Buch der menschlichen Wesenskräfte, die sinnlich vorliegende menschliche Psychologie“. Der junge Marx kritisierte, dass die Industrie bisher nur als etwas dem Menschen Äußerliches gesehen wurde – als etwas, das nicht im Zusammenhang mit dem „Wesen des Menschen“ stehe. Man habe „nur das allgemeine Dasein des Menschen, die Religion, oder die Geschichte in ihrem abstrakt-allgemeinen Wesen, als Politik, Kunst, Literatur etc. als Wirklichkeit der menschlichen Wesenskräfte und als menschliche Gattungsakte zu fassen (ge)wusst“.
Der entfremdeten Realität stellte Marx ein Ideal – den Kommunismus – gegenüber. Dieser sei die „Reintegration oder Rückkehr des Menschen in sich“. Den Kommunismus sah er als „positive Aufhebung des Privateigentums als menschlicher Selbstentfremdung und darum als wirkliche Aneignung des menschlichen Wesens durch und für den Menschen“. Erst der Kommunismus sei „die wahre Auflösung des Streits zwischen Existenz und Wesen“.
Marx trat der gegebenen Realität, die er als dem menschlichen Wesen entfremdet bestimmte, mit einem humanistischen Ideal gegenüber – „einem Ideal der nicht entfremdeten Arbeit“, wie Schleifstein es formulierte. Er analysierte die Realität vom Standpunkt dieses Ideals. Dieser Fehler hat die Folge, dass Marx in den „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten“ das Privateigentum als Folge der Entfremdung sah, statt als deren Ursache: „Das Privateigentum ist also das Produkt, das Resultat, die notwendige Konsequenz der entäußerten Arbeit, des äußerlichen Verhältnisses des Arbeiters zu der Natur und zu sich selbst.“ Das Marxsche Denken stand hier noch auf dem Kopf, stellte Schleifstein fest: „Die abstrakte Konstruktion hat zur Folge, dass in der Darstellung als Resultat erscheint, was eigentlich Ursprung und Ursache der Entfremdung der Arbeit ist.“
Marx auf den Füßen
Mit Blick auf die in den „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten“ entwickelten Positionen schrieb Schleifstein: „Am Ausgangspunkt seiner Analyse der Entfremdung hatte Marx zunächst nicht den von Feuerbach (…) vorbereiteten Boden verlassen. Auch die Verwendung solcher unhistorischen Kategorien wie ‚menschliche Wesen‘, ‚Gattungswesen‘, ‚Gattungsleben‘ sind Ausdruck der noch sehr starken Einflüsse Feuerbachs auf sein Denken.“ Aber, so Schleifstein weiter: „Die Entwicklung von Marx hört nicht 1844 auf, ja sie beginnt eigentlich erst richtig in den ‚Ökonomisch-philosophischen Manuskripten‘.“
Die Grundsteinlegung des theoretischen Gebildes, das wir heute unter Marxismus kennen, erfolgte nur ein Jahr später. Im Frühjahr 1845 schrieb Marx die Feuerbachthesen.
Vieles von dem, was in den „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten“ schon angelegt war, vertiefte er. Dabei überwand er die Mängel der Feuerbachschen Philosophie, von denen auch sein Denken bis dahin beeinflusst war.
Feuerbach, schrieb Marx nun, löse zwar das „religiöse Wesen in das menschliche Wesen auf“. Aber an diesem Punkt angelangt, fixiere er „das religiöse Gemüt für sich“. Er sei daher gezwungen, „von dem geschichtlichen Verlauf zu abstrahieren (…) und ein abstrakt – isoliert – menschliches Individuum vorauszusetzen“. Feuerbach könne das menschliche Wesen „daher nur als ‚Gattung‘, als innere, stumme, die vielen Individuen natürlich verbindende Allgemeinheit“ fassen. Den Begriff der Gattung hatte Marx hiermit erledigt. Feuerbach sehe nicht, „dass das ‚religiöse Gemüt‘ selbst ein gesellschaftliches Produkt ist und dass das abstrakte Individuum, das er analysiert, einer bestimmten Gesellschaftsform angehört“. Während Marx in den „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten“ den Menschen schon als Produkt der Gesellschaft sah, ging er nun einen bedeutenden Schritt weiter und historisierte seinen Standpunkt: der Mensch als Produkt einer bestimmten historischen Gesellschaftsformation.
Begreifen der menschlichen Praxis
Zudem rückte Marx die „sinnlich menschliche Tätigkeit“ vollends ins Zentrum seines Denkens. Er kritisierte die Philosophie Feuerbachs als bloß „anschauenden Materialismus“, der „nur das theoretische Verhalten als das echt menschliche“ betrachte. Aber: „Alles gesellschaftliche Leben ist wesentlich praktisch. Alle Mysterien, welche die Theorie zum Mystizismus veranlassen, finden ihre rationelle Lösung in der menschlichen Praxis und in dem Begreifen dieser Praxis.“ Der Möglichkeit falscher Schlussfolgerungen, des Durcheinanderbringens von Ursache und Wirkung, wie es zuvor noch in den „Manuskripten“ geschehen war, entzog er damit den Boden. Das lässt sich in der 1845/46 entstandenen „Deutschen Ideologie“ nachlesen. Dort analysierte Marx die Entfremdung als Folge des Privateigentums und nicht als deren Ursache. Es wurde von nun an, wie Friedrich Engels es formulierte, „wirklich Ernst gemacht“ mit der materialistischen Weltanschauung. Die menschlichen Fähigkeiten zur Erkenntnis der Welt wurden durch die Entwicklung des Historischen Materialismus um ein bedeutendes Instrument reicher.

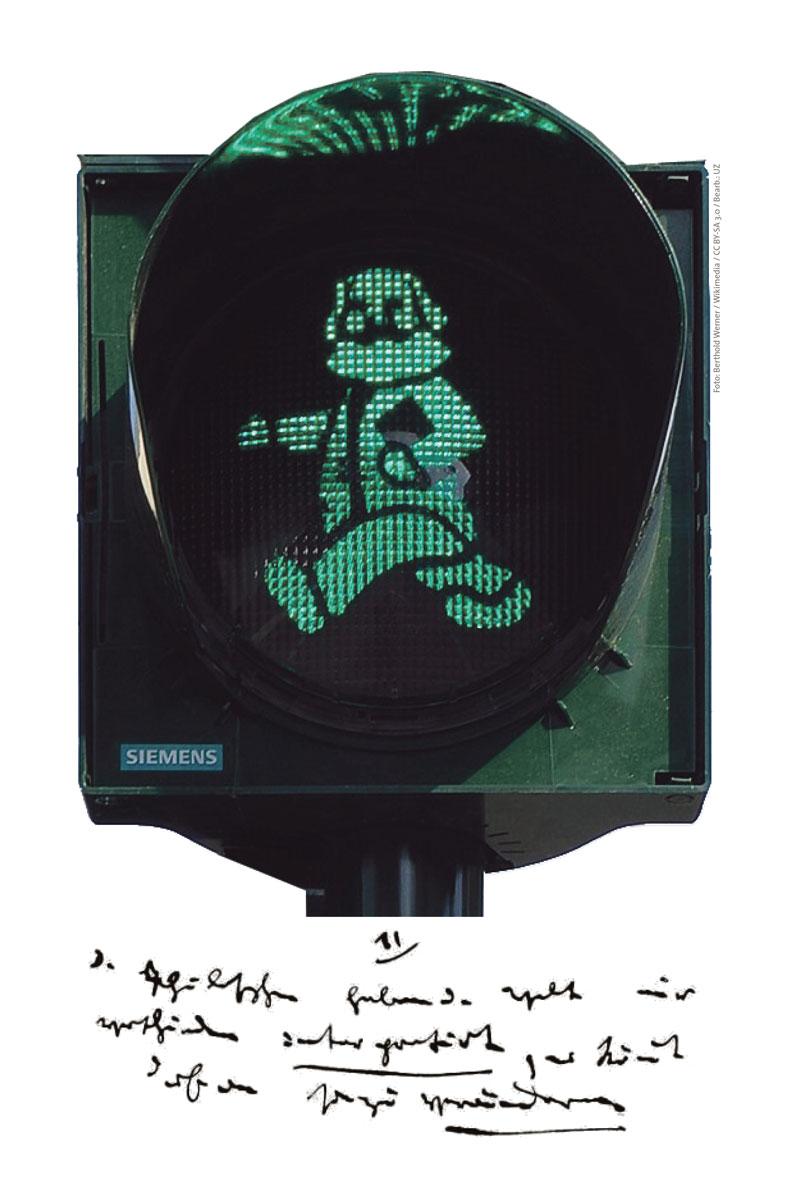

![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)