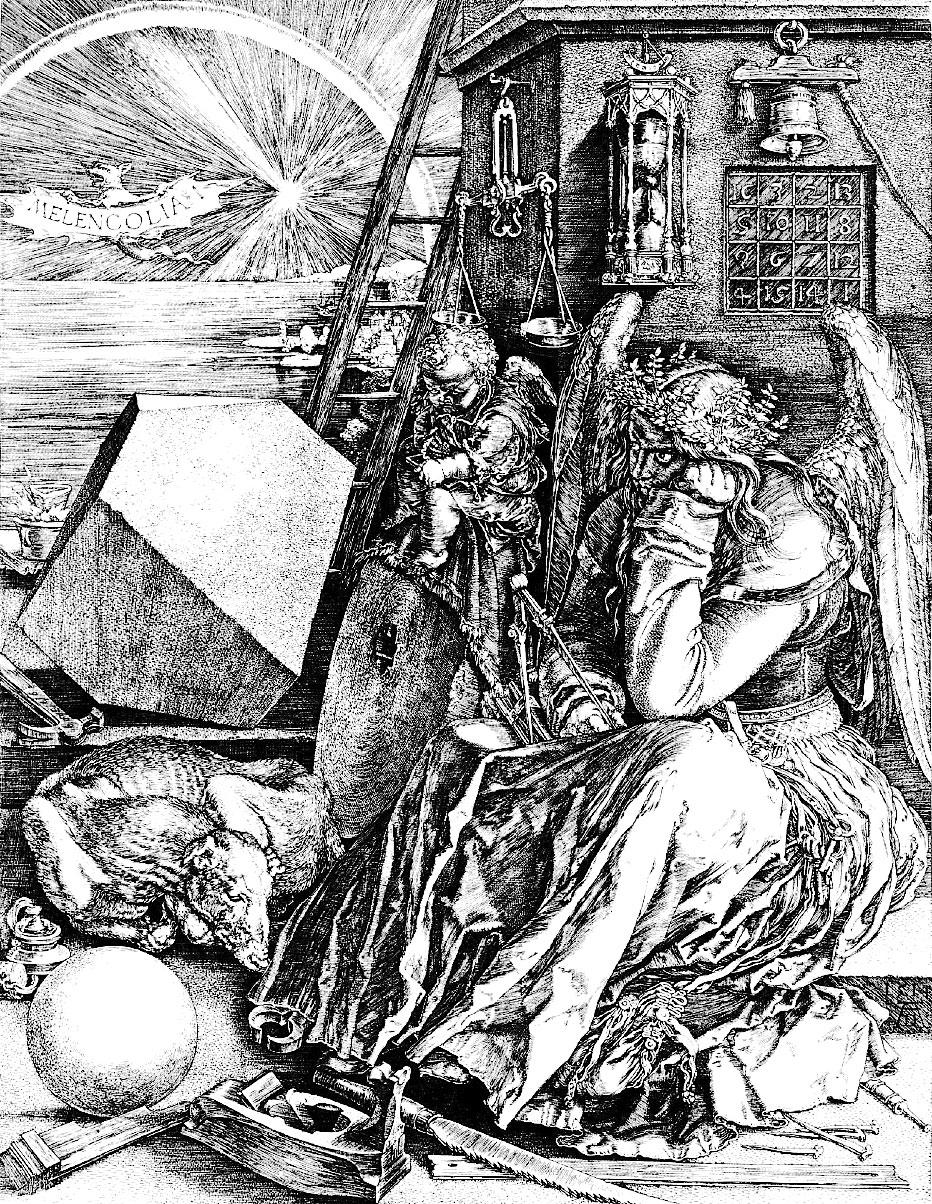Die Sieger der Geschichte feierten ihre größten Triumphe. Der Rote Oktober war niedergerüstet, der ehemals widerständige Teil des Globus wieder der ganz normalen imperialistischen Ausbeutung ausgeliefert. Die Kurse knallten durch die Decke. Aus Reichen wurden Superrreiche. Nur die Armen blieben, was sie waren: arm. Sie wurden höchstens ärmer.
Nur ein Jahrzehnt später stockte das große „Enrichissez-vous!“, die große Bereicherung. Die „Dotcom-Blase“ platzte im März 2000. Man durfte zur Kenntnis nehmen, dass ein Start-up, eine Geschäftsidee, nicht unbedingt auch ein profitables Geschäft bedeutete, und dass die Reichtumsvermehrung aus dem Nichts auch im globalen Weltdorf eine Legende der Anlage-„Berater“ blieb.
Natürlich sollte die Party weitergehen. Die Bush-Administration, in dem Gefühl, vor Kraft kaum laufen zu können, hatte Irak und Afghanistan überfallen und begann sich an der Öl- und Gastankstelle der Welt, dem Nahen Osten, häuslich einzurichten. Die Zinsen befanden sich nach dem Dotcom-Crash auf historischem Tiefststand und die Banken hatten einen neuen „Spin“, eine neue Großerzählung: Die Geschichte vom allzeit steigenden Häusermarkt.
In nur zehn Jahren, von 1996 bis 2006, hatten sich die Immobilienpreise mehr als verdoppelt. In diesem exponentiellem Wachstum war die Idee entstanden, die Immobilienkredite aus dem angenommenen Wertzuwachs zu finanzieren. Es war die Geburtsstunde der „Ninja-Kredite“ (No income, no job, no asset) und die des „Subprime“-Marktes. Ein Bombengeschäft – solange die Preise weiter stiegen. Hier nun setzt Adam McKays Film ein.
Nichts ist erfolgreicher als der Erfolg. Während alle die große Wall-Street-Party feiern, gibt es nur einige wenige, die nachdenken. Eigentlich nur einer. Alle anderen werden eher zufällig auf die Probleme aufmerksam. Das ist natürlich die dichterische Freiheit des Regisseurs und seines Drehbuchautors Charles Randolph, die sich auf das gleichnamige Buch des US-Wirtschaftsautors Michael Lewis (Wall Street Poker, Moneyball, Flash Boys u. a.) stützen. Bekanntlich gab es da einen gewissen Karl Marx, der sich schon vor 150 Jahren über die Absurditäten der Börsenschwindel amüsierte. Und er war da nicht allein. Und selbst im bürgerlichen Lager hatten einige 1929 nicht vergessen.
Nun ist Karl Marx im US-Kino ein absolutes No-go. Unser Held heißt daher Michael Burry (exzellent Christian Bale). Der Ex-Mediziner ist selbst Fondsmanager und nicht zuletzt aufgrund seines fehlenden Auges ein leicht verschrobener, nahezu autistischer Einzelgänger. Burry begreift die notwendige Endlichkeit des Geschäftsmodells Subprime-Markt. Dabei sind es vor allem die variablen Zinssätze, die ihm Sorgen bereiten. Ab 2007 dürften seiner Meinung nach viele „Ninja“-Kreditnehmer in massiven Zahlungsschwierigkeiten stecken, wenn für ihre Kredite der volle Kapitaldienst fällig wird. Nicht das wichtigste Detail des Problems, aber auch nicht unbedeutend.
Burry, nachdem er mit seinen Bedenken bei anderen Bankern auf Granit beißt, versucht den Tiger zu reiten. Er wettet – short – gegen den Markt. Seine Aufträge werden von den etablierten Investmentbankern ironisch-amüsiert angenommen (ein Spinner) – und machen schnell die Runde. Während die Herde ungerührt dem von den Leithammeln vorgezeichneten Trend folgt, gibt es ein paar schräge Typen, die nun stutzig werden. Da wettet einer auf den Untergang.
Da ist der cholerische Trader Mark Baum (Steve Carell), der sich ohnehin mit jedem streitet, und nur auf eine Möglichkeit gewartet zu haben scheint, sich wieder einmal mit Gott und der Welt anzulegen. Da ist der skrupellose Deutsche-Bank-Händler Jared Vennett (Ryan Gosling), der privat gegen die Strategie seiner Bank mit Baum und seiner Crew gemeinsame Sache macht. Und da sind die albern schnöselhaften Kleinzocker Charles Geller (John Magaro) und Jamie Shipley (Finn Wittrock), die mithilfe des grün-alternativen Aussteigers und Ex-Bankers Ben Rickert (Brad Pitt) endlich den großen Deal machen wollen. Übertroffen nur von zwei naiv-gierigen Hypotheken-Brokern (Max Greenfield, Billy Magnussen) und einer Striptease-Tänzerin (Heighlen Boyd) mit vier Häusern und einer Eigentumswohnung. Alles in allem nicht gerade reale Menschen, sondern eher überzeichnete Charaktertypen.
„The Big Short“ ist denn auch keine wirkliche Komödie, sondern streckenweise eher ein rasant gemachter Aufklärungsfilm, der die eigentliche Handlung schon mal für Kommentare aus dem Off unterbricht, Informationstexte einblendet, oder einige, zum Teil nur zu diesem Zweck eingebaute Protagonisten direkt zum Publikum sprechen lässt. Allerdings dürfte das hohe Tempo und die episodenhaft-zergliederte Montage dem Aufklärungsansatz manchmal ein bisschen in die Quere kommen. Es kann also nicht schaden, sich schon vorher mit den wesentlichen Strukturen der Finanzkrise und Begriffen wie Rating, MBS (Mortgage-Backed Security, hypothekenbesichertes Wertpapier), CDO (Collateralized Debt Obligation, etwa „strukturierte“ Schuldverschreibung), Securitization (Verbriefung) und Leerverkäufen vertraut gemacht zu haben.
Adam McKays spannender Film verlässt den „Inner Circle“ des Investmentbanking so gut wie nie. Seine positiven Helden sind also ebenso Investmentbanker und Hedge-Fonds-Manager. Das produziert eine nicht unproblematische Ausgangslage. Außer seiner liebenswert-exotischen Schrulligkeit gibt es also in der Sache nicht wirklich etwas, das Michael Burry zu einem überzeugenden Gegenentwurf zu den ebenso arrogant-gierigen wie dümmlich-spießigen Banktypen machen könnte. Seine Antwort auf das große Absahnen ist, ebenfalls abzusahnen. Nur mit der entgegengerichteten, zugegebenermaßen intelligenteren Strategie. Statt einfach der Herde und ihrem hohlen „Diesmal ist alles anders“ zu folgen, schaut er genauer, wohin er da denn folgen soll.
Ähnlich ist es mit Mark Baum. Alle anderen sind ohnehin nicht wirklich ernst zunehmen, inklusive des mutwillig überverschrobenen Aussteigers Ben Rickert. Aber auch der ständig auf Krawall gebürstete Baum hat alles andere als ein Alternativprogramm. Zuletzt macht auch er, wie die anderen, schlicht Kasse. (Man darf das verraten, der Crash auf den sie – short – gewettet hatten, ist ja, real, nur allzu bekannt.) Autor Michael Lewis hat sich offensichtlich einen romantischen Glauben an das Gute im Banker bewahren können. Wie auch in seinem Buch „The Flash Boys“ gibt es immer ein paar standhafte Aufrechte, die sich den neuesten Trends zur großen Abzocke standhaft widersetzen. Ohne Erfolg, wie die Geschichte – und der Film – zeigen. Die nächste Blase ist schon in Arbeit.
Auch wenn „The Big Short“ eine politökonomische Analyse der kapitalistischen Krise naturgemäß nicht ersetzen kann und auch die politische Dimension der Krise leider komplett ausgeblendet ist, ist er ein sehenswerter, unterhaltsamer und aufklärerischer Film. Und das ist in einer Welt der vorsätzlichen Massenverblödung schon sehr viel. Zwar sind seine Alternativen nicht wirklich überzeugend, aber ist das nicht auch ein Reflex der politischen Realität? Man braucht sich nur die Kandidaten für die nächste US-Präsidentenwahl anzusehen.



![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)