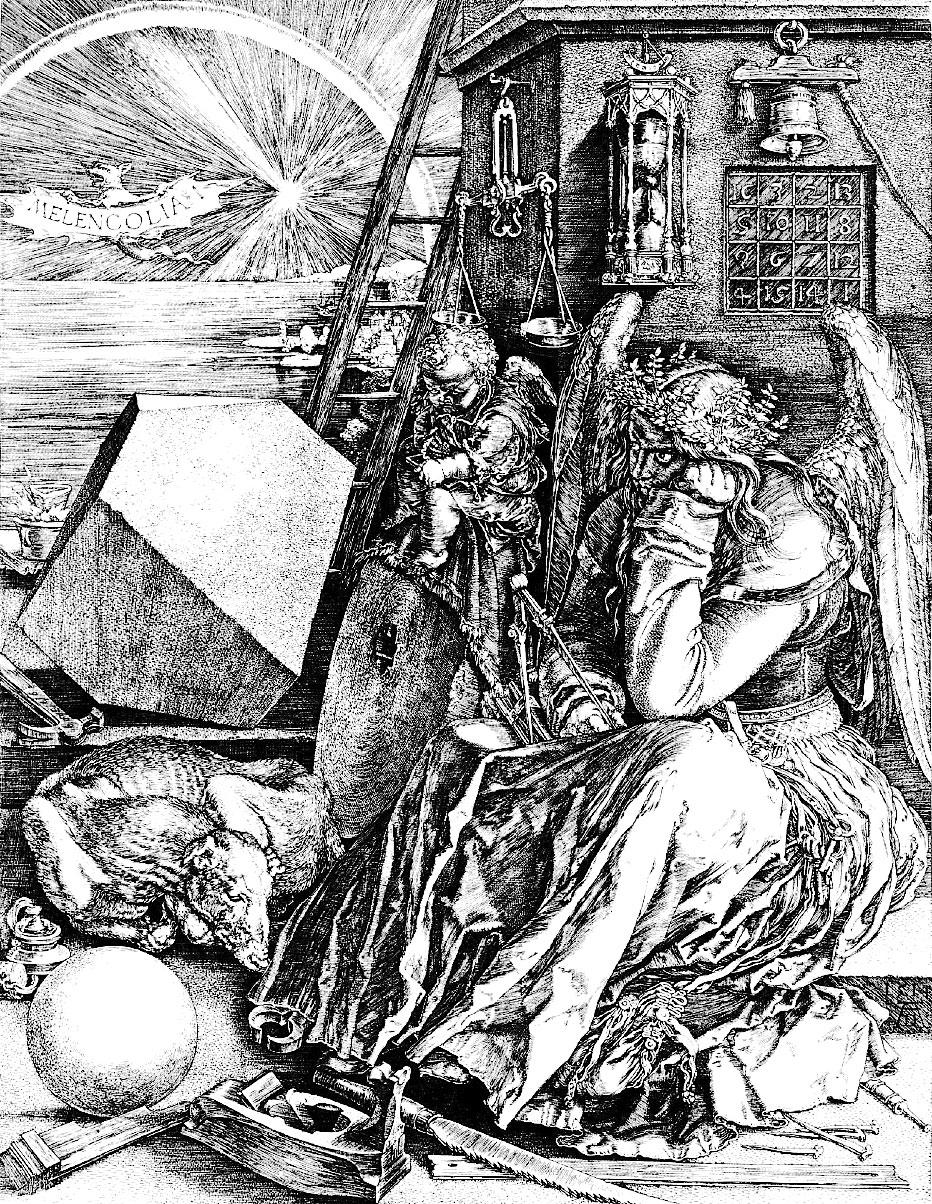Der Kapitalismus bezahlt Arbeit schlecht oder gar nicht. Mit dieser Praxis steckt er alle an, die unter ihm leiden, auch die Gutwilligen. Ich zum Beispiel habe gewaltige Schulden bei Georg Fülberth, denn der hat mir den Kopf öfter aufgeräumt, als ich sagen oder bezahlen kann. Als Teenager zum Beispiel wollte ich unbedingt die Kultur abschaffen, das heißt: die Literatur durch Flugblätter, Wandparolen und Aktionskrawall ersetzen. Das hatten mir die Leute beigebracht, bei denen ich meinen frühen Linksradikalismus gelernt hatte. Es waren enttäuschte, in die Provinz geflohene oder dorthin vertriebene Bruchexistenzen aus der kurz zurückliegenden studentischen Protestbewegung, die von etwa Mitte der Sechziger bis Mitte der Siebziger wie ein enormer linker Aufbruch ausgesehen hatte und sich jetzt im Gefolge von Repression, Perspektivlosigkeit, programmatischer Schwäche und mangelnder Verankerung in einer kämpfenden Klasse, geschweige Masse, zerstreute und zersetzte.
Diese (teils recht tapferen und ehrenwerten) Besiegten erklärten ihren Abstand zum organisierten Kommunismus und zur sozialistischen Staatenwelt damit, jene beiden seien längst nicht mehr revolutionär, sondern verhärtet, erstarrt, historisch erledigt wie der Reformismus der Zweiten Internationale. Der organisierte Kommunismus und die sozialistischen Staaten seien vor allem kulturell rückständig: „In der DDR führt man noch bürgerliches Theater vor, in der Sowjetunion gibt es noch gegenständliche Malerei, das müsste ja alles weg, wenn das neue Leben beginnt, das ganz andere!“
Ich glaubte das genau zwei Sommer lang, weil man’s mir, teils anarchistisch, teils maoistisch inspiriert, gepredigt hatte. Dann gab mir eine etwas ältere Kommunistin Georg Fülberths „Proletarische Partei und bürgerliche Literatur“ (1972), die Frucht fleißiger und genauer Forschung in glasklarer Darstellung. Darin stand, dass mein ganzer kindlicher Aufstand und Krieg gegen das Erzählen, gegen Melodien und gegen Bilder, bei denen man erkennt, was darauf zu sehen ist, nicht neu war, sondern schon die älteste deutsche Sozialdemokratie diese als bürgerlich geschmähten Dinge teils nicht mochte. Wilhelm Liebknecht, gewiss ein integrer und kluger Mann, schrieb schon 1891, man könne nicht gleichzeitig dem Kriegsgott dienen und den Musen, mehr: Parteitätigkeit sei so wichtig, dass für Kultur und Literatur keine Zeit bleibe. Die größte Überraschung war für mich, bei Fülberth lesen zu müssen, dass solche Zurückweisungen der Kunst, die ich von Achtundsechzigern kannte, nicht nur Liebknecht, nicht nur Gustav Landauer und Karl Korn (1865 bis 1942) formuliert hatten, sondern auch der allerreformistischste Revisionist überhaupt, Eduard Bernstein. Offensichtlich lag das Kulturrebellentum quer zu der Frage: Revolution oder nicht? Ebenso offensichtlich war die Sache nicht so einfach und undialektisch zu haben, dass jemand, der die gegebenen Verhältnisse ablehnte, einfach alles anzünden und wegbrüllen wollen musste, was schon da war. So hat mich Fülberth für Lenin vorbereitet, dessen Position zum Kulturerbe, also sowohl den dazugehörigen Werken wie den zu ihrer Produktion erforderlichen Techniken, bekanntlich die weiseste unter allen kommunistischen ist, nämlich die Meinung, dass die kommunistische Bewegung und die dazugehörige Partei sich das Alte aneignen, es bewahren, mehren, hüten und über es hinausarbeiten sollen.
Genau so macht Fülberth das mit dem Wissen, dem historischen wie dem methodischen. Es fängt mit dem Wissen über den Kapitalismus an, das wir mit und seit Marx gewonnen haben und das Fülberth „Kapitalistik“ nennt, und es hört mit den Kulturstreitigkeiten der Gegenwart noch lange nicht auf, die er durch Einblicke in die Archive aufhellt. Ob Fülberth in der schwersten Zeit der Desorientierung des Weltkommunismus erklärt, wie der Kommunismus gerade in Deutschland nicht nur durch feindliche, sondern eigene Widerstände hindurchmusste, um überhaupt zu existieren („KPD und DKP 1945–1990“, erschienen 1990), ob er die von vielen artikulierte, aber oft etwas ungenau gefasste These, an der Annexion der DDR durch die BRD sei nicht nur Erstere, sondern auch Letztere kaputtgegangen und wese nur mehr als bedrohlich regsame Leiche fort, in seiner „Eröffnungsbilanz des gesamtdeutschen Kapitalismus“ 1993 mit Inhalt und Sinn füllt, oder ob er der Welt erlaubt, in einem Querschnitt seiner „politischen Publizistik aus drei Jahrzehnten“ namens „Explorationen“ (2014) einige Arbeiten für den Tag als Arbeiten fürs Jahrhundert zu erkennen – immer sagt das, was er aufschreibt: So einfach ist es dann doch nicht, wie die Teenager glauben, aber verstehen kann man es schon.
Sein Artikel in der UZ zur Kühnert-Habeck-Enteignungs-Aufregung am 10. Mai 2019 etwa war der allerallerbeste, der überhaupt veröffentlicht wurde, das weiß ich, weil ich (als FAZ-Redakteur) sie alle lesen musste, um selbst einen schreiben zu dürfen. Dies zu den Texten; der Mensch Georg Fülberth persönlich aber kann einem Neugierigen, ich habe das erlebt, dabei helfen, die eigenen Gedanken zu klären, wie das keine Uni je können wird, und seine Praxis, auf Veranstaltungen mit Ausdrucken vorbereiteter Texte zu arbeiten, die groß genug ausgedruckt und handlich genug zugleich sind, dass man von ihnen auch abweichen kann, habe ich mir mit enormem Gewinn einfach abeguckt. Man soll Georg Fülberth also lesen und beobachten, man wird sich dadurch verbessern Vielleicht, so hoffe ich, weil ich bei ihm Schulden habe, ist das der Lohn, den er will und der ihm reicht: dass die Leute weniger blöd werden, mit seiner in jedem Fall unterbezahlten Hilfe.



![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)