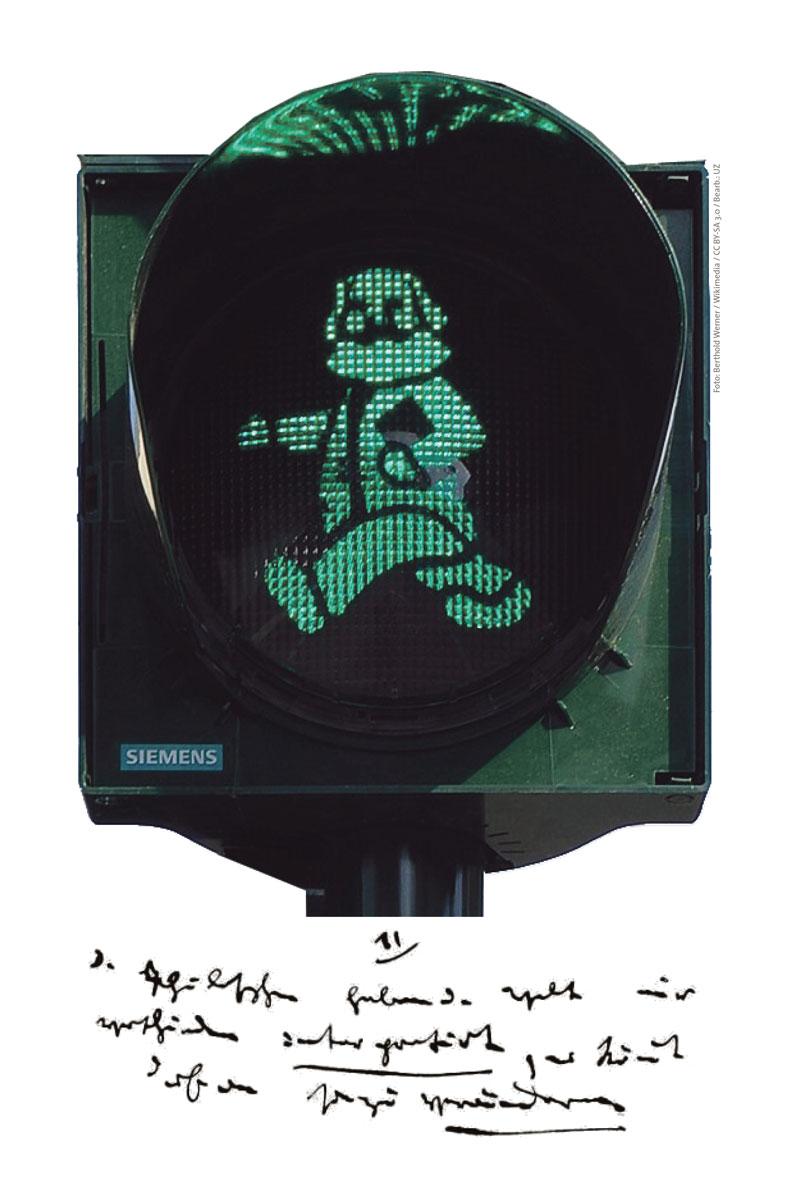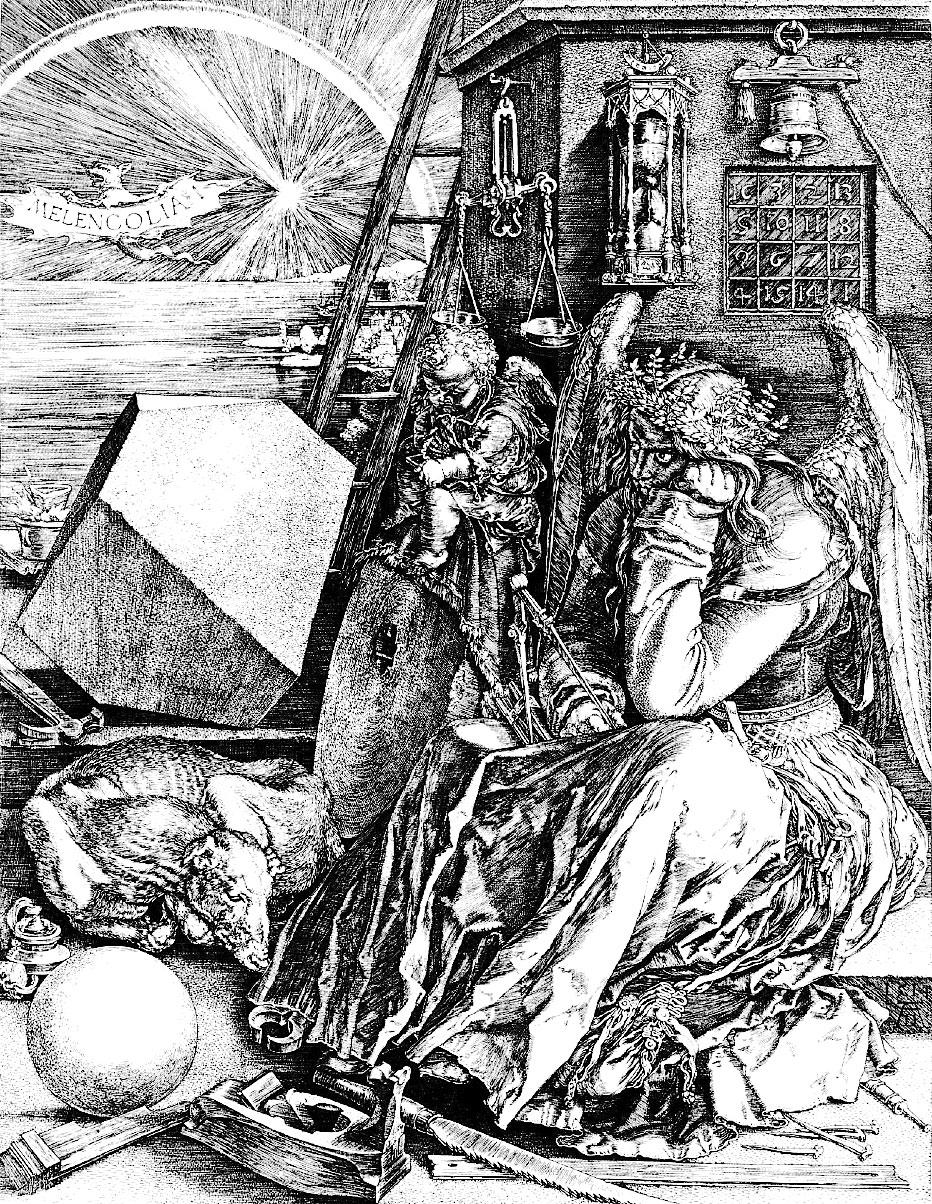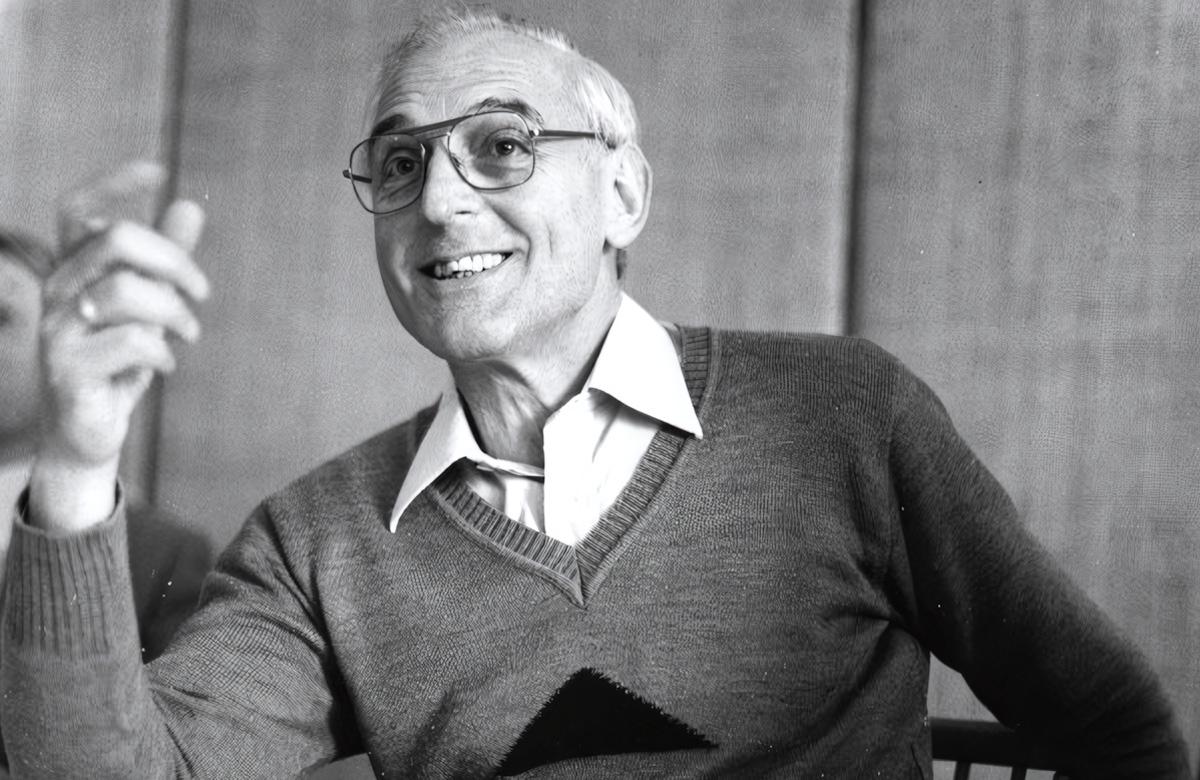Wir geben, beginnend mit dieser Ausgabe von UZ, den Gliederungen der DKP die Möglichkeit, ihre Diskussionsergebnisse darzustellen. Zur Strukturierung werden wir diese in Blöcken zusammenfassen. Wir starten mit der Einschätzung internationaler Entwicklungen in den Leitgedanken 1 bis 3.
Darauf folgt die Analyse der Situation in Deutschland in den Leitgedanken 4 bis 7. Zum Abschluss sollen die Kräfte des Widerstands diskutiert werden. Die Gliederungen der DKP bitten wir um die Einsendungen ihrer Diskussionsbeiträge zu den entsprechenden Blöcken mit einem maximalen Umfang von 6.000 Zeichen an: debatte@unsere-zeit.de
UZ
Die zentrale Analyse im Leitgedanken 1, „dem US-geführten Imperialismus droht ein ökonomischer und politischer Hegemonieverlust“, wird nicht begründet. Es bleibt dabei unklar, was überhaupt genau mit Hegemonie gemeint sein soll. Gehen wir vom Hegemonieverständnis Antonio Gramscis aus, geht es dabei (neben Gewalt und Zwang) um die gesamtgesellschaftliche Zustimmung für bestimmte Werte, Überzeugungen und Weltanschauungen einer herrschenden Klasse. Ein vermeintlicher Hegemonieverlust des Imperialismus müsste demzufolge mit einer erheblichen Stärkung der weltweiten Arbeiterklasse einhergehen. Vor allem im Leitgedanken 9 wird dies aber richtigerweise konträr eingeschätzt: Vor allem der deutschen Arbeiterklasse in einem der imperialistischen Zentren der Welt mangelt es an Klassenbewusstsein und Organisation. Somit stellt sich uns die Frage, woher die Einschätzung einer international gestärkten Arbeiterklasse kommt.
In der Einleitung zu den Leitgedanken wird bereits festgestellt, dass sich „die internationalen Kräfteverhältnisse zuungunsten des Imperialismus verschoben haben“. Im Leitgedanken 1 wird weitergehend vom „gemeinsame(n) Interesse an der Machterhaltung des Imperialismus“ gesprochen. Es scheint, als würde in den Leitgedanken unter dem Begriff Imperialismus ausschließlich das in sich widersprüchliche, von den USA angeführte Bündnis verschiedener imperialistischer Staaten verstanden. Im Parteiprogramm definieren wir Imperialismus mit Lenin als das „monopolistische Entwicklungsstadium des Kapitalismus“. Wir müssten also die Entwicklungen der Monopole weltweit als den ökonomischen Kern und ihr Kräfteverhältnis gegenüber der Arbeiterklasse untersuchen, um festzustellen, ob der Imperialismus als kapitalistisches Entwicklungsstadium im Niedergang ist. Dennoch wird im Leitgedanken 1 richtigerweise eingeschätzt, dass „das gemeinsame Interesse (der verschiedenen, in der NATO zusammengeschlossenen Staaten) an der Machterhaltung des Imperialismus (…) die sich dadurch verstärkenden innerimperialistischen Widersprüche“ verdeckt. Leider wird diese Einschätzung im weiteren Verlauf der Leitgedanken selbst nicht konsequent durchgehalten und an verschiedenen Stellen nur noch von einer Seite des Widerspruchs, nämlich der Unterordnung der BRD unter die USA, gesprochen, beispielsweise im Leitgedanken 10. Wir sollten also genauer diskutieren, was wir unter Imperialismus verstehen: Meinen wir verschiedene Staaten und ihr außenpolitisches Agieren, vor allem im Rahmen der NATO – oder verstehen wir mit Lenin Imperialismus als ein Weltsystem des entwickelten, monopolistisch gewordenen Kapitalismus, mit seinen ihm innewohnenden, den ökonomischen Widersprüchen entspringenden Drang nach (auch, aber nicht nur militärischer) Eroberung neuer Absatzmärkte, Einflussgebiete und Rohstoffquellen?
Als Alternativen zu den vom Imperialismus genutzten Strukturen wie IWF, Weltbank und SWIFT werden im Leitgedanken 1 BRICS, BRICS-Plus und SCO genannt – inwiefern diese als solche fungieren, wird aber nicht weiter ergründet. Dass letztgenannte Strukturen sich jedoch nicht als Alternative zur kapitalistischen Weltwirtschaft verstehen, diese nicht sein wollen und ihr faktischer Aufstieg sich innerhalb, auf Basis und im Rahmen dieser kapitalistischen Wirtschaft vollzieht, wird in den Leitgedanken hingenommen und zuweilen sogar positiv bewertet. Der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit (auch in den BRICS-Staaten) spielt unserer Meinung nach in diesem Teil der Analyse eine zu geringe Rolle. Die BRICS-Staaten bekennen sich zu IWF und Weltbank. Dass sie diese gleichwohl reformieren wollen, auch um ihr eigenes Gewicht in ihnen zu erhöhen, ändert nichts an der grundsätzlichen Ausrichtung dieser Institutionen.
Aus den genannten Einwänden lässt sich an vielen Stellen der Leitgedanken eine Tendenz ableiten, die man als Lagerdenken beschreiben könnte: Auf der einen Seite stehen die USA und die in der NATO zusammengeschlossenen imperialistischen Staaten und auf der anderen Seite die bisher halb- oder neokolonial unterdrückten Länder, deren Zusammenschluss antiimperialistischen Charakter habe. Die Widersprüche innerhalb der NATO – etwa zwischen EU und NATO oder auch zwischen Frankreich und BRD innerhalb der EU – und auf der anderen Seite jene zwischen Russland und China oder innerhalb der BRICS-Plus-Kooperation werden aus unserer Sicht unterschätzt und nicht im Rahmen der Widersprüche der kapitalistischen Wirtschaftsordnung betrachtet.


![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)