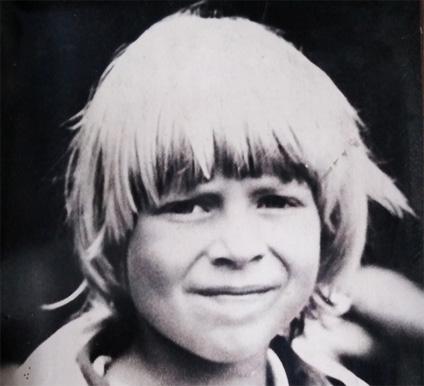Ein Platz im Studentenwohnheim der Humboldt-Universität in Berlin-Biesdorf kostete zehn Mark, wer eine Einraumwohnung in einem Altbauviertel ergattert hatte, bezahlte selten mehr als 40 Mark. Eine Mahlzeit in der Studentenmensa war für 60 Pfennig zu haben, ein großes Bier bei „Olga“ in der Linienstraße in den 1970er Jahren für 35 Pfennig – einfache Genüsse konnten sich Studenten in der DDR ohne Weiteres leisten. Wer in der Humboldt-Universität Appetit auf Besonderes hatte, ging in die sogenannte Professorenmensa. Dort wurde serviert, Hauptgerichte ab 4 Mark. Suppe, Salat oder Nachtisch gab es auch, wobei der Krautsalat in der Studentenmensa nicht zu verachten war. Die Stipendien, die jede und jeder erhielt, wurden regelmäßig erhöht. Sie begannen irgendwo bei 150 Mark monatlich und wurden durch Leistungsstipendien für gute Noten erhöht, nicht wenige erhielten Zuschüsse von den Betrieben, in denen sie vor dem Studium gelernt und gearbeitet hatten. Hinzu kam: Die Industrie der DDR-Hauptstadt ahnte noch nichts von der Vernichtung durch die Treuhand und hatte stets Bedarf an studentischen Hilfskräften. Besonders beliebt waren in den 1970er und 1980er Jahren Schichten in den Großbetrieben – Kabelwerke Oberspree, Transformatorenwerk Oberschöneweide (TRO) und Werk für Fernsehelektronik, wo unter anderem Bildschirme hergestellt wurden. Dort wurden zum Beispiel Nachtschichten am höchsten bezahlt – nach meiner Erinnerung bis über 50 Mark.

Freund Uli Jeschke hat in einem Text über eine als stadtsoziologische Erkundung getarnte studentische 24-Stunden-Tour durch Gasthäuser der DDR-Hauptstadt daran erinnert, welche zentrale Bedeutung zum Beispiel das Operncafé schräg gegenüber vom Hauptgebäude der Universität Unter den Linden fürs Unileben hatte. Dort hielten zum Beispiel einige Professoren ihre studentischen Sprechstunden ab, weil sie keinen eigenen Schreibtisch in ihren Bereichen hatten, und wenn es gut lief, gab es für die Konsultierenden Kaffee und sehr guten Kuchen. An einem meiner Seminare nahm ein Kommilitone teil, der von seinen Großeltern – bekannten bürgerlichen Antifaschisten – als Alleinerbe eingesetzt worden war, was ihn zum Besitzer verschiedener Immobilien in Westberlin und in der BRD gemacht hatte. Er kam in einem großen Mercedes zu meinen Seminaren über bürgerliche Philosophie des 20. Jahrhunderts und lud öfter die gesamte Seminargruppe ins Operncafé. Wegen des vielversprechenden Umsatzes fanden sich immer Plätze. Dort blieb es nicht bei Kaffee oder Rohkost, aufgetischt wurden feine Speisen. Ich schwöre aber, dass das die Noten für den Einlader nicht beeinflusst hat. Außerdem zog er bald nach Westberlin und tauchte nur noch als Dauerbesucher des „Espresso“ im „Lindencorso“ an der Ecke Friedrichstraße/Unter den Linden auf – einem weiteren Studententreff in der Nähe des Uni-Hauptgebäudes.
Das war selbstverständlich nicht Alltag, aber von Zeit zu Zeit konnte sich der Student im Sozialismus das leisten. Wenige Schritte vom Operncafé entfernt wartete zum Beispiel der Palast der Republik mit seinen 13 gastronomischen Einrichtungen seit 1976 auf Gäste – vom Edelrestaurant über die Eisdiele bis zur Bierstube, in der ein halber Liter Berliner Pilsner 72 Pfennig kostete, Boulette oder Hackepeter nicht viel mehr. Die Restaurants wurden meist von Touristen aus aller Welt belagert – die DDR-Hauptstadt war der einzige Ort in den Ländern des Kalten Krieges, in den jedermann ohne Visum einreisen konnte. Ausweis und Mindestumtausch genügten.
Wer wie Uli Jeschke und seine soziologischen Forscher die Nacht mit frisch gezapftem Bier verbringen wollte, konnte das in der Hauptstadt in zwei oder drei Nachtkneipen mit normalen Preisen für Speis und Trank tun. Es gab auch nicht wenige Nachtbars, aber die waren für Studenten in der Regel zu teuer. Ich bevorzugte, etwa nach einer Nachtschicht in einem Betrieb, eine Nachtkneipe in der Oderberger Straße. Sie schloss zwar um sechs Uhr morgens, aber die Frühkneipe nebenan machte dann auf. Man saß dort mit Arbeitern der Müllabfuhr oder Kohleträgern, die meist sehr deftige Frühstücke zu sich nahmen, und verspäteten Studenten zusammen. Zu meiner damaligen Bude war es nicht weit, außerdem funktionierte damals noch der Nahverkehr. Erschwingliches Futter für Studenten gab es in der Hauptstadt jedenfalls rund um die Uhr.


![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)