Präzision und Mehrdeutigkeit hält man für Gegensätze. In Shakespeares Sprache aber sind beide immer da, und nehmen einander doch nie den Atem. Selbst simpelste Wortfolgen, etwa das grausige „the Tower, the Tower“ im Stück über Heinrich den Sechsten, sind bei ihm nicht etwas das bloße Gegenteil, sondern die verstärkende zweite Stimme zum

Reichtum kompliziertester Satzkonstruktionen. Bei Shakespeare kann man vierzehn Zeilen lang seufzen oder umgekehrt mit einem einzigen Wort eine Welt erklären. Daher kommt es, dass viele, die ihn verehren, über dem formalen Glanz des Werkes die Fülle und sinnliche Massivität seiner Stoffe vergessen, den menschlichen Inhalt.
Da reden nicht einfach schöne Worte mit sich selbst (obwohl sie wirklich sehr schön sind und mit allem reden können, manchmal auch mit sich selbst). Nein, hier reden erfundene Leute, die plastischer aus ihren ästhetischen, sozialen und psychologischen Voraussetzungen herausragen als manches Marmorbildnis in Museumshallen. Heutige Kunst inszeniert mit ihren tatsächlichen und metaphorischen Rechenmaschinen ja gern allerlei windige Virtualitäten „dreidimensional“. Gegen Shakespeares Figurenhandhabung sind das Strichzeichnungen. Der Dichter schaut seine Schöpfungen genauer an, als die meisten Menschen ihre eigenen wirklichen Erfahrungen, Stimmungen und Ansichten kennen. Sogar die Überschätzung der Vermittlung, der Darstellungsweisen, gegenüber dem, was da jeweils vermittelt wird und wie es dargestellt ist, hat er selbst thematisiert: Sein Hamlet stürzt unter anderem deshalb ins Unglück und reißt andere mit, weil sich dieser Zweifler immer wieder in Sprachbildern, „saws of books“, theatralischen Gleichnissen und Spekulationen verläuft. Selbst sein Gewand ist „inky“, von Tinte verschmiert, von Idealismus angekränkelt, und gerade das macht ihn zum gehemmten Vollstrecker einer unmöglichen Koalition des überwundenen Alten mit schwärmerischen Ahnungen von Übermorgen, was, wie André Müller sen. der Welt in „Hamlet ohne Geheimnis“ erklärt hat, für eine höchst greifbare und fatale politische Konstellation der Shakespearezeit steht. Shakespeares Figuren wissen also selbst Dinge, von denen seine Sprache eher ablenkt, und seine Sprache weiß umgekehrt Dinge, an denen sich etwa Hamlet, wenn er sie spricht, die Zähne ausbeißt, zum Beispiel über die uferlosen Bestimmungen „Sein“ und „Nichtsein“, deren Unendlichkeit sich aber im Stück am Endlichen bricht, dem konkreten irdischen Werden und Vergehen, in denen, wie man von Hegel weiß, sowohl Sein wie Nichtsein dialektisch aufgehoben sind.

Wo wir von Shakespeares Charakteren reden, sollten wir auch seine Lyrik mitmeinen – weil sie aus Sprache gemacht ist, aber nie Sprache gegen Sache ausspielt, und weil sie von Menschen redet, zu Menschen spricht und schließlich, nicht zuletzt, einen sehr geheimnisvollen Menschen entwirft, den nämlich, dessen Stimme sich da äußert. Dass Shakespeares Menschen in allen seinen Formen mehr Beziehungen zu anderen Menschen in sich vereinigen als alle anderen literarischen Schöpfungen, die wir kennen, hat das englische Bürgertum spätestens im achtzehnten Jahrhundert dazu angeregt, sein Schaffen für die Ideologie des autonomen, freien, jederzeit und überall konkurrenzfähigen bürgerlichen Menschen zu reklamieren, die diesem Bürgertum lieb und teuer war. Das hat seine Stichhaltigkeit: Wo, wenn nicht bei diesem Nationaldichter, findet sich Anschauungsmaterial für die Lehre vom selbstständigen Individuum, das seine Anlagen in Kampf und Kollaboration mit andern entwickeln kann? Die Bourgeoisie des achtzehnten Jahrhunderts, jener Epoche, in welcher der Verstorbene vom Unterhalter, der sowohl den Pöbel wie die Königin erreicht hatte, zum Sänger der „middle class“ und Basiserbauer ihres Kulturstolzes umgerüstet werden sollte, ließ ihn sich von professionellen Deutern entsprechend zurechtlegen und von Theaterpersonal demgemäß aufführen. Einer der wichtigsten Bannerträger dieser Kampagne war ein Mann namens David Garrick, der außer als Schauspieler auch als etwas wirkte, das wir „Kulturmanager“ nennen würden – ein Organisator und Anreger

des Bühnenlebens, der fürs bürgerliche ästhetische Bewusstsein im England des achtzehnten Jahrhunderts eine ähnliche Rolle spielte wie Brecht für das sozialistische in der DDR. Jene Klasse, die ihn anfeuerte und zu ihm aufsah, repräsentierte Garrick auch biographisch; die Familie, aus der er stammte, war im Weinhandel tätig. Geschäftssinn als schlechthin bürgerliche Ausprägung des Wirklichkeitssinns führte ihn als Schauspieler zur durchaus fortschrittlichen Vorwegnahme eines Stils, der in der geschriebenen Weltdramatik erst deutlich später Gestalt annehmen sollte, des Naturalismus. Garrick brachte den Gestalten, die Shakespeare ihm hinterlassen hatte, allerlei aus der alltäglichen Menschenbeobachtung besorgte Direktheiten bei, die sie freier atmen ließen. Dafür bekam er Vorwürfe zu hören wie den, sein Lear sei kein König, sondern ein „verrückter Schneider“. Berechtigt war an diesem Angriff, dass der neue Stil ältere, strenger formalisierte, an höfisches Zeremoniell angelehnte Kunstfertigkeiten preisgab, aber die neue Beweglichkeit war eben auch ein Gewinn, weil sich so zeigen ließ, dass mehr in den Figuren steckte, als man bisher hatte erkennen können. Garrick ließ sich von der Kritik nicht beirren, räumte aber, weil er kein Dummkopf war, sogar ein, dass sein naturalisierender Ansatz nicht allen Gestalten gerecht wurde, mit denen Shakespeare ihn konfrontierte.
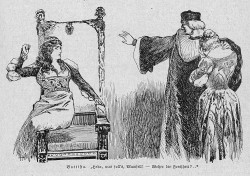
Bis heute gibt uns Shakespeare das Rätsel auf, wie es wohl möglich ist, dass seine Gestalten grundverschiedene historische Etappen nicht nur unbeschadet glaubhaft überleben, sondern immer wieder neue Seiten an sich offenbaren, obwohl sie doch im Augenblick ihrer Konzeption durch den Künstler diesem vollkommen gegenwärtig gewesen sein müssen, also seiner Gegenwartsgesellschaft und deren Erlebnishorizonten gemäß waren, weshalb sie dem zeitgenössischen Publikum, wie uns die Überlieferung versichert, nicht minder einleuchteten als Zuschauern, die heute, viel später, in den Genuss der theaterhandwerklichen Früchte jahrhundertelanger praktischer wie theoretischer Beschäftigung mit diesen Figuren kommen.
Die Verblüffung, die uns Heutigen der Tatbestand abnötigt, dass Shakespeares Figurenporträt-Farbenpalette unaufhörlich neue sozialpsychologische Schattierungen zeigt, erreicht ihr Höchstmaß, wenn wir uns darüber Rechenschaft abzulegen suchen, wie es wohl angeht, dass die Shakespearewelt selbst im riskanten Fall der der Umbettung ihrer sprachlichen und szenischen Muttererde in ein zur Zeit des Dichters noch gar nicht erfundenes Medium unbeschadet blüht und gedeiht, nämlich im Kino. Dieses Medium lebt bekanntlich davon, uns die Möglichkeit von Gegenwartsmenschen, wie wir selbst sind, in sämtlichen überhaupt nur vorstellbaren Erzählräumen zu suggerieren. Selbst auf fremden Gestirnen, in ferner Vergangenheit oder entlegener Zukunft zeigt es lauter Leute, in denen wir uns wiederfinden können, die also zu lieben versuchen wie wir, Gesellschaften zwischen Konformitätsdruck und Zerfall des sozialen Zusammenhangs ertragen müssen wie wir und dabei Ängste und Hoffnungen erleben, die den unsrigen hinreichend gleichen, dass wir mit ihnen bangen, ihr Scheitern betrauern und und bei glücklichen Wendungen ihres Geschicks mit ihnen freuen.

Wie aber konnte Shakespeare wissen, wie man Menschen erfindet, die sich genau dafür eignen? Wie konnte er wissen, dass zum Beispiel in seinem Magier Prospero eine reife Frau steckt, deren „Magie“ ein Codewort für das Ensemble von Fähigkeiten ist, das man erfolgreichen weiblichen Führungskräften zuschreibt, nämlich das Ineinander von Multitasking, strategisch genutztem Einfühlungsvermögen und verwandten Attributen der von unserer Lebenshilfe-Industrie angepriesenen sogenannten „emotionalen Intelligenz“? Nein, es ist unmöglich, dass er sich über eine solche Auslegung dieser Rolle derartige Gedanken gemacht hat – und trotzdem zeigt die große Helen Mirren in Julie Taymors Filmfassung des „Sturm“-Stücks von 2010, dass diese Auslegung funktioniert und dem filmischen Erzählen Aspekte des Textes erschließt, die der Shakespearetradition andernfalls verschlossen geblieben wären. Wer erklärt das? Und wie kann Shakespeare vorausgewusst haben, dass es einmal emanzipierte Frauen geben würde, die im Zwiespalt leben müssen zwischen ihrer rechtlichen Gleichstellung einerseits und der bitteren Wahrheit, dass von Chancengleichheit im Kapitalismus, je länger er vor sich hin rattert wie die gigantische Höllenmaschine, die er ist, nicht die Rede sein kann? Wie kann er gewusst haben, dass das Geschlechterverhältnis beim besten Willen kein freies, spielerisches werden kann, solange Machtverhältnisse, die tiefer im Sozialen verankert sind als ein paar oberflächliche Sonntagsemanzipationsbestimmungen reichen, jede Differenz nicht nur zwischen Männern und Frauen, sondern zwischen Menschen überhaupt für ihre schlechte Verewigung nutzen? Wie kann er gewusst haben, dass eine kluge, selbstbewusste Frau unter diesen Bedingungen nur als Spielerin und zwischen spröder Abweisung und kalkuliertem Angriff aufs Gegebene überleben kann, das heißt so, wie Amy Acker Shakespeares unsterbliche Beatrice in Joss Whedons sprachlich unveränderter, aber nach Schauplätzen und Manieren konsequent aktualisierter Kinofassung von „Viel Lärmen um Nichts“ aus dem Jahr 2012 interpretiert? Und warum kann der Lokalfürst, der den Römern bei Shakespeare Tribut zahlen soll, ohne Textvergewaltigung auch ein Rockerboss sein, der die Polizei besticht, wie in Michael Almereydas „Cymbeline“-Film von 2014, der zwar Schwächen hat, aber doch vorführt, wie Shakespeares Worte seine Schauspielriege von Ed Harris bis Ethan Hawke auch nicht eine Silbe lang im Stich lassen, obwohl sie in denkbar feindseligster, in heutiger, also vor allem: in schlechter Gesellschaft ihre Wunder tun müssen? Woher schließlich kommt es, dass der Irrsinn des Totschlägers und Frondeurs Macbeth einem Fondsmanager überzeugend zu Gesicht steht, der nicht zu wissen scheint, ob er ein staatsverräterischer Adliger ist oder ein geldgieriger Finanzpirat, der in sein Smartphone-Headset spuckt, während er die Zerstörung von Werten kommandiert, die er nur noch verbrennen, nicht mehr aneignen kann? Den Eindruck, dass das so ist, empfängt man, allen ihn umgebenden archaisierenden Kostümen und Produktionsschauwerten zum Trotz, bei Michael Fassbenders Verkörperung dieses Ungeheuers in Justin Kurzels Macbeth-Film von 2015, einer Kinoproduktion, an der wie an Almereydas „Cymbeline“ manches schief geraten ist, aber eben nicht Fassbenders grandiose Leistung, der die Verse heilig sind, die er aufsagen darf?

Man kann den Effekt dieser wandelbaren Langzweitwirkung von der elisabethanischen Bühne bis ins katastrophenkapitalistische Multiplexfilmtheater durchaus erklären, ohne Shakespeare zum Hellseher zu verfälschen: Der Mann gebot einfach (aber was heißt „einfach“: wie selten ist dieses Einfache!) über eine außerordentlich empfängliche Beobachtungsgabe für Menschliches, gekoppelt mit einem allesdurchdringenden, illusionslosen analytischen Verstand, der ihm gestattete, das sozialpsychologische Erbgut der seinerzeit eben erst möglich gewordenen Menschensorte „Bürgerin und Bürger“, die Mutation des Subjekts, das sich vom feudalen zum kapitalistischen mauserte, so strukturtreu in seine Einzelmomente zu zerlegen, dass er sich das kommende Kräftespiel dieser Momente spekulativ als differenzierte Gesamtheit zahlloser kombinatorischer Möglichkeiten ausmalen konnte. Er sah bereits die schrägen Vögel, die aus den ihn umgebenden brandneuen Sauriern einmal werden mussten. In dieser Eigenheit übertrifft Shakespeare fast alle abendländischen Kunstschaffenden, von denen wir sonst wissen, auch wenn einzelne Genies über zumindest ähnliche, wenn schon nicht vergleichbar ausgeprägte Begabungen verfügten (man lese etwa den zweiten Teil von Goethes „Faust“, der sich, was Vorausschau angeht, wirklich nicht lumpen lässt).
Shakespeare sah, dass die bürgerliche Seele zwar die ständisch vorbestimmten Ränge überwinden und dem Individuum neue funktionale Aufgaben im Gemeinwesen zuweisen konnte, aber er sah zugleich, dass die bestimmenden Leidenschaften dieser bürgerlichen Seele, vom Glücksstreben bis zum Wettbewerbsverlangen, außer neu angezapften Produktivkräften entsetzliche Vernichtungspotentiale bargen. Er wusste, dass das, was diese neue Gesellschaftsformation zusammenhielt, auch ungeheure asoziale Potenziale mit sich führte, die jede kollektive, etwa solidarische Kohäsion zerfressen können, welche Menschen aneinander zu binden vermag. Er wusste, dass Charaktere, die sich solchen Leidenschaften aussetzen oder gar unterwerfen, am Ende womöglich an ihrer Kraft zugrunde gehen, „consumed with that which it was nourish‘d by“, wie es das dreiundsiebzigste Sonett sagt – in einer Welt, in der die vermeintlich freie individuelle Seele entsetzt und hilflos erkennen muss, dass „einst’ge Nahrung ihr den Tod bereitet“, wie es in der Nachdichtung von Karl Kraus heißt.



![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)





