Seit die USA kein Geld mehr für die Ukraine überweisen, ist die EU zum hauptsächlichen Geldgeber und Waffensteller geworden. Waffen, Munition und Personal werden knapp – und die Finanzierung des Krieges macht zunehmend Probleme.
Wer soll das bezahlen?
Seit Beginn des Krieges vor gut zwei Jahren hat die Ukraine Mittel in Höhe von 88 Milliarden Euro von der EU und ihren Mitgliedstaaten bekommen. Darüber hinaus erhielt das Land weitere Milliarden aus den USA und anderen Staaten des politischen Westens, sodass die Gesamtsumme der Zahlungen und Waffenlieferungen mittlerweile in die Hunderte von Milliarden geht. Dennoch reichen diese nicht aus, um Russland standzuhalten, geschweige denn, um den Krieg zu gewinnen. Seit die USA kein Geld mehr schicken, ist dieses Ziel in noch weitere Ferne gerückt.
Nun versucht die EU, diesen Ausfall wett zu machen, indem sie neue Mittel für die Ukraine in Höhe von 50 Milliarden Euro bereit stellt. Daraus sollen bis 2027 zusätzlich rund 38 Milliarden Euro an direkter Budgethilfe fließen, weitere sieben Milliarden Euro für Investitionen und fünf Milliarden Euro für Reformen in der öffentlichen Verwaltung. Zwei Drittel der Gesamtsumme sind zinsgünstige Kredite, der Rest Zuschüsse.
Der Krieg wird also immer europäischer. Diese Unterstützung verschlingt Unsummen. Darüber hinaus sollen die Rüstungsausgaben im Rahmen der NATO und der europäischen Staaten erhöht werden, denn man glaubt, auf einen umfassenden Krieg der NATO mit Russland vorbereitet sein zu müssen. Man sieht sich in einem „existenziellen Konflikt“. Der französische Präsident Macron scheint wohl die vorherrschende Meinung im Bündnis auszudrücken, wenn er unwidersprochen behauptet, „Putin werde im Falle eines Sieges in der Ukraine nicht aufhören (…) er, der nie seine Verpflichtungen eingehalten hat“.
Aber woher sollen die Milliarden kommen, die man für all diese Aufgaben brauchen wird? Die USA können sich nahezu unbegrenzt verschulden, solange Gesetzgeber und Investoren an den Finanzmärkten mitspielen. Für die Europäer der EU ist das schwieriger. Ihnen sind durch das Maastricht-Abkommen Grenzen in der Verschuldung gesetzt. Es gibt für die Defizite der Einzelstaaten einen Rahmen vor. Zwar werden dabei auch immer Ausnahmen gewährt, aber insgesamt wird darauf geachtet, dass sich nicht einzelne Länder auf Kosten der anderen zu sehr verschulden und damit zum Schaden für die innere Stabilität des Staatenbundes.
Am 21. März trafen sich die Staats- und Regierungschefs deshalb in Brüssel zu Beratungen über die Aufrüstung. „Innovative Quellen sollten erkundet werden, um die Verteidigungsausgaben zu erhöhen“, hieß es in der FAZ. Da die Zeit drängt, wurde den zuständigen Einrichtungen der EU der Auftrag erteilt, bis Juni „alle Optionen zu erkunden, um Finanzmittel aufzubringen“. Weil besonders die deutsche Öffentlichkeit darauf bisher immer ablehnend reagiert hatte, vermied man ausdrücklich den Hinweis, dass es um nichts anderes geht als „gemeinsame Schulden“ für die Aufrüstung.
Woher nehmen …?
Die finanzielle Lage der meisten europäischen Staaten ist nicht gerade rosig, denn der politische Westen hat sich mit seinen Sanktionen gegen Russland selbst ins Knie geschossen. Die Energiekosten explodieren, wie auch die Preise vieler Grundstoffe für die europäische Industrie, die beispielsweise die Chemieunternehmen noch vor Jahren günstig aus Russland beziehen konnten. Eine Folge dieser Verknappung ist der gewaltige Preisanstieg besonders bei Energieträgern und Lebensmitteln.
In dieser Lage hatte die EZB nichts Besseres zu tun, als zusätzlich auch noch die Zinsen anzuheben und damit die wirtschaftliche Lage noch weiter zu verschärfen. Denn die reine Lehre der Inflationstheorien besagt, dass steigende Preise Inflation sind, und diese bekämpft man mit höheren Zinsen. Das ist die modernisierte Theorie des Aderlasses, übertragen auf die Wirtschaft. Man zapft dem durch Krankheit bereits geschwächten Patienten das Blut ab und wundert sich dann, dass sich sein Zustand verschlechtert.
Die EZB in ihrem wirklichkeitsfernen Elfenbeinturm erkennt nicht, dass die gestiegenen Preise nicht die Folge ausufernder Nachfrage sind, der Lehrbucherklärung für Inflation, sondern Ergebnis einer durch die Sanktionen verursachten Verknappung. Anstatt die Politik zu ermahnen, die ruinösen Sanktionen aufzuheben, erhöht sie die Zinsen nach den Buchstaben der Inflationstheorien. Die Folge ist ein Rückgang der Wirtschaftstätigkeit, nachlassende Umsätze, zunehmende Insolvenzen. Die Bürger schränken ihren Konsum ein, weil sie sich vieles nicht mehr leisten können.
Ein Teufelskreis wird dadurch in Gang gesetzt: Viele Unternehmen fahren die Produktion runter oder verlagern sie teilweise, manchmal sogar ganz ins Ausland, weil dort besonders die Energiekosten niedriger sind. Das hat Auswirkungen auf die Staatsfinanzen, denn die Steuereinnahmen sinken. So hatte Deutschland schon Ende letzten Jahres auf die Finanzlage regieren müssen, indem es, erst recht nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, Förderprogramme zusammenstrich und Einsparungen im Haushalt vornahm.
Mit seinen Haushaltsproblemen steht Deutschland in der EU aber nicht alleine da. Auch um die französischen Staatsfinanzen ist es schlechter bestellt als gedacht. Das schwächere wirtschaftliche Umfeld etwa in Deutschland und China laste schwer auf den Steuereinnahmen, sodass „das Defizit 2023 signifikant oberhalb der geplanten 4,9 Prozent gelegen habe“ (FAZ). Die Neuverschuldung betrug für 2023 etwa 5,5 Prozent, „schmerzhafte Etatkürzungen werden dadurch unausweichlich“. So wie den Franzosen geht es vielen Staaten in der EU, wobei Frankreich mit mehr als drei Billionen Euro am höchsten verschuldet ist.
… wenn nicht stehlen?
Warum eigentlich nicht? Da sind doch die üppigen Gelder der russischen Zentralbank, etwa 200 Milliarden Euro, die bei der SWIFT-Zentrale in Brüssel eingefroren sind. Die werfen jedes Jahr etwa 3 Milliarden Euro Zinsen ab. Die Guthaben der Russen zu enteignen traut man sich noch nicht, aber die Zinsen glaubt man nach eigenem Rechtsverständnis für sich und die Ukraine vereinnahmen zu können. Neunzig Prozent dieser 3 Milliarden Euro Zinsen sind vorgesehen für Waffenkäufe zugunsten der Ukraine.
Das ist aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein angesichts umfangreicher Pläne zur Aufrüstung in den EU-Staaten. Die Rede ist von 100 Milliarden Euro. Diese Summe war erstmals von der estnischen Ministerpräsidentin Kaja Kallas ins Gespräch gebracht worden. Sie hatte im Dezember letzten Jahres gemeinsame Verteidigungsanleihen vorgeschlagen, die von der EU ausgegeben werden sollen. Dieselbe Summe hatte dann EU-Kommissar Thierry Breton zu Beginn des Jahres für die Schaffung eines „Verteidigungsfonds“ gefordert.
Zwar haben die europäischen Staaten ihre Verteidigungsausgaben schon seit 2014 erhöht, aber mit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine stiegen diese noch einmal um 20 Prozent von 220 Milliarden im Jahr 2022 auf 290 Milliarden Euro im vorigen Jahr. Doch entspricht dieser Betrag „nur“ 1,5 Prozent der Wirtschaftsleistung aller EU-Staaten. Sollen die anvisierten 2 Prozent erreicht werden, müssen noch einmal 100 Milliarden Euro jährlich locker gemacht werden. Kein Wunder also, dass man da nach „innovativen Quellen“ Ausschau halten muss angesichts der großen Vorhaben und der angespannten Haushaltslage in den europäischen Staaten.
Beim Geld hört die Freundschaft auf
Die Uneinigkeit unter den europäischen Staaten über die Finanzierung der Aufrüstung ist groß. Man ist sich nicht nur uneins, wie diese Aufrüstung finanziert werden soll, sondern auch, ob sie überhaupt im Einklang steht mit den Europäischen Verträgen und ihren Grundsätzen. Klar ist, dass die Rüstungsindustrie dafür „besseren Zugang zu öffentlicher und privater Finanzierung haben muss“ (FAZ), das heißt: mehr Geldquellen.
Zur Umsetzung der Finanzierung stehen zwei Ansätze zur Diskussion. Einer davon ist die Ausgabe von EU-Anleihen, die durch die Einzelstaaten besichert werden müssen. Diese Lösung wird besonders von Frankreich gefordert, von Deutschland hingegen strikt abgelehnt mit dem Hinweis, die EU sei kein Bundesstaat, in dem die Schulden des einen von anderer Seite ausgeglichen würden. Angesichts der enormen Verschuldung Frankreichs wäre das ein hohes Risiko.
Eine andere Überlegung ist die Einschaltung der Europäischen Investitionsbank (EIB). Die ist aber nicht unproblematisch. Bisher besteht der Förderungsauftrag der Bank nur im Bereich ziviler oder Dual-use-Projekte, also solchen, die sowohl zivilen als auch militärischen Charakter haben. Die Erhöhung der Rüstungsausgaben ist aber ein eindeutig militärisches Vorhaben ohne zivile Komponente. Das ist nicht allein Willenssache, sondern hat auch praktische Hintergründe.
Die Kapitalgeber der EIB als Hausbank der EU sind die Einzelstaaten. Sie legen die Richtlinien der Verleihpraxis der Bank fest, die bisher ausgerichtet war auf die ausgewogene Entwicklung des EU-Binnenmarktes. Das aber trifft auf die Aufrüstung der EU nicht zu. Zudem sind Österreich, Malta, Irland und Zypern keine NATO-Mitglieder, sodass das 2-Prozent-Gebot der NATO für sie nicht maßgeblich ist, sie das dann aber mitfinanzieren müssten.
Selbst für manche NATO-Staaten der EU liegen die Schwerpunkte anders. Die Länder des europäischen Südens befürchten eine Verlagerung der Finanzierung zu ihrem Nachteil von der Förderung von Klimaprojekten hin zur Stärkung von Rüstungsausgaben. Denn manchen Ländern macht der „Klimawandel mehr Sorgen als der Krieg in der Ukraine“ (FAZ), wie es ein spanischer Vertreter unumwunden ausdrückte.
Selbst wenn sich die EU-Staaten auf eine Regelung einigen könnten, wie die Aufrüstung mit den Vorschriften der EIB in Einklang zu bringen wäre, wäre damit immer noch die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Der Wirt sind die Investoren an den Finanzmärkten. Bisher genießt die EIB dort ein Top-Rating, was ihr Geld der Anleger zu günstigen Konditionen verschafft. Das könnte aber gefährdet sein, wenn die EIB nun Waffenproduktion finanziert. Denn „wer Krieg finanziert, steigert das Risiko“.
In vielen Investment-Produkten institutioneller Anleger sind Ausgaben für Waffenproduktion ausgeschlossen. Diese Fonds dürften dann nicht mehr bei der EIB investieren, womit ein beträchtlicher Kundenstamm ausfallen würde. Oder aber die Staaten der EIB als Eigentümer müssten ihre Einlagen bei der Bank erhöhen. Das jedoch dürfte angesichts der ohnehin schon knappen Kassen schwierig umzusetzen sein.
Nun träumen viele vom Rückgriff auf die eingefrorenen russischen Vermögen. Doch davor warnt besonders die EZB. Man würde die Büchse der Pandora öffnen und Präzedenzfälle schaffen, die auf die EU selbst zurückfallen könnten. Denn gerade die Sicherheit von Anlagen in der EU machen deren Beliebtheit bei ausländischen Investoren aus. Zudem haben auch EU-Staaten Geld im Ausland angelegt, das eingefroren werden könnte. Hinzu kommen andere europäische Vermögenswerte wie die überall in der Welt getätigten Investitionen in Produktionsanlagen, die nicht so einfach nach Hause geholt werden können.

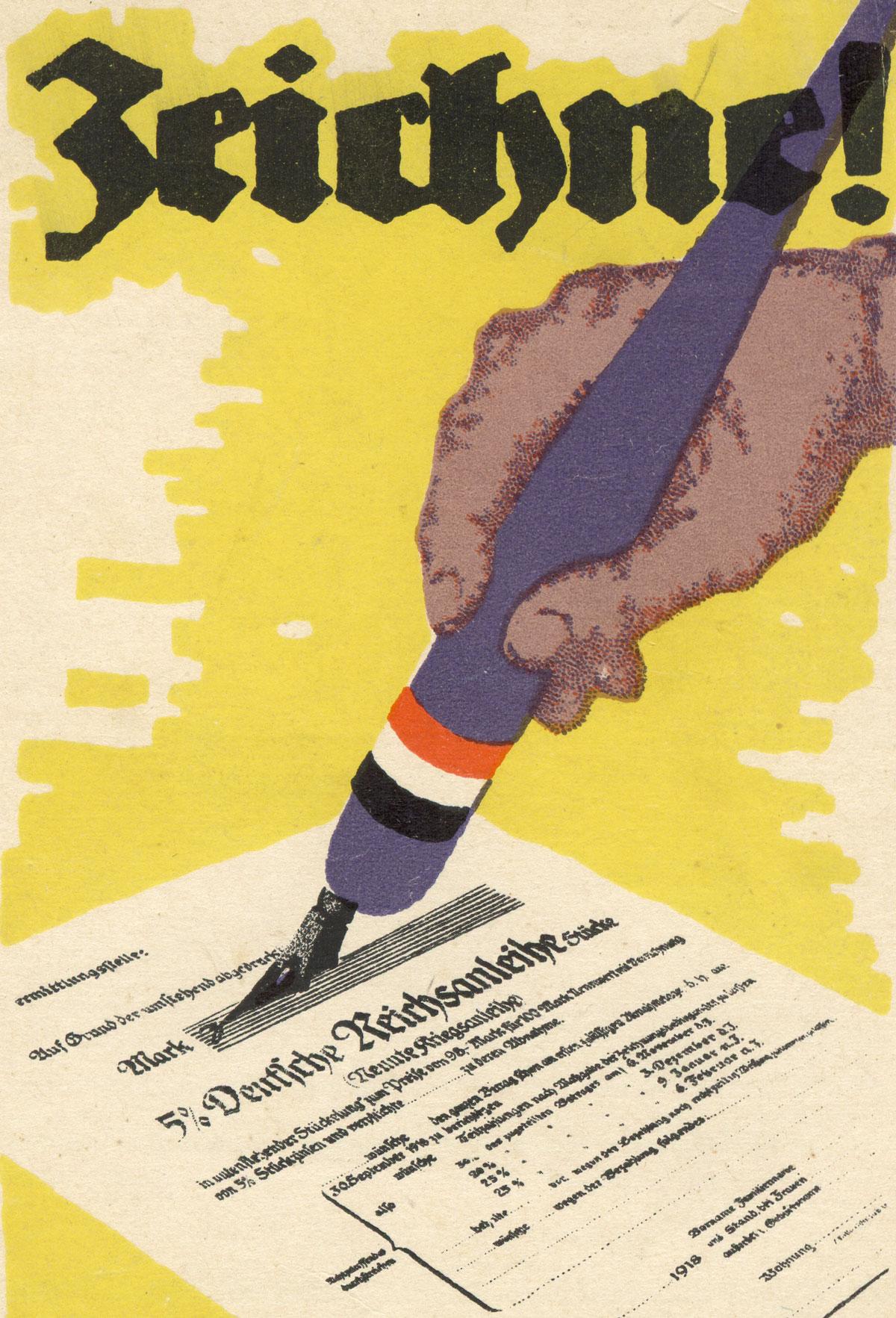

![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)





