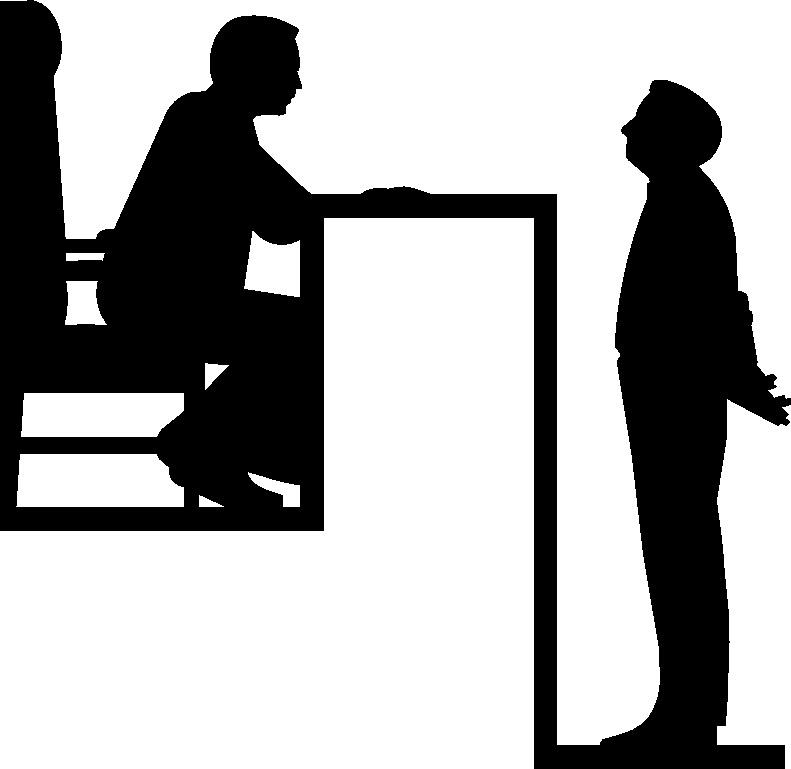Berufsverbote sollten abschrecken. Wer im öffentlichen Dienst fortschrittliche Positionen vertrat, musste ab 1972 um seine Arbeitsstelle fürchten. Dafür wurden 3,5 Millionen Menschen „durchleuchtet“, 11.000 offizielle Berufsverbotsverfahren gab es. 22.000 Disziplinarverfahren wurden durchgeführt mit 1.250 Ablehnungen und 265 Entlassungen. Auch Lothar Letsche aus Baden-Württemberg war vom Berufsverbot betroffen und kämpft bis heute für die Rehabilitierung der Opfer. Er betreibt „berufsverbote.de“ und arbeitet in der landesweiten und bundesweiten Betroffenen-Initiative mit. Eine Kurzfassung erschien in der Printausgabe.
UZ: Du engagierst dich für die Rehabilitierung und Entschädigung von Berufsverbotsbetroffenen aus Westdeutschland. Was genau hatte es damit auf sich?

Lothar Letsche: 1968, als ich 22 war, konstituierten sich die SDAJ und die DKP, 1969 der Vorläufer des Marxistischen Studentenbunds Spartakus. Nach heutigen Maßstäben waren das – auch unter jungen Menschen – relativ erfolgreich agierende antikapitalistische Organisationen, solidarisch mit den damaligen sozialistischen Ländern und insbesondere der DDR. Denen gegenüber versuchten die Herrschenden der alten Bundesrepublik damals ihre „neue Ostpolitik“ in Gang zu bringen. Es hätte diese Politik unglaubwürdig gemacht, im eigenen Land unter Berufung auf das KPD-Verbot von 1956 die entsprechenden Leute einzusperren – so wie das noch bis 1966 in Stuttgart passiert ist. Das war nach 1968 nicht mehr durchsetzbar. Die DKP war eine legale Partei. Da knüpfte man lieber an das an, was schon ab 1950 gemacht wurde, um in der Bundesrepublik für frühere Nazis den Weg in die Mitte der Gesellschaft frei zu machen: man schmiss die Kommunisten, Linken und Antifaschisten aus dem öffentlichen Dienst raus beziehungsweise ließ sie gar nicht rein.
Das betraf dann: Lehrerinnen und Lehrer, Hochschulen von Hilfskräften bis zu Professorinnen und Professoren, Personal von Krankenhäusern, Behörden aller Art, Justiz, Polizei, Zoll, Arbeitsämtern. Aber auch solche Bereiche, wo sich der Staat inzwischen längst zurückgezogen hat: Post, Telekom, Eisenbahn – also Berufe wie Briefträger, Telefontechniker, Lokführer … Alle Bewerbungen und auch die Daten von bereits Beschäftigten, die politisch irgendwie auffielen, wurden an die sogenannten Verfassungsschutzämter geschickt, dort mit den Akten und Datenbeständen abgeglichen. Dann wurden sogenannte „Erkenntnisse“ mitgeteilt, die auf systematischer Bespitzelung beruhten. Es fanden „Anhörungen“ statt .Angeblich sollte es um die „freiheitlich-demokratische Grundordnung“ gehen. Gemeint war aber nicht der wirkliche Inhalt des Grundgesetzes, sondern das Feindbild des sogenannten „Verfassungsschutzes“. Und dann war den Leuten ihr Beruf verbaut oder sie flogen raus, wenn sie nicht zu Kreuze krochen oder sich mühsam durch die Gerichtsinstanzen den Arbeitsplatz oder die Ausbildung einklagen konnten. Von Chancengleichheit für die DKP konnte natürlich auch keine Rede sein, wenn ihre Kandidatinnen und Kandidaten, sofern sie in den öffentlichen Dienst wollten oder dort arbeiteten, ein solches Berufsverbot erwartete.
UZ: Aber das betraf doch nicht nur die DKP?
Lothar Letsche: Natürlich nicht. Antikommunismus richtet sich immer gegen alles Linke und Fortschrittliche. Es sollte mit der ganzen Jugendrevolte aufgeräumt werden, als die „1968“ empfunden wurde, mit allem, was sich als revolutionär und antikapitalistisch verstand, mit organisierten und unorganisierten Linken jeder Art, mit den Anhängern Rudi Dutschkes, dessen „Marsch durch die Institutionen“ dauernd zitiert wurde, mit den maoistisch ausgerichteten „K-Gruppen“ und den Trotzkisten, und in Bayern mit linken Sozialdemokraten und Friedensfreunden gleich mit.
Für die Gewerkschaften ging es da ans Eingemachte – die Bedingungen für Arbeitsverhältnisse. Zum einen die Rolle der deutschen Beamten, die als „Staatsdiener“ unabhängig davon, was sie wirklich tun, keinen Kollektivvereinbarungen unterliegen und kein Streikrecht, dafür aber besondere „Treuepflichten“ haben sollen. Zum anderen gehört das Diskriminierungsverbot zu den Kernarbeitsnormen, wie sie im Übereinkommen 111 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) definiert sind. (Die ILO wurde 1919 als Organisation des Völkerbunds gegründet, ist heute eine Unterorganisation der UNO.) Das ILO-Übereinkommen mit Diskriminierungsverbot galt in der Bundesrepublik ab 1961 – ganz abgesehen vom Grundgesetz, das schon ab 1949, als Lehre aus dem Faschismus, im Artikel 3 jede politische Diskriminierung verbot.
UZ: Und hatte das keine Folgen?
Lothar Letsche: Doch. Spät. Die Bundesrepublik Deutschland wurde 1987 von einem Untersuchungsausschuss der ILO in aller Form für ihre Berufsverbotspraxis abgemahnt. Danach sind die „Regelanfragen“ beim „Verfassungsschutz“ tatsächlich heruntergefahren worden. Aber darüber wird heute kaum gesprochen – nicht einmal, als letztes Jahr 100 Jahre ILO groß gefeiert wurden.
Bekannter ist das 1995 ergangene Urteil des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Die Entlassung einer der DKP angehörenden Lehrerin wurde als Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention gewertet. Sie bekam eine Entschädigung. Diese Entscheidung erging 10 zu 9. Sie war nur möglich, weil im August 1990 – mitten in der Diskussion um die „deutsche Einheit“ – das Bundesverfassungsgericht die Klage nicht angenommen hatte. Das war in dem Fall ein Glück. Viele Betroffene – auch ich – hatten immer befürchtet, dass dieses Gericht die Klage eines DKP-Mitglieds dafür nutzen würde, sich irgendeine Art von „Parteiverbot light“ auszudenken.
Natürlich muss man die juristischen Auseinandersetzungen um die Berufsverbote so differenziert darstellen, wie sie waren. Manche Prozesse haben wir ja gewonnen. Aber insgesamt ist es schon so, wie der Hamburger Rechtsanwalt Klaus Dammann (1946-2020) schrieb: Die bundesdeutsche Justiz hat kläglich versagt.
UZ: Wie viele waren denn insgesamt betroffen?
Lothar Letsche: 3,5 Millionen Menschen wurden „durchleuchtet“, 11.000 offizielle Berufsverbotsverfahren, 2.2000 Disziplinarverfahren, 1.250 Ablehnungen, 265 Entlassungen. Das sind die Zahlen der Faltpostkarte der GEW, wo ich Ministerpräsident Kretschmann die Maus überreiche. Es gibt auch andere Berechnungen. Aber die Größenordnung dürfte hin kommen.
UZ: Was ist dir persönlich passiert?
Lothar Letsche: Was „Freiheit im Beruf, Demokratie im Betrieb“ heißt, habe ich persönlich erfahren. Ich durfte nie Lehrer werden, nie meine Lehrerausbildung abschließen. Als es angeblich „nur noch um Beamte“ gehen sollte, 1981, wurde versucht, mich als Angestellten aus einer privatrechtlichen Stiftung zu entlassen, wo der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes galt. 22 Jahre später gab es noch einen Nachklapp zur Maßregelung als engagierter Betriebsrat. Ich hatte Glück, die Arbeitsgerichte gaben mir recht, ich blieb bis zur Rente in Lohn und Brot.
Was mich geprägt hat, sind Erfahrungen der Solidarität, aus der Gewerkschaft und auch sonst im In- und Ausland. Wer Solidarität nicht kennt, versteht nicht die Breite der damaligen Gegenbewegung gegen die Berufsverbote. Sie motiviert heute die früheren Betroffenen zu ihrem gemeinsamen Engagement. Unabhängig davon, welche politischen Wege sie später gegangen sind.
UZ: Warum wurden die Berufsverbote ausgerechnet unter Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) beschlossen, der ja selbst im Widerstand gegen die Nazis aktiv war?
Lothar Letsche: Brandt teilte als Regierender Bürgermeister von Westberlin (1957-1966) den sozialdemokratischen Antikommunismus, der schon 1971 in Hamburg zu den ersten versuchten Berufsverboten gegen DKP-Mitglieder führte. Unter seiner Leitung als Bundeskanzler fassten am 28. Januar 1972 die Ministerpräsidenten der damaligen Länder in Bonn den sogenannten „Extremistenbeschluss“ oder „Radikalenerlass“. Vielleicht meinte Brandt, im Zuge der Durchsetzung seiner „Ostpolitik“ diese Konzession an die CDU machen zu müssen. Später redete er von einem Irrtum und ließ sogar ein persönliches Archiv über Auswüchse der Berufsverbotspraxis anlegen. Sozialdemokratische Landesregierungen fuhren diese Praxis ab Ende der 1970er Jahre teilweise herunter. Aber einige ganz besonders schlimme Entlassungen gab es noch 1981 in Verantwortung des damaligen SPD-Bundespostministers Kurt Gscheidle, ehemaliger stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Postgewerkschaft, Anwärter für den DGB-Vorsitz. Der Fernmeldesekretär Hans Peter aus Stuttgart wurde wegen DKP-Mitgliedschaft nach 30 untadeligen Dienstjahren ohne Pension und Arbeitslosengeld auf die Straße geworfen und starb 1990 als völlig gebrochener Mann.
UZ: Stellt sich die SPD ihrer historischen Schuld in dieser Frage und der damit verbundenen Verantwortung?
Lothar Letsche: Teilweise. In Bremen (2011), Niedersachsen (2016) und Hamburg (2018) gab es Landtagsbeschlüsse entsprechender Koalitionsmehrheiten. In Niedersachsen wurden auch Einzelschicksale von der „Landesbeauftragten“ Jutta Rübke aufgearbeitet, es ist sehr lesenswert. In Baden-Württemberg gelang so etwas in der „grün-roten“ Regierungszeit (2011-2016) nicht, obwohl die dortige Landes-SPD sich ab 1973 immer klar gegen den „Extremistenbeschluss“ positioniert hat. Widerstand gegen die Berufsverbotspolitik gab es damals überall in der SPD.
UZ: Auch in den Gewerkschaften herrschte vielerorts ein antikommunistisch motivierter Verfolgungsfuror. Wie erklärst du dir das in der Rückschau?
Lothar Letsche: So würde ich es nicht nennen. Es waren eben sozialdemokratisch dominierte Gewerkschaften. Teilweise wurde klar Position gegen die Berufsverbote bezogen, Rechtsschutz gewährt, Solidarität geübt. Andererseits gab es auch krasse Formen des Gegenteils – „Verständnis“, Unvereinbarkeitsbeschlüsse, Gewerkschaftsausschlüsse vor allem gegenüber „K-Gruppen“. Damit haben sich GEW und ver.di selbstkritisch auseinander gesetzt. DKP-Mitglieder waren zeitweise auch im Visier, aber das war im DGB nicht mehrheitsfähig. Heute gibt es klare Beschlusslagen im DGB, bei GEW, ver.di und IG Metall, die Berufsverbote abzulehnen und die Betroffenen zu unterstützen.
UZ: Siehst du Chancen, dass das Unrecht wieder gut gemacht wird?
Lothar Letsche: Drei Landtage haben gezeigt, was geht. Aber Entschuldigungen und „Rehabilitierungen“ – die ja eigentlich nichts kosten – machen die durch die Berufsverbote zerstörten Karrieren, Lebensentwürfe und Familien nicht mehr heil. Der politische Flurschaden – vor allem die Einschüchterung, die Schere im Kopf kritisch denkender Menschen – war ja das gewollte Ergebnis.
UZ: Wäre nicht auch eine finanzielle Entschädigung angesagt?
Lothar Letsche: Ja, unbedingt. Davor schreckt die Politik am meisten zurück. Der DGB Niedersachsen hat eine staatliche „Fondslösung“ vorgeschlagen. Aber nicht einmal so etwas wird angegangen. Als kleiner Tropfen auf dem heißen Stein werden einige Betroffene, die wegen Berufsverbot in Altersarmut leben müssen, von einem winzigen Fonds unterstützt, für den andere Betroffene das Geld spenden.
UZ: Die Berufsverbote scheinen in Vergessenheit geraten zu sein. Sind sie wirklich Geschichte?
Lothar Letsche: Das Problem war und ist das Treiben des Inlandsgeheimdiensts. Sein Feindbild ist der Antifaschismus und alles, was den Kapitalismus kritisch sieht. Er ist nicht auf dem rechten Auge blind, er ist die rechte Hand. Ab 2003 hat er in Heidelberg drei Jahre die Einstellung eines antifaschistischen Realschullehrers verhindert. Mit ihren undurchschaubaren Möglichkeiten, Machtbefugnissen und Geheimarchiven, bei rechten Terroranschlägen immer am Ort des Geschehens und nichts Sehens, sind diese Geheimdienststrukturen nach meiner Meinung gefährlicher als rechte Parteien, die kommen, gehen und sich auch mal selber zerlegen.
Was die Rechtslage betrifft: Das Diskriminierungsverbot steht seit 2006 im „Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz“, mit dem eine EU-Richtlinie umgesetzt wurde. Schwule Männer wurden bis 1969 strafrechtlich verfolgt, heute ist Diskriminierung wegen der sexuellen Orientierung unzulässig. Was damals „Recht“ war, ist heute definitiv Unrecht. So ist das im Prinzip auch bei der politischen Diskriminierung im Arbeitsleben. Bei Verstößen könnten Betroffene theoretisch vor den EU-Gerichtshof in Luxemburg ziehen. Aber wer macht das, wenn der Freistaat Bayern ganz systematisch dagegen verstößt? Dort wird Bewerbern ein seitenlanges Formular mit Organisationen vorgelegt: sie mögen sich doch bitte selbst belasten, ob sie je Mitglied waren oder sind. An der Münchner Uni hat das 2016 monatelang die Einstellung eines Doktoranden verzögert – bis die Uni ihn einfach eingestellt hat, ohne sich um den „Verfassungsschutz“ zu kümmern.
UZ: Der „Radikalenerlass“ jährt sich 2022 zum 50. Mal. Was plant Ihr?
Lothar Letsche: Viel Öffentlichkeitsarbeit! Wir hoffen, dass die Ausstellung „Vergessene Geschichte“, die schon bei früheren UZ-Festen gezeigt wurde, 2021 wieder dabei ist. Welche Initiativen und größeren Veranstaltungen wir hin bekommen, wie es mit COVID-19 weiter geht, das muss sich alles erst noch erweisen.



![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)