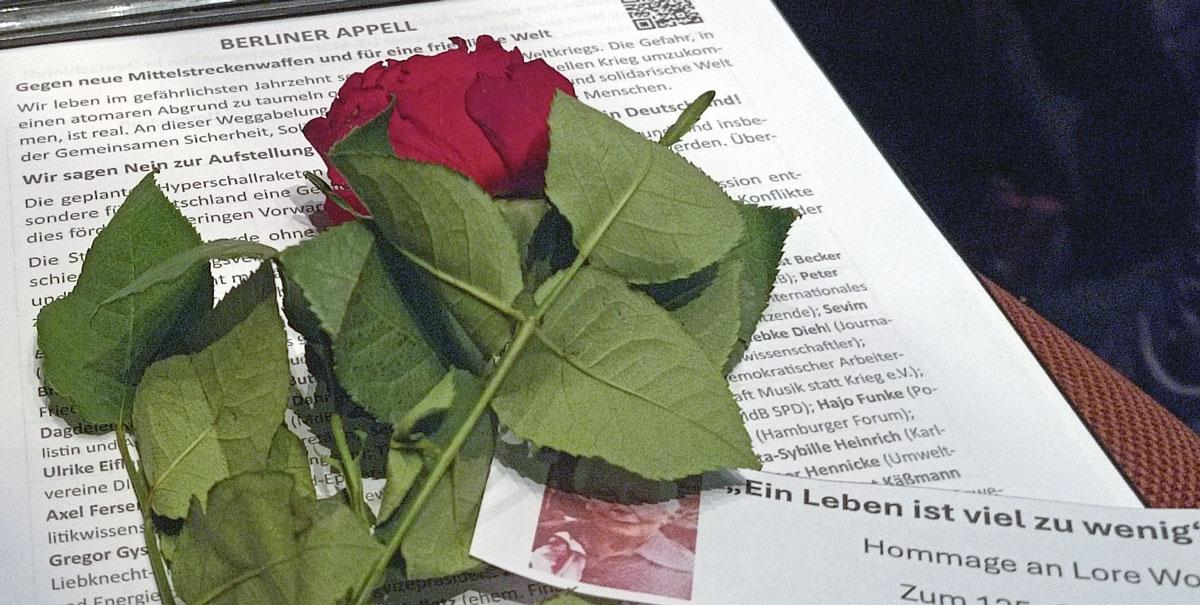Ausschreitungen in mehreren Städten – Morales nach Mexiko ausgeflogen
In Bolivien herrscht ungeschminkter Klassenkampf zwischen der mehrheitlich indigenen Landbevölkerung und der ihre Abstammung auf europäische Kolonialherren und Einwanderer zurückführenden Ober- und „Mittelschicht“. Der gewaltsame Sturz des gewählten Präsidenten Evo Morales am vergangenen Wochenende hat die institutionellen Regeln zerrissen, die – zumindest seit dem Amtsantritt des ersten indigenen Präsidenten des südamerikanischen Landes im Jahr 2006 – den rassistischen Hass der „Weißen“ gegen die „Indios“ eindämmen konnten. Mit dessen von Polizei und Militär erzwungenem Rücktritt am 10. November gilt das nicht mehr – wie auch die ungehinderten Angriffe militanter Rechter auf linke Rundfunk- und Fernsehstationen, Politiker der Regierungspartei MAS und deren Angehörige und auf die Botschaft Venezuelas in La Paz zeigten.
Auslöser des Staatsstreichs war die Wahl vom 20. Oktober, die Morales dem offiziellen Ergebnis zufolge mit 47,08 Prozent der Stimmen gewonnen hat. Da der Zweitplatzierte, der konservative Carlos Mesa, mit 36,51 Prozent mehr als zehn Punkte hinter dem Führenden lag, war Morales damit im ersten Wahlgang gewählt. Die Opposition nutzte jedoch den Umstand, dass der Vorsprung des Amtsinhabers bei Zwischenergebnissen geringer gewesen war, um von Betrug zu sprechen und zu Protesten gegen das Wahlergebnis aufzurufen. Schon damals wiesen die Wahlbehörde TSE und Beobachter allerdings darauf hin, dass zu diesem Zeitpunkt noch mehr als eine Million Stimmen aus den ländlichen Regionen nicht in das Ergebnis eingeflossen waren. Auf dem Land und in den Bergbauregionen verfügen Morales und seine „Bewegung zum Sozialismus“ (MAS) jedoch über ihre absoluten Hochburgen.
Trotzdem behauptet inzwischen auch die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), dass der von Morales auf den letzten Metern erreichte Vorsprung „statistisch unmöglich“ gewesen sei. Die Indígenas Boliviens verstehen das als Signal: Wie früher sollen sie von den weißen Machthabern ignoriert und ausgegrenzt werden, ihre Stimmen sollen nicht zählen.
Dagegen sind Anfang der Woche tausende Menschen auf die Straße gegangen. Vor allem in den beiden Nachbarstädten El Alto und La Paz – wo sich die Regierungsgebäude befinden – kam es zu Ausschreitungen. Die Wut der Demonstranten richtete sich nicht nur gegen die politischen Putschisten, sondern auch gegen die Polizei, deren Rebellion gegen die legitime Regierung den Staatsstreich erst möglich gemacht hatte. Nachdem im Internet Bilder kursierten, wie Polizisten die indigene Wiphala – neben der rot-gelb-grünen Trikolore die Staatsflagge Boliviens – von ihren Gebäuden einholten, aus den Abzeichen ihrer Uniformen herausschnitten oder sogar verbrannten, griffen die Demonstranten Polizeifahrzeuge und -wachen an. Obwohl Morales seine Anhänger wiederholt zur Gewaltlosigkeit aufrief, ist der Geduldsfaden bei vielen Menschen gerissen. Sie skandierten: „Ahora sí – Guerra Civil“ (Jetzt schon – Bürgerkrieg).
Das Militär, das sich Tage zuvor nicht den gegen Morales rebellierenden Polizisten entgegenstellen wollte, kündigte daraufhin an, gemeinsam mit der Polizei gegen die Protestierenden vorzugehen und auch Gewalt einzusetzen. Spätestens jetzt zeigte sich die wahre Fratze eines Militärputsches, dessen Existenz die deutsche Bundesregierung, die Europäische Union und die US-Regierung einfach leugnen.
Im Gegensatz dazu haben zahlreiche Länder Lateinamerikas den Staatsstreich entschieden verurteilt. Kuba, Venezuela und Nicaragua gehörten zu den ersten, die unzweideutig ihre Solidarität mit Evo Morales erklärten. Auch Uruguay und Mexiko verurteilten den Putsch. Die mexikanische Regierung gewährte Morales Asyl und holte ihn in der Nacht zum Dienstag mit einem Militärflugzeug aus Bolivien ab, um ihn in Sicherheit zu bringen. Scharfe Worte gegen die Putschisten fanden auch der gerade erst aus dem Gefängnis entlassene frühere brasilianische Präsident Luiz Ignácio Lula da Silva und der neugewählte Präsident Argentiniens, Alberto Fernández. Jubel herrschte dagegen bei der Rechten auf dem Kontinent. In Venezuela erklärte der selbsternannte „Übergangspräsident“ Juan Guaidó, es wehe „nicht nur eine Brise der Freiheit, sondern ein starker Wind“ durch Südamerika. Er rief seine Anhänger für diesen Samstag, 16. November, zu Großdemonstrationen und zum Sturz des rechtmäßigen Präsidenten Nicolás Maduro auf.
Vorab aus der UZ vom 15. November 2019

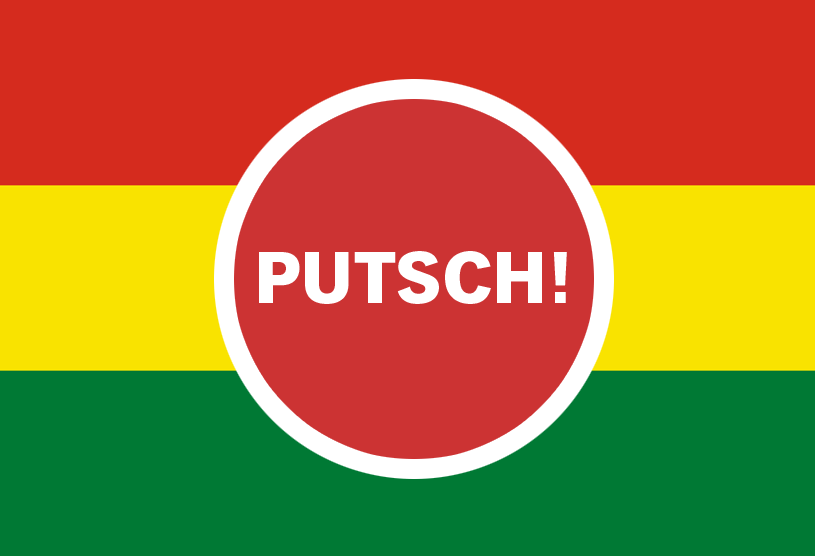

![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)