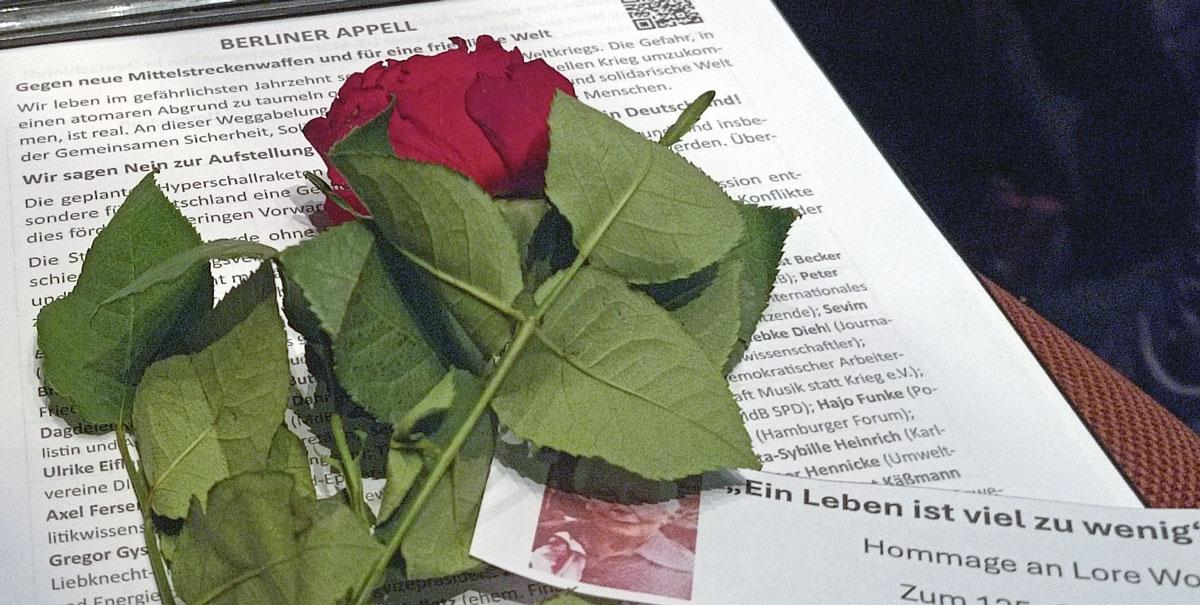Immer wieder wird in kontroverser Weise die Frage behandelt, ob und in welcher Form linke Kräfte an Wählerinnen und Wähler herantreten sollten, die ihrer Unzufriedenheit mit den bestehenden Verhältnissen durch eine Stimmabgabe zugunsten rechtsradikaler oder sogenannter „rechtspopulistischer“ Parteien Ausdruck verleihen. Brisanz gewinnt diese Frage nicht zuletzt dadurch, dass Angehörige der Arbeiterklasse, also der klassischen linken Kernwählerschaft, sich inzwischen in auffallendem Maße durch die fragwürdigen Angebote vor allem der AfD angesprochen fühlen.
In diesem Zusammenhang macht immer wieder das Schlagwort „Querfront“ die Runde. Was ist damit gemeint? Es geht hier um ein Konzept, dass zum ersten Mal zur Zeit der Weimarer Republik in Erscheinung trat. Sein Anliegen bestand darin, rechte und linke Kräfte unter Berufung auf vermeintliche Gemeinsamkeiten im Kampf gegen das Weimarer Establishment zusammenzuführen. In diesem Zusammenhang tauchte auch der Begriff des „Nationalbolschewismus“ auf. Es war schon damals klar, dass ein derartiges Zusammengehen für die linken „Partner“ nur unter Opferung elementarer eigener Programmpunkte, letztlich also nur um den Preis der Selbstaufgabe möglich gewesen wäre. Dementsprechend ist dieses Konstrukt im Wesentlichen auch ein gedankliches geblieben und hat nie praktische Wirksamkeit in nennenswertem Ausmaß gefunden. Organisationen wie die Gruppe Sozialrevolutionärer Nationalisten um den Journalisten Karl Otto Paetel blieben randständige Phänomene.
Dass der Begriff der Querfront immer noch Bestandteil des politischen Diskurses ist, hat zwei Gründe. Zum einen versuchen heutige Faschisten, nicht anders als ihre politischen Vorfahren, linke Begriffe und Kernaussagen aus dem Zusammenhang gerissen zu übernehmen und in ihre reaktionäre Weltanschauung zu integrieren. Schließlich war schon Hitler der Führer einer „sozialistischen“ „Arbeiterpartei“. Nichts enthüllt die Substanz dieses Etikettenschwindels mehr als der Umstand, dass den deutschen Monopolherren dieser eigentümliche „Sozialismus“ beträchtliche finanzielle Zuwendungen wert war. Die Nazis waren Realisten genug, um zu wissen, dass sie auf proletarische Wählerstimmen nicht verzichten konnten und darum wahlpolitische Angebote, wenn auch demagogischer Natur, in diese Richtung machen mussten. Aufschlussreich ist hier das Schreiben des sächsischen NSDAP-Gauleiters Martin Mutschmann, mit dem dieser einen irritierten Fabrikbesitzer zu beruhigen versuchte: „Lassen Sie sich doch nicht immer durch die Schlagworte „Nieder mit dem Kapitalismus!“, die wir auf unsere Plakate schreiben, verwirren. Diese Schlagworte sind notwendig. Sie müssen wissen, mit der Losung „Deutschnational oder National“ allein, würde es uns nicht möglich sein, unser Ziel zu erreichen. Wir müssen die Sprache der verbitterten Arbeiter sprechen, sonst werden sich diese bei uns nie zu Hause fühlen. Aus diplomatischen Gründen können wir nicht mit unserem wirklichen Programm herauskommen, ohne dessen Durchführung von vorneherein unmöglich zu machen.“
Zum anderen taucht der Begriff der Querfront immer wieder als Vorwurf auf, wenn z. B. kommunistische Kräfte die Wählerinnen und Wähler rechter Parteien nicht als verloren aufgeben und diese nicht in gleichem Maß als Feind betrachten wie organisierte Nazis bzw. entsprechende Funktionsträgerinnen und –träger. So erklärte im Januar 2016 Thomas Willms im Magazin der VVN/ BdA: „Phasenweise versuchen Teile der linken Bewegung die Anhängerschaft der rechten Massenbewegung zu erreichen, zu beeinflussen und zur eigenen Bewegung herüber zu ziehen. Dabei werden Begriffe der Rechten wie „nationale Befreiung“ usw. aufgenommen. Man stellt sich als eigentlicher Sachwalter der Nation dar.“ Willms lässt hier anklingen, dass er es als verwerflich betrachtet, wenn Linke versuchen, in ihrer Überzeugungsarbeit auch Wählerinnen und Wähler der AfD zu erreichen. Abgesehen davon, dass eine Linke, die feststellen muss, dass nennenswerte Teile der proletarischen Wählerschaft sich von ihr ab- und rechten Kräften zuwenden, vor allem Grund zur Selbstkritik hat, stellt sich die Frage, welchen Sinn Überzeugungsarbeit dann noch haben soll. Rassistisches Denken findet sich nicht nur in der Anhängerschaft der radikalen Rechten, sondern auch in der Klientel etablierter bürgerlicher Parteien. Linke, für welche die Arbeiterklasse auch weiterhin der zentrale Bezugspunkt ist, haben gar keine andere Möglichkeit, als fremdenfeindlich verhetzten Werktätigen immer wieder zu verdeutlichen, dass die Nutznießer ihrer prekären Lebenslage eben nicht zugewanderte, noch ärmere Arbeiterinnen und Arbeiter sind, sondern unverändert der kapitalistische Klassengegner. Wer dies ablehnt oder für moralisch anrüchig hält, dem bleibt wohl nur noch übrig, die bereits Überzeugten noch mehr zu überzeugen. In der AfD wird man diese Selbstbeschränkung mit Wohlgefallen zur Kenntnis nehmen.
Des Weiteren lässt sich dem Statement von Willms entnehmen, dass er den Bezug auf die Nation für Antifaschistinnen und Antifaschisten grundsätzlich nicht für statthaft hält. Unter Linken bekannt ist der Satz aus dem Kommunistischen Manifest: „Die Arbeiter haben kein Vaterland.“ Nur wird auch gern übersehen, was Marx und Engels direkt im Anschluss ausführen: „Indem das Proletariat zunächst sich die politische Herrschaft erobern, sich zur nationalen Klasse erheben, sich selbst als Nation konstituieren muss, ist es selbst noch national, wenn auch keineswegs im Sinne der Bourgeoisie.“
Interessant ist auch zu sehen, wie sich der berühmte italienische Kommunist Antonio Gramsci der von Willms angeprangerten Sünde schuldig machte, indem er sich oder vielmehr seine Partei zum „Sachwalter der Nation“ erklärte, als er vor seinen faschistischen Richtern stand: „Als Gramsci vom faschistischen Gericht verurteilt wird, zeigt er große Weitsicht: der Faschismus, sagt er, wird Italien in den Ruin führen und die Aufgabe der Kommunisten wird es sein, die italienische Nation zu retten.“ Es zeigt sich also, dass die Kommunistinnen und Kommunisten sich schon seit den Tagen ihrer Klassiker als „Sachwalter der Nation“ verstanden – „wenn auch keineswegs im Sinne der Bourgeoisie“. Ultralinke und „Antinationale“, welche die Nation (und in gleicher Weise oft auch den „Staat“) unter Absehung vom konkreten Klasseninhalt in geradezu esoterischer Weise als das Böse schlechthin mystifizieren, können sich dabei nicht auf die Tradition sozialistischer Theoriebildung berufen. Gern wird aus dieser Richtung auch angeführt, bei der Nation handele sich es lediglich um ein Konstrukt, das es zu „dekonstruieren“ gälte. Bislang konnte niemand den Namen des dazu gehörigen Konstrukteurs angeben, und auch ansonsten verrät dieser Einwand nur das Unvermögen seiner Urheberinnen und Urheber, in historischen Kategorien zu denken. Eine unter bestimmten Bedingungen sowie Anforderungen geschichtlich gewachsene Form menschlichen Zusammenlebens ist eben etwas anderes, als etwas beliebig Konstruiertes. J. W. Stalin hat in seiner einflussreichen Schrift „Marxismus und nationale Frage“ die Nation beschrieben als eine „historisch entstandene Gemeinschaft von Menschen“. Allein diese Feststellung verdeutlicht schon den fundamentalen Unterschied zwischen einem sozialistischen und einem reaktionärem Nationenverständnis sowie die Unmöglichkeit, beide in einen Topf zu werfen. Ein Produkt historischer Prozesse ist etwas grundsätzlich anderes als eine letztlich nur mystisch zu fassende „Schicksalsgemeinschaft“, zu deren Begründung „artverwandtes Blut“ oder sonstiger esoterischer Unsinn herangezogen wird. Stalin führt weiter aus: „Also ist die Nation kein zufälliges und kein ephemeres Konglomerat, sondern eine stabile Gemeinschaft von Menschen.“ Nebenbei bemerkt braucht die Erwähnung Stalins an dieser Stelle kein Grund sein für „antistalinistische“ Tiraden. Denn die erwähnte Schrift wurde 1913 veröffentlicht und fällt damit in die Zeit vor der später mit dem Etikett „Stalinismus“ versehenen Epoche in der Geschichte der UdSSR. Es bleibt also zu hoffen, dass es möglich ist, diese frühe Schrift Stalins sachlich zur Kenntnis zu nehmen. (Lenins Kommentar zu dieser Arbeit lautete: „Der Artikel ist sehr gut.“)
Der Internationalismus der kommunistischen Weltbewegung besteht also keineswegs in nationalem Nihilismus. Wer hier und heute den Nationalstaat dekonstruieren möchte, muss sich die Frage stellen, was den Platz des „dekonstruierten Konstruktes“ einnehmen soll. Das Beispiel der Europäischen Union ist hier lehrreich. Von ihren Apologetinnen und Apologeten wird sie gefeiert als Überwindung des Nationalismus, und passend dazu werden diejenigen, die diese Begeisterung nicht teilen mögen, als rückwärtsgewandt und nationalistisch verunglimpft. Ein Blick auf die inneren Kräfteverhältnisse der EU verdeutlicht aber, dass hier der Nationalismus keineswegs überwunden wurde, sondern dass im Gegenteil deutsches Großmachtstreben in diesem Rahmen erst recht zur Entfaltung gekommen ist. Der Wirtschaftraum der EU macht die Bahn frei für die zerstörerischen Exportwalzen der deutschen Monopole ebenso wie für die sich anschließenden Austeritätsdiktate, welche die Werktätigen der somit überrollten südlichen Mitgliedsstaaten in die Verelendung treiben. Wir finden hier die Bestätigung von Lenins Einschätzung, wonach „die Vereinigten Staaten von Europa unter kapitalistischen Verhältnissen entweder unmöglich oder reaktionär“ sind. Unter den Bedingungen des Imperialismus kann der supranationale Zusammenschluss mehrerer kapitalistischer Staaten nichts anderes bringen als die Dominanz des stärksten „Partners“ zu Lasten der Schwächeren – einhergehend mit dem schrittweisen Abbau bürgerlich – demokratischer Rechte. Sozialistisch orientierte Staaten wie Kuba und China sowie demokratisch – antiimperialistischen Staaten wie Venezuela und Bolivien hingegen steht der Weg offen, in ein partnerschaftliches Verhältnis zueinander zu treten und Austausch zu gegenseitigem Nutzen zu pflegen. Ob in diesem Sinne fortschrittlich orientierten Nationen irgendwann einmal den Weg eines Zusammenschlusses auf höhere Ebene gehen werden, ist eine Frage, deren Beantwortung man getrost der fernen Zukunft überlassen kann. Gegenwärtig, unter den Bedingungen einer größtenteils von imperialistischen Großmächten dominierten Weltökonomie, müssen solche Überlegungen als realitätsferne Gedankenspielerei erscheinen. Und gerade Kuba, das sich in vielen Entwicklungsländern durch seine großzügige Hilfe in den Bereichen Medizin und Bildung einen guten Namen gemacht hat, beweist, dass solidarischer Internationalismus keineswegs an die „Überwindung des Nationalstaates“ gebunden sein muss. Diejenigen, die im Falle Kubas an einer derartigen „Überwindung“ interessiert sein dürften, findet man vor allem in Washington.
Einer ähnlichen Herangehensweise wie Thomas Willms, der einen abstrakt – ahistorischen Begriff der Nation zum Ausgangspunkt seiner Querfront-Vorwürfen macht, befleißigt sich auch Lorenz Gösta Beutin (MdB Partei Die Linke und Historiker). Am 04. Januar 2018 veröffentlichte er einen Artikel, mit dem er darlegen wollte, „warum es für Linke keine Option ist, an nationalistische Diskurse anzudocken.“ Als historisches Beispiel wählt Beutin die Politik der KPD der Zwanzigerjahre des letzten Jahrhunderts. Er führt unreife Einschätzungen der KPD zum Charakter des Faschismus an, die um das Jahr 1923 entstanden. So verweist er auf eine Stellungnahme, in der die KPD den Antisemitismus der NSDAP zwar zurückwies, aber in ihrer Programmatik durchaus positiv zu bewertende sozialistische Ansätze feststellte. Beutins Kritik ist hier zuzustimmen, sollte aber um den Hinweis ergänzt werden, dass es sich eben um sehr frühe Bewertungen einer ebenso noch recht jungen gegnerischen Bewegung handelte. Die KPD hat in ihrer weiteren Entwicklung hier durchaus Lernfähigkeit bewiesen und anfängliche Fehleinschätzungen überwunden.
Besonderer Gegenstand der Kritik ist für Beutin allerdings das „Programm zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes“, das am 24.08.1930 vom ZK der KPD unter der Federführung Ernst Thälmanns veröffentlicht wurde. Die Programmerklärung bietet durchaus Anlass für Einwände. Sie führt eine Reihe von Vorschlägen zur unmittelbaren Linderung sozialer Notlagen ebenso an wie scharfe klassenkämpferischer Maßnahmen, die auf die Brechung der Macht der Monopole hinauslaufen. Erklärtes Ziel ist „Sowjetdeutschland“. Auf den Begriff des Sozialfaschismus zur Charakterisierung der SPD wird verzichtet, aber es findet sich dennoch die unmissverständliche Losung: „Nieder mit Faschismus und Sozialdemokratie!“ Dies ist verständlich, wenn man bedenkt, dass in der Frühphase der Weimarer Republik rechtsradikale Freikorps unter der Ägide der SPD-Führung tausende von Arbeitern niedermetzelten. Dennoch war diese Losung irreführend. Auch ein verständlicher Fehler bleibt letztlich ein Fehler. 1935 erfolgte anlässlich des siebten Kongresses der Kommunistischen Internationale die Korrektur, der zufolge angesichts der faschistischen Bedrohung nicht die unmittelbare Errichtung des Sozialismus auf der Tagesordnung zu stehen habe, sondern die Abwehr der Bedrohung von rechts vermittels einer Volksfront, in deren Reihen sich kommunistische, sozialistische, sozialdemokratische und bürgerlich-demokratische Kräfte zusammenfinden sollten. Zu den Stärken des Programms von 1930 zählte, dass es sich nicht nur an das Proletariat, sondern auch die notleidenden Mittelschichten wandte und insoweit die Verbreiterung der antifaschistischen Kampffront von 1935 in gewisser Hinsicht antizipierte.
Besonderer Stein des Anstoßes ist für Beutin jedoch die scharfe Stellungnahme der Programmerklärung gegen den Versailler Vertrag. Hier sieht er ein Einschwenken der KPD auf die Linie der faschistischen Agitation gegen den „Schandvertrag“. Zweifellos: Sowohl KPD als auch NSDAP wandten sich gegen die Beschlüsse von Versailles, die Deutschland mit gewaltigen Reparationsforderungen belastet hatten. Dennoch muss das, was auf den ersten Blick gleich aussieht, keineswegs gleichbedeutend sein. Haben wir es hier, Beutin folgend, mit einem „nationalbolschewistischen“ Sündenfall der KPD zu tun? Die Nazis betrachteten Versailles, keineswegs unbegründet, als wesentlichen Hemmschuh bei der Wiederaufnahme deutscher Großmachtpolitik. Ihre hochfliegenden Pläne zur Eroberung von „Lebensraum“ und zur Revidierung der Ergebnisse von 1918 waren mit dem von den Siegermächten vorgeschriebenen 100 000-Mann-Heer der Reichswehr bei zusätzlichem Verbot der Indienstnahme bestimmter Waffensysteme kaum zu bewerkstelligen. Man wollte also der eigenen Aggressivität und Revanchelust keinerlei Fesseln anlegen lassen.
Die Opposition der KPD gegen Versailles speiste sich aus einem grundsätzlich anderen Geist. Lenins Analyse folgend, betrachtete die KPD den Ersten Weltkrieg als einen imperialistischen Raubkrieg, der es Revolutionären nicht gestattete, für eine der beteiligten Seiten Partei zu ergreifen. Dass im Vorfeld des Krieges der deutsche Imperialismus mit besonderer Aggressivität auftrat, verlieh Großbritannien und Frankreich keineswegs den Charakter von Friedensmächten, ging es diesen doch vor allem darum, ihre zusammengeraubte koloniale Beute gegen den später hinzugekommenen Konkurrenten zu schützen.
Ausgehend von diesen Umständen verkündete die junge Sowjetmacht unter Lenins Führung 1917 das berühmte Dekret über den Frieden. In diesem wegweisenden Dokument wurde vorgeschlagen, alle Kampfhandlungen umgehend einzustellen und in Verhandlungen einzutreten über einen „gerechten und demokratischen Frieden ohne Annexionen und Kontributionen“. In kluger Weitsicht hatten die Bolschewiki begriffen, dass ein „Frieden“, der dem Verlierer die alleinige Schuld am Kriegsausbruch aufbürdet und ihn dem Bereicherungsdrang der Sieger preisgibt, nichts anderes sein kann als die Keimzelle des nächsten großen Krieges. Leider blieben die Bolschewiki mit ihrer Weisheit allein, wie die völlig entgegengesetzten Beschlüsse von Versailles zeigten. Erwartungsgemäß traf die Last der im Friedensvertrag festgelegten enormen Reparationszahlungen vor allem die werktätigen Massen Deutschlands. Den Nutzen hatte die französische Bourgeoisie. Der Vertrag selber war von nationalistischem Geist geprägt und nicht, wie Beutin meint, die kommunistische Opposition gegen ihn. Beutins wesentlicher Irrtum besteht darin anzunehmen, die Stellungnahme gegen Versailles in der Programmeerklärung von 1930 habe in dem Bedürfnis der KPD bestanden, angesichts des Aufstiegs der Nazis diesen nun inhaltlich-programmatisch hinterherzulaufen. Gegen die Vermutung, die KPD sei hier von nationalistischen Ambitionen befallen gewesen, spricht der Umstand, dass die Position zu Versailles keineswegs von der KPD allein entwickelt worden ist, sondern vielmehr auf internationaler Ebene erarbeitet wurde. Von einem nationalen bzw. nationalistischen Sonderweg der KPD konnte keine Rede sein. Der vierte Kongress der Komintern 1922 verabschiedete eine Resolution zur Frage des Versailler Vertrages, die feststellte: „Aber selbst die stärkste Ausbeutung des deutschen Proletariats, die Herabdrückung des deutschen Arbeiters zum Kuli Europas, das ungeheure Elend, in welches das Proletariat Deutschlands infolge des Versailler Friedensvertrages gesunken ist, ergibt noch immer nicht die Möglichkeit die Reparationszahlungen zu leisten. (…) Durch gemeinsam geführte Massenaktionen muss es dem Proletariat klargemacht werden, dass der Versuch einer Durchführung des Versailler Friedensvertrages das Proletariat ganz Europas in das tiefste Elend herabdrücken muss und dass der Kampf dagegen das gemeinsame Interesse des Proletariats aller Länder ist.“ Nicht unerwähnt bleiben sollte auch der Besuch Ernst Thälmanns am 31.10.1932 in Paris. Thälmann wurde dort begeistert empfangen, und der PCF-Vorsitzende Maurice Thorez bekräftigte die gemeinsame Gegnerschaft gegen Versailles. Vielleicht kann Herr Beutin erklären, warum sich revolutionäre französische Arbeiterinnen und Arbeiter vor den Karren des Chauvinismus ihres ehemaligen Kriegsgegners hätten spannen lassen sollen?
Nach die Programmerklärung veröffentlicht worden war, erklärten die kommunistischen Parteien Belgiens, Frankreichs, Großbritanniens, Italiens, Österreichs, Polens, der Schweiz, der Tschechoslowakei, der USA und Chinas ihr Zustimmung sowie ihre Solidarität mit ihren deutschen Genossinnen und Genossen. Die Programmerklärung zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes kann also als vom Vorwurf der nationalistischen Verirrung entlastet betrachtet werden. Vielmehr erscheint sie als Fortführung der bereits im sowjetischen Dekret über den Frieden angelegten Linie.
Als unseligen Ausfluss der Programmerklärung sieht Beutin die angebliche „Kooperation“ von NSDAP und KPD beim BVG (Berliner Verkehrsgesellschaft)-Streik ab dem 02.11.1932.
Was war dort geschehen? Die kommunistischen Betriebszellen bei der BVG hatten langfristig an der Vorbereitung einer großen Streikaktion gearbeitet. Reformistische Kräfte im Betrieb hatten versucht, dem entgegenzuwirken, aber ohne Erfolg. Bei der Urabstimmung zugunsten des Streiks, der sechs Tage dauern sollte, votieren auch die NSDAP-Mitglieder unter den Beschäftigten für den Ausstand. Dies hatte allerdings nichts mit einer „Kooperation KPD-NSDAP“ zu tun. Die Berliner Gauleitung der NSDAP war alles andere als begeistert über diese Entwicklung, konnte sie doch kaum ein Interesse daran haben, ihre kapitalkräftigen Förderer zu verprellen. Allerdings waren bei der BVG alle Beschäftigten von der gleichen bedrückenden sozialen Lage betroffen ohne Unterschied des Parteibuchs. Somit erschien es wenig aussichtsreich, den NSDAP-Angehörigen im Betrieb den Kampf um besseren Lohn ausreden zu wollen. In der NSDAP-Führung und unter ihrer Unterstützern breitete sich Unruhe und Irritation aus. Die KPD war die tragende Kraft des Streiks und bezog die NSDAP-Mitglieder unter der Belegschaft in den Streik mit ein. Welche Alternative hätte es auch gegeben? Die NSDAP-Mitglieder zum Streikbruch nötigen? Die KPD ließ sich von der schon in der Programmerklärung zur nationalen und sozialen Befreiung dargelegten Erkenntnis leiten, dass es zwischen den werktätigen Anhängern der NSDAP und dem Parteiapparat selber samt den hinter ihm stehenden Unterstützern zu unterscheiden gälte. In der Orientierung, beim BVG-Streik sämtliche Beschäftigte ohne Ansehen des Parteibuchs hinter nachvollziehbaren sozialen Forderungen zu versammeln, deutete sich auch die Möglichkeit an, Nazi-Anhänger in der Belegschaft in Widerspruch zu ihrer Führung zu bringen. Dabei reduzierte die KPD keineswegs ihre Anstrengungen, proletarische Wohnviertel gegen den Terror der SA zu verteidigen und hatte immer wieder ermordete Genossinnen und Genossen zu Grabe zu tragen. Wer andeutet, die Kommunistinnen und Kommunisten hätten sich aus opportunistischen Gründen auf einen „Kuschelkurs“ gegenüber der NSDAP eingelassen, beleidigt diese Opfer und entstellt die Wahrheit im Sinne der bürgerlichen „Rot-gleich-Braun-Propaganda“. Links denkende und empfindende Menschen sollten sich dafür zu schade sein.
Beim BVG-Streik hatte die KPD die prinzipiell zutreffende Annahme zugrunde gelegt, dass der gemeinsame betriebliche Kampf den Beteiligten unterschiedlicher Gesinnung ganz praktisch Klarheit darüber schaffen kann, wer wirklich an der Seite der Arbeitenden kämpft und wer lediglich eine „sozialistische“ Rhetorik demagogischen Charakters pflegt. Derart gewonnenen Erfahrungen wiegen möglicherweise schwerer als theoretische Darlegungen. Ob es im Gegensatz dazu nun sinnvoller ist, Arbeiterinnen und Arbeiter nur noch dann als Adressaten fortschrittlicher Politik zu sehen, wenn sie der entsprechenden Programmatik umstandslos folgen und sie ansonsten als moralisch „verbrannt“ von sich zu stoßen, mag dem Empfinden eigener „Reinheit“ entgegenkommen, führt aber zu klassenindifferentem Moralismus. Und wenn Benjamin-Immanuel Hoff (Partei Die Linke) über „resigniert-autoritätsgebundene traditionelle Arbeitnehmer/-innen und untere Milieus“ philosophiert, die repräsentieren zu wollen, eine linke Partei sich hüten solle, dann kündigt sich hier nichts weniger an als das Aufgeben der Klassenperspektive zugunsten einer kulturalistischen Sichtweise, die zum Ausgangspunkt wird für die systemkonforme Verklärung der sogenannten „offenen Gesellschaft“. Gegner sind dann nicht mehr die monopolkapitalistischen Kreise, die ein objektives Interesse an verschärfter Ausbeutung, Demokratieabbau und Spaltung der Arbeiterklasse entlang ethnischer Linien haben, sondern die als rassistisch gebrandmarkten „Proleten“. Der antifaschistische Kampf mutiert so zum elitären Kulturkampf der „offenen, urbanen Milieus“ gegen die „Modernisierungsverlierer“ und „Bildungsfernen“. Der Abstand zum Schwur von Buchenwald, der noch die „Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln“ forderte, könnte kaum größer sein.
Die Frage der Nation ist kein „rechter Diskurs“, (wie schon die diesbezüglichen Ausführungen von Marx und Engels zeigten) sondern ein offenes Kampffeld, auf dem unterschiedlichsten Kräfte um Hegemonie ringen. Wer sich hier auf nihilistische Positionen zurückzieht, beschenkt nur seinen Gegner. Dem Begriff der Nation kann und muss ein sozial fortschrittlicher Inhalt gegeben werden. Dies zu unternehmen ist kein „Querfront-Projekt“, das auf die Übernahme rechter Positionen hinausläuft Und wenn Thomas Willms kritisiert, dass dies auch mit der Intention verbunden ist, Anhängerinnen und Anhänger rechter Organisationen wenigstens in Teilen von diesen abzuspalten, so ist ihm dahingehend zu widersprechen, dass dies im Falle des Gelingens kein moralischer Sündenfall, sondern ein antifaschistischer Erfolg ist. Dass es hierbei keinerlei inhaltliche Konzessionen an rechte Ideologien geben kann und darf, versteht sich von selbst, so wie es auch unabdingbar ist, faschistischen oder faschistoiden Kräften überall dort den öffentlichen Raum streitig zu machen, wo diese ihn vereinnahmen wollen. Aber in Erkenntnis dessen, wem eine weitere Rechtsentwicklung real nützt, haben alle Angehörigen nichtmonopolistischer Schichten und Klassen zunächst einmal grundsätzlich Adressatinnen und Adressaten antifaschistischer Politik zu sein – mögen sie auch beim gegenwärtigen Stand der Auseinandersetzung noch gegen ihre eigenen Interessen handeln.
Erik Höhne



![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)