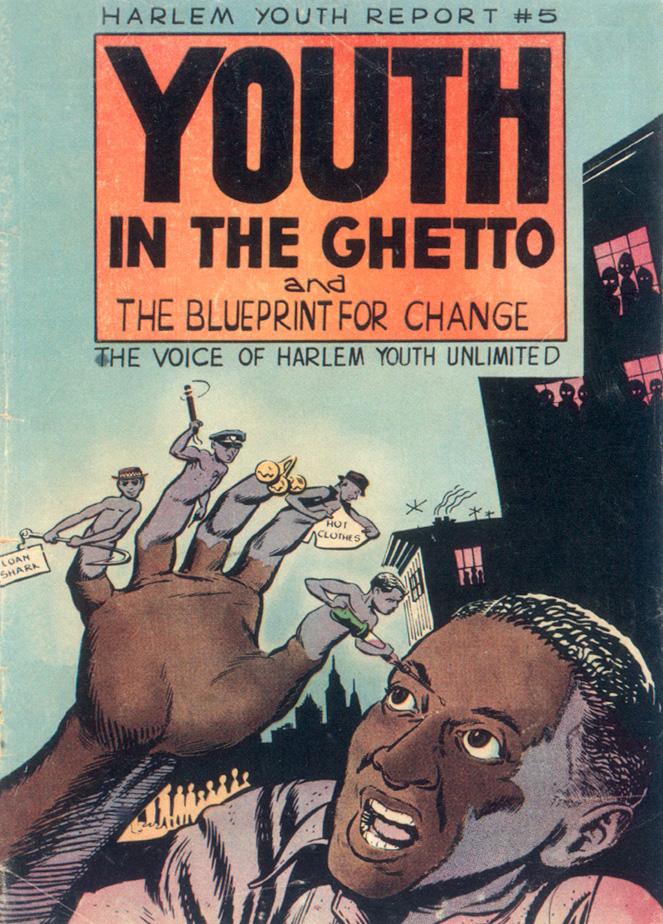Kann man beim Schauen einer Superheldenserie etwas (zeitgeschichtlich Wichtiges) lernen? Ich denke, ja, denn zumindest ich hatte bei der Serie „Watchmen“ immer wieder das Bedürfnis, auf die Pausetaste zu drücken und zu recherchieren, ob die in der Serie gezeigte Handlung wirklich auf historischen Tatsachen beruht (zumindest irgendwie) oder einfach völlig frei erfunden war. Und ich war überrascht, wie häufig Ersteres der Fall war.
Im Herbst 2019 lief auf dem US-amerikanischen Sender „HBO“ die auf der Idee der hochgelobten gleichnamigen Graphic Novel von Alan Moore und Dave Gibbons aus den 1980er Jahren basierende Fernsehserie „Watchmen“. In Deutschland war die Serie bislang leider nur auf „Sky“ zu sehen. Die Serienhandlung schließt sich dabei locker, wenn auch einige Jahre in die Zukunft versetzt, an den Kinofilm von Zack Snyder aus dem Jahr 2009 an. Genau wie Film und Graphic Novel ist die Handlung der Serie in einer alternativen Realität angesiedelt. In dieser Realität haben die USA den Vietnamkrieg aufgrund des Eingreifens von Superhelden gewonnen und nicht verloren. Und ein anderer Ex-Schauspieler, nicht Ronald Reagan, sondern Robert Redford, wurde in den 1980ern US-Präsident.
Die von Damon Lindelof („Lost“) entwickelte Serie ist aber nicht primär wegen ihrer Superheldengeschichte oder der Weiterentwicklung der in der Graphic Novel beziehungsweise dem Kinofilm begonnenen Ereignisse interessant. Wobei damit nicht gesagt sein soll, dass die Handlung über die neun Episoden der Serie hinweg nicht fesselnd erzählt wird. Die Serie ist interessant, weil sie Dinge anspricht, die einerseits zeitgeschichtlich bedeutsam sind, und weil sie andererseits Fragen aufgreift, die in der aktuellen Debatte um Rassismus in den USA und anderswo wichtig sind. So beginnt die Serie mit einem Rückblick auf das Massaker von Tulsa (Oklahoma), bei dem im Sommer 1921 im Zuge von rassistischen Ausschreitungen bis zu 300 Menschen ermordet wurden und ein ganzes, hauptsächlich von Afroamerikanern bewohntes Stadtviertel in Brand gesteckt wurde. 8.000 Menschen wurden obdachlos.
Spätestens als in der Serie der Einsatz von Flugzeugen und Maschinengewehren zu sehen ist, stellt sich die Frage, ob das Gezeigte faktenbasiert ist. Und bereits eine oberflächliche Recherche ergibt, dass auch dieser Aspekt der Serienhandlung erschreckenderweise auf Tatsachen beruht. Genau hier liegt aus meiner, zugegebenermaßen eher europäischen Sicht eine der Stärken der Serie. Darin, dass sie eine gut konzipierte Superheldengeschichte an historische Gegebenheiten anknüpfen lässt, die nur den wenigsten Zuschauerinnen und Zuschauern bekannt sein dürften. Eine Geschichtsstunde mal anders, auch weil die Ereignisse eben nicht als geschichtliche Tatsache dokumentarisch abgebildet werden, sondern Teil der normalen Serienhandlung sind.
Eine andere Stärke der Serie ist, in die Handlung auch Fragen zu rassistischen Vorurteilen und deren Kontinuität über Generationen hinweg aufzunehmen. Unter der superheldentypischen Thematik der Auswirkung von Maskierungen wird außerdem die Rolle der Sicherheitskräfte und von rassistischen Gruppierungen à la Ku-Klux-Klan dargestellt. Die Serie schreckt nicht davor zurück, auch solche Fragen anzusprechen, die sicherlich nicht vom gesamten Publikum in einer Superheldengeschichte erwartet und/oder begrüßt werden. Ein Beispiel hierfür sind Reparationszahlungen aufgrund von rassistischer Gewalt. Eine Debatte, die in den USA immer mal wieder angestoßen wird, in der Serie aber ein bereits in die Realität umgesetztes Projekt.
Spätestens zum 100. Jahrestag der Ereignisse von Tulsa im nächsten Jahr ist „Watchmen“ ein guter Anlass, um sich einerseits mit den damaligen Geschehnissen und andererseits mit den Strukturen von Rassismus in der heutigen Gesellschaft zu beschäftigen. Mit Blick auf die aktuellen Geschehnisse muss man allerdings nicht zwangsläufig bis 2021 mit der Serie warten, zumindest solange einen das Auftauchen von „Superhelden“ auf dem Bildschirm nicht grundsätzlich den Aus-Knopf auf der Fernbedienung suchen lässt.



![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)