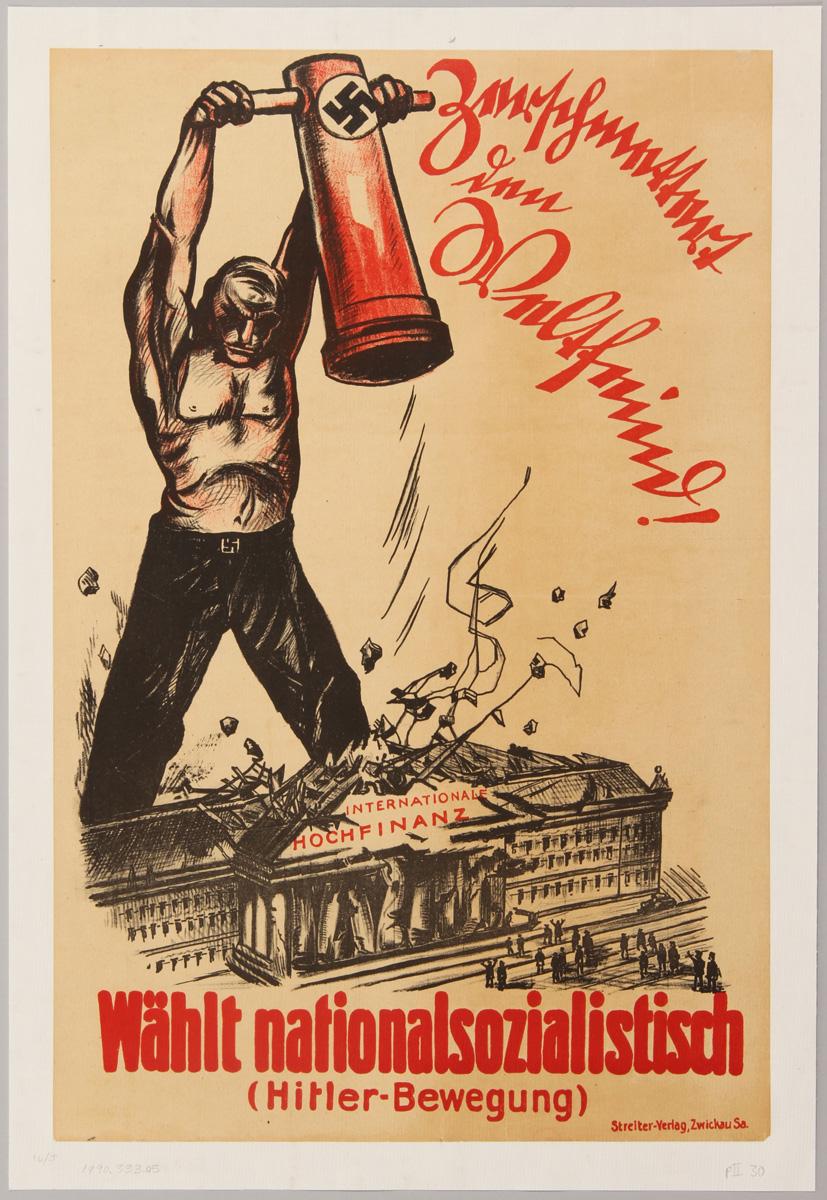Die Forderung von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), dass Deutschland „kriegstüchtig“ werden muss, war kein Ausrutscher. Sie entspricht vielmehr dem neuen Leitbild der Bundesregierung – dem Primat des Militärischen werden alle gesellschaftlichen Bereiche untergeordnet. Demnach sind Rüstungsausgaben wichtiger als ein ausfinanzierter Sozialstaat. Von Massenentlassungen betroffene Industriebelegschaften werden von den Arbeitsagenturen in die Bundeswehr vermittelt oder – zum Teil samt ihren Betrieben – in die Rüstungsindustrie überführt. Diese wird dazu angehalten, auf Serienproduktion umzustellen und die Kapazitäten zu vervielfachen. Das Primat des Militärischen betrifft auch das Gesundheitswesen und die medizinische Versorgung.
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) verkündete vor einem Jahr eine „Zeitenwende im Gesundheitswesen“: Krankenhäuser müssten auf den Konfliktfall ausgerichtet werden. Der Grund: Deutschland will sich besser für große Katastrophen und militärische Konflikte vorbereiten. Dazu müssten zusätzliche Lazarette eingerichtet, die Arzneimittelbevorratung angegangen und Katastrophenschutzseminare für Ärzte und Pflegekräfte organisiert werden. Dieses Vorhaben hat gravierende Folgen für die medizinische Versorgung der Bevölkerung, für das ohnehin schon überlastete Pflegepersonal und für die Lieferketten der Pharmaindustrie.
Triage nach militärischer Logik
„Im Ernstfall: Was bedeutet Kriegsmedizin?“ lautete der Titel eines Symposiums, das Ärztekammer und Bundeswehr im Spätsommer 2024 gemeinsam in Hessen abhielten. Diskutiert wurde, wie die zivil-militärische Zusammenarbeit gestärkt und die Grenzen zwischen Militärmedizin und Zivilmedizin verschoben werden können. Die Folgen einer solchen Verschiebung dürften enorm sein, denn die Interessen und Bedürfnisse der beiden Bereiche sind keineswegs deckungsgleich. Während die zivile Medizin grundsätzlich den Erhalt der Gesundheit durch die Stärkung der Immunabwehr, gesunde Ernährung, Bewegung, medizinische Vorsorge oder Rehabilitationsmöglichkeiten in den Mittelpunkt stellt, steht die Kriegsmedizin für das Gegenteil. Sie ist die gesundheitspolitische Vorbereitung auf einen Krieg, der für tausende Soldaten und Zivilisten Schusswunden, Verbrennungen, Amputationen und Kriegstraumata bedeutet.
Im Kriegsfall muss die medizinische Versorgung für eine große Zahl von Verletzten mit wenig Zeit und knappen medizinischen Ressourcen erfolgen. Unter diesen Bedingungen muss abgewogen werden, was sich in Friedenszeiten aus ethischen Gründen verbietet: die Behandlung von Patienten je nach Effizienz oder Zugehörigkeit. Mit dem Triage-Gesetz von 2022 hat die Bundesregierung angesichts des Mangels an Intensivbetten während der Corona-Pandemie bereits den Weg für solche Zuteilungsentscheidungen beschritten: medizinische Versorgung je nach Überlebenswahrscheinlichkeit. Im Kriegsfall unterliegen derartige Entscheidungen der militärischen Logik. Gute Chancen hat, wer Militärangehöriger ist, schlechte, wer nur als ungedienter Zivilist durchgeht oder gar der gegnerischen Kriegspartei angehört.
Kooperation mit der Bundeswehr per Gesetz
Gleichzeitig werden Strukturen geschaffen, die eine weitreichende Einbindung des zivilen Gesundheitswesens unter Führung der Bundeswehr ermöglichen. Die im Juni 2024 von der Bundesregierung verabschiedeten „Rahmenrichtlinien für die Gesamtverteidigung“ verpflichten die Einrichtungen des zivilen Gesundheitswesens dazu, die Zusammenarbeit mit den Katastrophenschutzbehörden vorzubereiten und zu üben. Außerdem sollen die Bundesländer Maßnahmen zur gesundheitlichen Versorgung im Kriegsfall planen. „Nutzungs-, Erweiterungs- und Einsatzmöglichkeiten der vorhandenen Einrichtungen“ sollen ebenso ermittelt werden wie der voraussichtliche personelle und materielle Bedarf. Eine enge Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen der Bundeswehr ist dabei obligatorisch.
Ein „Gesundheitssicherstellungsgesetz“ zur Regelung der medizinischen Versorgung im Katastrophen- oder Kriegsfall ist in Arbeit. „Im Krisenfall muss jeder Arzt, jedes Krankenhaus, jedes Gesundheitsamt wissen, was zu tun ist. Wir brauchen klare Zuständigkeiten – etwa für die Verteilung einer hohen Zahl an Verletzten auf die Kliniken in Deutschland“, argumentiert Lauterbach. „Schließlich muss für den Krisenfall der Einsatz und die Verteilung von medizinischem Personal geklärt sein.“ Unter Fachleuten gilt das Gesetz als zentrale Voraussetzung für eine effektive zivil-militärische Zusammenarbeit und als wichtiger Baustein, um die Zivilmedizin im Kriegsfall dem Kommando der Bundeswehr zu unterstellen. Die in Friedenszeiten erprobte zivil-militärische Zusammenarbeit im Rahmen der Amtshilfe wird dann schnell ihren Charakter ändern. Der Leiter der Koordinierungsstelle Kommunales Krisenmanagement in Potsdam, Oberstleutnant Björn Stahlhut, ist da sehr deutlich: „Die Zivil-militärische Zusammenarbeit in der Krise und im bewaffneten Konflikt zeigt damit ein völlig anderes Gesicht als im Alltag. Es sind mithin zwei unterschiedliche Richtungen der Unterstützung. Während im Alltag die Bundeswehr die zivilen Behörden unterstützt, ist es in der Krise und erst recht im bewaffneten Konflikt genau andersherum.“
„Wir werden euch nicht helfen können“
In den 1980er Jahren, als im Windschatten der Stationierung der Pershing-II-Raketen schon einmal versucht wurde, die medizinische Versorgung kriegstüchtig zu machen, scheiterte ein solches Gesundheitssicherstellungsgesetz am Widerstand von Ärzten und Pflegekräften und am Rückenwind der Friedensbewegung. Sie kritisierten, dass ein solches Gesetz die Illusion von Sicherheit, Schutz und medizinischer Versorgung schafft, eine Illusion, weil im Falle eines Atomangriffs keine Hilfe mehr möglich sei. „Wir werden euch nicht helfen können“, lautete damals der Appell, mit dem sie sich an die Bevölkerung wandten.

Auch heute kämpfen die „Internationalen Ärztinnen für die Verhütung des Atomkriegs“ (IPPNW) und der „Verein demokratischer Ärztinnen“ (vdää) gegen diese Illusion. „Keine Dekontaminationsübung wird verhindern, dass Zigtausende Menschen qualvoll sterben, wenn es zum Einsatz von Nuklearwaffen kommt. (…) Die Geschichte, aber auch ein Blick in aktuelle Kriegsregionen lassen keinen Zweifel zu“, heißt es in einer Erklärung der IPPNW. Es seien nicht nur Schussverletzungen, die in Notoperationen versorgt werden müssten. Es gehe um erblindete, zerfetzte, gefolterte, hungernde, an Infektionen sterbende Kinder, Mütter, Großmütter und Väter. Es gehe um psychische Traumata, „die über Generationen hinweg weitergegeben werden, die eine nicht heilen wollende Wunde tief in der Gesellschaft hinterlassen“, so die IPPNW.
Ausbildung auf simuliertem Schlachtfeld
„Erfahrung und Wissen von Ärzten, die die Weltkriege erlebt haben, sind über die Jahrzehnte verloren gegangen“, bedauert der Generalstabsarzt der Bundeswehr, Johannes Backus. Wohl auch deshalb wurden bislang knapp 1.000 ukrainische Patienten in Deutschland medizinisch versorgt, denn so kann die Versorgung von Kriegsverletzungen erlernt werden. An der Berliner Charité trainieren Sanitätsoffiziere gemeinsam mit Medizinstudenten die medizinische Versorgung unter simulierten Kriegsbedingungen. Dabei werden Kinder- und Frauengeschrei sowie Schussgeräusche eingespielt, um die Prüflinge „so gut es geht auf die Realität vorzubereiten“, schwärmt der zuständige Ausbilder eines Sanitätsregiments.
Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Verzahnung von ziviler Gesundheitsversorgung und Militärmedizin auch eine Frage der vorhandenen Ressourcen ist. Die zivile Seite müsse ein neues Rollenverständnis entwickeln und stärker dazu übergehen, die Bundeswehr zu unterstützen, heißt es in Fachkreisen. Letztere müsse das Recht haben, „im Rahmen eines zivil-militärischen Netzwerks auch zivile Krankenhäuser und Rehabilitationseinrichtungen“ zu nutzen. Auf die Ökonomisierung des Gesundheitswesens folgt nun also seine Militarisierung. Die knappen Ressourcen sollen schleichend der Zivilbevölkerung entzogen und dem Militär zur Verfügung gestellt werden.
Pflegekräfte sind seit Jahren überlastet, unter anderem wegen des anhaltenden Personalmangels. Statt der notwendigen Entlastung kommen nun zusätzliche Aufgaben. Gemeinsam mit der Bundeswehr sollen Pflegekräfte Dekontaminationsausbildungen absolvieren und in Katastrophenschutzseminaren auf den Ernstfall vorbereitet werden. Die medizinische Versorgung von Lungenentzündungen, Herzinfarkten, Schlaganfällen oder Krebserkrankungen dürfte darunter weiter leiden.
Abkopplung vom asiatischen Markt
„Öffentliche Gesundheit ist eine geostrategische Waffe, die einen Kontinent in die Knie zwingen kann“, hieß es bereits 2020 in einem Bericht des Europäischen Parlaments über die Bedeutung unabhängiger Lieferketten in der Pharmaindustrie. Bereits damals wurden mehr als 60 Prozent der Wirkstoffe für zugelassene Medikamente in Asien produziert, vor allem in China und Indien. Weil die deutsche Pharmaindustrie mit der Herstellung von sogenannten Generika – also Arzneimitteln, deren Patentschutz ausgelaufen ist – keine hohen Profite erzielen kann, hat sich die Produktion in den letzten zwei Jahrzehnten sukzessive nach Asien verlagert. Generika decken aber etwa 80 Prozent der Grundversorgung mit Medikamenten ab, insbesondere im Bereich der Antibiotika. Die Abhängigkeit vom asiatischen Markt hat zugenommen.
Um auch im Kriegsfall ausreichend Medikamente vorrätig zu haben, soll nun die europäische Abhängigkeit von der Pharmaindustrie in Asien reduziert werden. Im Dezember 2023 beschloss die Bundesregierung eine „Nationale Pharmastrategie“: „Die pharmazeutische Industrie ist essenziell für die medizinische Versorgung und bedarf einer besonderen Betrachtung für Bedrohungen und Krisenlagen“, heißt es darin. Die Pharmaproduktion müsse deshalb wieder gestärkt, Zulassungsverfahren beschleunigt und die Rahmenbedingungen für Investitionen verbessert werden.
Gesundheit gibt es nur im Frieden
Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit wurden und werden eine ganze Reihe von Gesetzen, Richtlinien und strategischen Positionspapieren verabschiedet, die den rechtlichen Rahmen für die Militarisierung des Gesundheitswesens schaffen. Diese Entwicklung unterstreicht: Eine Gesellschaft, die eine gut ausgestattete Daseinsvorsorge und eine gute Gesundheitsversorgung für die breite Bevölkerung anstrebt, gibt es nur im Frieden.



![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)