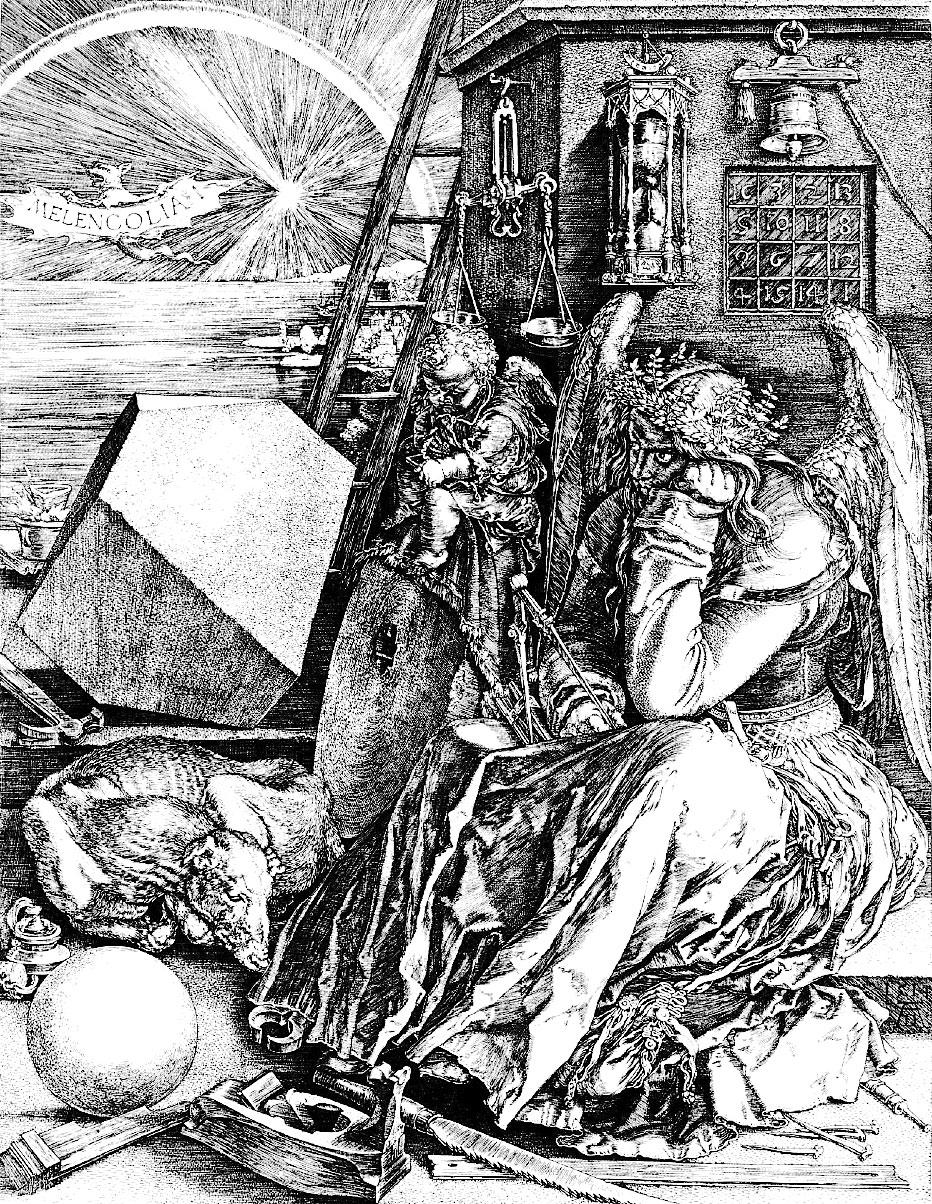„Der Sahel ist in einer der schwersten Krisen seiner sehr langen Geschichte“, stellte Mamadi Doumbouya in seiner Rede auf der 78. Generalversammlung der UNO im September fest. Westafrika sei ernsten Bedrohungen ausgesetzt, Bedrohungen der Sicherheit, der Entwicklung, der Stabilität. Doumbouya, Jahrgang 1980, ist seit dem 1. Oktober 2021 Übergangspräsident Guineas. Vier Wochen vorher hatte er einen Militärputsch gegen Präsident Alpha Condé angeführt. Er gehöre zu denen, sagte er in New York, die eines Morgens beschlossen hätten, Verantwortung zu übernehmen, „um unserem Land völliges Chaos zu ersparen“.
Fünf Putsche
Mamadi Doumbouya ist einer von mehreren westafrikanischen Militärs, die in den letzten drei Jahren per Staatsstreich gegen „verlässliche Partner des Westens“ an die Macht gekommen sind. In Mali gelang das einer ebenfalls recht jungen Riege von Militärs aus der zweiten Reihe um Assimi Goïta, Oberst einer Spezialeinheit. Er putschte am 19. August 2020 und noch ein zweites Mal am 24. Mai 2021. Seitdem leitet Goïta die Übergangsregierung. In Burkina Faso putschte Ibrahim Traoré am 30. September 2022. Seitdem ist er der jüngste Staatschef der Welt. Der bislang letzte Militärputsch dieser Serie fand am 26. Juli 2023 in Niger statt. General Abdourahamane Tiani und seine Kollegen sind deutlich älter als Doumbouya, Goïta und Traoré. Tiani hatte zwölf Jahre lang an der Spitze der Präsidentengarde gestanden, seine Kollegen waren ebenfalls gut etabliert, viele von ihnen Söhne einstiger politischer Größen Nigers.
Ähnliche Probleme
Die Probleme, vor denen die Übergangsregierungen stehen, ähneln sich. Westafrika gilt als ärmste Region der Welt. Infrastruktur, medizinische Versorgung und Bildung gehören zu den am wenigsten entwickelten der Erde. In Niger praktizieren 0,35 Ärzte je 10.000 Einwohner. Zum Vergleich: In Deutschland kommen auf diese Einwohnerzahl 45 Ärzte. Die Alphabetisierungsrate liegt in Burkina Faso bei 41,2 Prozent, die durchschnittliche Schulbesuchsdauer der über 25-Jährigen bei 1,6 Jahren – die kürzeste der Welt. Die Staaten Westafrikas haben die jüngsten Bevölkerungen der Welt. Den Rekord hält Niger, dort lag das Median-Alter 2020 bei 15,2 Jahren. Küstenländer wie Ghana, Côte d’Ivoire und Senegal sind entwickelter als die Sahel-Staaten. Dort herrschen vorteilhaftere klimatische Bedingungen. Vor allem aber spiegeln sich in dem ungleichen Entwicklungsstand die Konsequenzen jahrhundertelanger kolonialer Ausplünderung: Die koloniale Infrastruktur ist einseitig auf den Transport von Rohstoffen und landwirtschaftlicher Erzeugnisse an die Häfen an der Küste ausgerichtet. Das war nicht immer so – die prosperierenden Großreiche des Mittelalters wie das Ghana-Reich, das Mali-Reich oder das Reich der Songhai hatten keinen oder kaum Zugang zur Küste und stützten sich vor allem auf den Transsahara-Handel.
Unterschiedliche Beweggründe
Mamadi Doumbouya begründete seinen Putsch damit, eine dritte Amtszeit Alpha Condés verhindern zu wollen. Guineas Verfassung sieht eine Begrenzung auf zwei Amtsperioden je Präsident vor, wie die der meisten anderen Länder Westafrikas auch. Condé wollte sich darüber hinwegsetzen. Auch damit war er nicht allein. „Troisième mandat“, dritte Amtszeit, ist quer durch Westafrika zum geflügelten Wort geworden. Es meint die Missachtung geltender Gesetze, die straffrei bleibt, wenn man einflussreiche Freunde an der richtigen Stelle hat. Viel zahlreicher als die Putschisten, die zu Waffen griffen, seien doch diejenigen, „die Hinterlist anwenden, die betrügen, um die Verfassungstexte zu manipulieren, damit sie ewig an der Macht bleiben“, sagte Doumbouya in New York. „Es sind die in weißen Kragen, die während des Spiels die Spielregeln ändern, um die Zügel des Landes in der Hand zu behalten.“ Namen brauchte er keine zu nennen, seinen afrikanischen Amtskollegen und deren Bevölkerungen sind die gut bekannt: Alassane Ouattara zum Beispiel, einst Stellvertretender geschäftsführender Direktor des Internationalen Währungsfonds und durch einen von Frankreich befeuerten Bürgerkrieg an die Macht gekommen, hat sich in Côte d’Ivoire 2020 eine dritte Amtszeit gegönnt. In Senegal schickt sich aktuell Macky Sall dazu an – auch er gilt als „verlässlicher Partner“ des Westens. Darüber schweigt die bürgerliche Presse in Deutschland, die sonst jeden Staatsstreich mit Schaum vor dem Mund kommentiert.
In Mali, Burkina Faso und Niger war ein bislang noch nicht erwähntes Problem noch drängender als in Guinea: Das der verheerenden Sicherheitslage. 2012 nahmen Tuareg-Milizen im Norden Malis den bewaffneten Kampf mit dem Ziel auf, einen unabhängigen Staat namens Azawad zu schaffen. Sie kämpften zusammen mit islamistischen Terrorgruppen. Beide waren bestens mit Waffen ausgerüstet. Die kamen aus Libyen, eine Konsequenz der Intervention Frankreichs und der NATO von 2011. Tuareg und Islamisten gelangen schnelle Geländegewinne. Frankreich nahm das 2013 als Vorwand, um im Sahel militärisch zu intervenieren. Gaddafis Ermordung hatte weitere gravierende Folgen für den Sahel: Libyens Investitionen brachen weg, Projekte wie der Bau einer Straße von der libyschen Grenze ins nigrische Agadez wurden abgebrochen, und 200.000 nigrische Migranten kehrten nach Hause zurück. Ihre Löhne in Libyen hatten zuvor ihre Familien in Niger ernährt.
Assimi Goïta hatte die französische Intervention mitverfolgt. Als einheimischer Militär war er selbst an der Terrorbekämpfung beteiligt – und musste zusehen, wie islamistische Milizen schließlich wieder näher an Malis Hauptstadt Bamako rückten. Wenn die französischen Truppen in Mali die Terroristen nicht aufhalten, muss Malis Militär die Kontrolle übernehmen, entschied Goïta. Weil seine Streitkräfte dafür nicht gut genug ausgebildet und ausgestattet waren, fragte er in Moskau nach Hilfe. Die Militärfirma Wagner schickte 1.000 Söldner zur Unterstützung. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach von „Undank“, bediente das rassistische Narrativ vom unmündigen Afrikaner, der auf „russische Propaganda“ reinfalle, und zog sein Militär aus Mali ab. Für Assimi Goïta und seine Übergangsregierung war das ein erster beachtlicher Erfolg. Die französische Besatzungsmacht hatte sich mit Massakern wie der Bombardierung einer Hochzeitsgesellschaft am 3. Januar 2021 mit mindestens 22 Toten keine Freunde gemacht. Ohnehin ist Frankreichs neokoloniale Einflussnahme den Maliern gründlich verhasst.
Goïtas Erfolg inspirierte. Burkina Faso leidet noch mehr unter islamistischem Terror als Mali: Alleine 2022 ermordeten Terroristen dort über 8.500 Menschen. Auch in Burkina war französisches Militär stationiert, das genau das eigentlich verhindern sollte. Ibrahim Traoré hatte als Offizier selbst an der Front gegen Terroristen gekämpft. Er begründete seinen Putsch genau wie Goïta mit der vernichtenden Bilanz der französischen Intervention und der Notwendigkeit, den Kampf gegen den Terror selbst anzuführen und sich dafür neue Partner zu suchen. Traoré holte sich ebenfalls Hilfe aus Russland und startete eine Kampagne, um 50.000 Freiwillige für den Krieg gegen den Terror zu gewinnen.
Auch General Tiani begründete seinen Staatsstreich mit der Sicherheitslage – und drängenden sozialen Problemen. Tiani allerdings gilt als Vertrauter von Mahamadou Issoufou, dem Amtsvorgänger von Mohamed Bazoum, gegen den sich sein Putsch richtete. Der nigrische Journalist Sidik Abba geht davon aus, dass Issoufou die Entscheidung für den Putsch getroffen habe, nachdem ein Versuch Issoufous, die politische Kontrolle über die Ölvorkommen Nigers zu übernehmen, am Vortag gescheitert war.
Frankreich auf dem Rückzug
Selbst wenn Tianis Putsch eher eine Schlacht im Verteilungskampf war statt antikoloniales Projekt: Auch dieses Beispiel zeigt deutlich, dass die neokolonialen Einflussmöglichkeiten des Westens, insbesondere aber Frankreichs in Westafrika schwinden.
Nach dem Rückzug Frankreichs aus Mali bis Juni 2022 und aus Burkina in diesem Jahr war Niger zur letzten Operationsbasis der ehemaligen Kolonialmacht in diesem Teil des Sahels geworden. Nur im zentralafrikanischen Tschad sind noch französische Truppen stationiert. Von dort aus konnte Frankreich noch illegale Luftoperationen in Mali und Burkina fliegen, was die Übergangsregierungen in Bamako und Ouagadougou immer wieder kritisierten. Übrigens spielte Niger auch eine wichtige Rolle für den Abzug der Bundeswehrtruppen aus Mali – mit ein Grund, weshalb die Bundesregierung angedeutet hatte, eine militärische Intervention des westafrikanischen Staatenbündnisses ECOWAS in Niger zu unterstützen.
Dass die Übergangsregierung in Niamey sich an den Erfolgsgeschichten aus Mali und Burkina orientieren würde, war schnell klar. Am 3. August kündigte Tiani gleich fünf Militärabkommen mit Frankreich. Darunter war auch die Vereinbarung, auf deren Grundlage Frankreich 1.500 Soldaten in Niger stationiert hatte. Schon vorher hatte Macron angekündigt, man werde eine ECOWAS-Intervention „unterstützen“, die den „demokratisch gewählten“ Präsidenten Bazoum wieder installieren solle. Die Kündigung der – einst mit Putschregierungen geschlossenen – Abkommen akzeptiere man nicht, da Tiani nicht „demokratisch legitimiert“ sei. Ein spannendes Kräftemessen begann. Frankreich verlor: Knapp zwei Monate später erklärte Macron, sein Militär aus Niger abzuziehen und Botschafter Sylvain Itté gleich mit. Dessen Akkreditierung hatte die Übergangsregierung am 25. August widerrufen, woraufhin er sich medienwirksam in der französischen Botschaft in Niamey verschanzte und von Notrationen ernährte. Nigers Übergangsregierung nannte den Abzug „eine neue Etappe in Richtung Souveränität Nigers“.
Die angedrohte und tatsächlich geplante ECOWAS-Intervention fand bis heute nicht statt. Beobachter gehen davon aus, dass sie vom Tisch ist. Das ist der bislang größte Erfolg der Länder Westafrikas, die heute nach der tatsächlichen Verwirklichung ihrer Unabhängigkeit streben.
Verhinderte Intervention
Mehrere Faktoren haben dabei eine Rolle gespielt. Einer davon sind zwischenimperialistische Widersprüche: Die US-Regierung, die zwei wichtige Militärbasen in Niger unterhält, weigerte sich lange, den Putsch als solchen zu bezeichnen und verhandelte früh mit Tianis Übergangsregierung – sehr zum Missfallen Frankreichs. In Washington hatte man wohl erkannt, dass die eigenen Interessen nicht unmittelbar bedroht sind und sich mit dem Herausdrängen Frankreichs neue Chancen ergeben.
Ein weiterer Faktor: Die Regierungen der ECOWAS-Mitgliedstaaten, die erklärt hatten, eine Intervention unterstützen zu wollen, stießen auf teils massiven Widerstand bei sich zuhause. So scheiterte Bola Tinubu, Präsident von Westafrikas größter Militärmacht Nigeria, bei dem Versuch, die Zustimmung des Senats zu bekommen. Ein kluger Schachzug war der Zusammenschluss von Mali, Burkina Faso und Niger zur Allianz der Sahel-Staaten. Die dient in erster Linie der gemeinsamen Koordinierung des Kampfes gegen den Terror, ist aber auch ein gegenseitiger militärischer Beistandspakt. Wenn ihr in Niger einmarschiert, greift ihr auch uns an, hatten Goïta und Traoré ihren ECOWAS-Amtskollegen unmissverständlich klar gemacht.
Vielleicht das Zünglein an der Waage war die Position Algeriens. Das Land grenzt im Norden an Niger. Mit ausdrücklichem Verweis auf die NATO-Intervention in Libyen verbat sich Algeriens Präsident Abdelmadjid Tebboune eine Intervention in Niger. Die würde zu einem katastrophalen Flächenbrand im Sahel führen, weshalb er Frankreich beschied, keine Überflugrechte für einen Militäreinsatz in Niger zu gewähren.
Neuer Aufbruch
Die „Strukturen, die Regeln, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Abwesenheit unserer Staaten, die noch gar nicht existierten, entstanden sind“, seien heute obsolet, sagte Mamadi Doumbouya vor der UNO-Generalversammlung. „Es ist das Ende einer unausgeglichenen, ungerechten Epoche, in der wir kein Mitspracherecht hatten.“ Seine Worte mögen hoffnungsfroh sein. Doch zeigt sich in Westafrika deutlich, dass der Westen auf dem absteigenden Ast ist und die kolonialen Objekte von einst wieder zu Subjekten ihrer eigenen Entwicklung werden.
Das wird nicht nur im wesentlich selbstbewussteren Auftreten westafrikanischer Politiker auf dem internationalen diplomatischen Parkett sichtbar. Mali zum Beispiel hat sich im Juni dieses Jahres eine neue Verfassung gegeben. Französisch wird darin zur Arbeitssprache degradiert, 13 autochthone Sprachen zu Amtssprachen befördert. Das ist keine Symbolpolitik: Alphabetisierung in der Muttersprache ist ein wichtiger Eckpfeiler für Bildungserfolg. Ein neu eingerichteter Rechnungshof soll der Selbstbereicherung politischer Eliten auf Kosten des Volkes entgegen wirken. Ein neues Bergbaugesetz erlaubt der Republik Mali, bis zu 30 Prozent der Anteile an neuen Minen zu übernehmen. Steuerbefreiungen für ausländische Konzerne wurden abgeschafft. Fortschritte gibt es auch auf militärischem Gebiet: Am 14. November befreite Malis Armee Kidal. Die Kleinstadt im Nordosten des Landes war seit 2014 in der Hand von Tuareg-Sezessionisten, ihre Befreiung die Einlösung eines Versprechens von Assimi Goïta.
70 Prozent der Afrikaner seien „völlig hemmungslose junge Menschen, weltoffene junge Menschen, die entschlossen sind, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen“, freute sich Mamadi Doumbouya in New York. Eins ist klar: „Papas Afrika“, das alte Afrika, das sich an der kurzen Leine Europas führen ließ, gibt es nicht mehr.



![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)