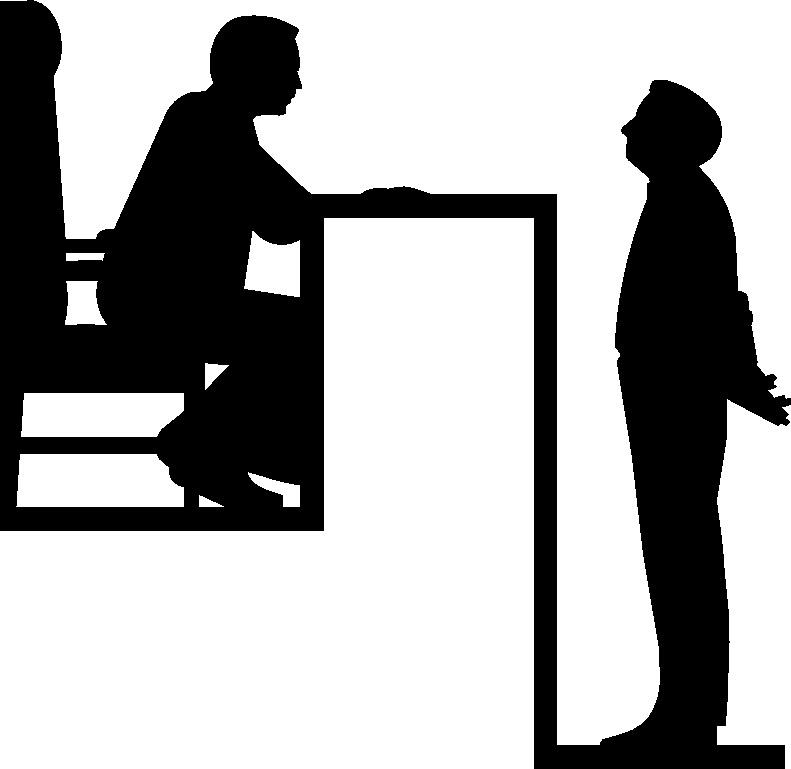Die Anzahl der Wohnungslosen steigt – Mietenwahnsinn und Corona-Pandemie reichen sich die Hand. Viele Einrichtungen sind geschlossen oder arbeiten eingeschränkt. Und jetzt steht der Winter vor der Tür.
UZ sprach mit Julia von Lindern. Sie arbeitet beim Düsseldorfer Verein „fiftyfifty“, der sich um die Betreuung von Wohnungslosen kümmert.
UZ: Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf Ihre Arbeit aus?

Julia von Lindern: Zu Beginn des Lockdowns herrschte zunächst einmal Chaos und Unsicherheit. Einige Einrichtungen wurden geschlossen, andere wiederum haben die aufsuchende Arbeit eingestellt, um Kontakte zu vermeiden, und wir mussten uns beinahe täglich über Änderungen informieren, was noch oder wieder geht.
Dramatisch für wohnungslose und arme Menschen war sicherlich, dass ihnen von jetzt auf gleich die Einnahmequellen fehlten, um zu überleben.
UZ: Inwiefern?
Julia von Lindern: Die Innenstädte waren menschenleer, Straßenmusik und Flaschensammeln funktionierte nicht. Und auch eine Straßenzeitung zu verkaufen, war nur unter extrem schwierigen Bedingungen möglich. Viele Magazine sind unter anderem aus Infektionsschutzgründen im April gar nicht erschienen. Wir haben uns für einen anderen Weg entschieden und erstmalig die Hefte kostenlos an die Verkäuferinnen und Verkäufer abgegeben, um ihnen überhaupt eine Chance zum Verkauf zu geben. Das ganze Geld ging an die Verkäuferinnen und Verkäufer selbst. Auf diese Weise wollten wir den Absatz ankurbeln, ohne dabei die sonst übliche Verdienstspanne für unsere Leute auf der Straße zu schmälern.
Nach mehr als einem halben Jahr hat sich die Lage zumindest in Düsseldorf wieder etwas stabilisiert, die Angebote funktionieren, wenn auch zumeist eingeschränkt. Unser langjähriger Kooperationspartner, die Altstadt-Armenküche, gibt täglich rund 300 Essen „to go“ unter freiem Himmel aus – ohne Witterungsschutz, weil sie ihre Gäste in die engen Räume nicht mehr hineinlassen können. Wir sehen auch deshalb eine massive Verelendung von Menschen, weil sie Einrichtungen und Unterkünfte meiden, nur eingeschränkten Zugang zu Duschen haben und ihre Wäsche nicht mehr regelmäßig waschen können. Wir dürfen uns aber nicht an diese Verelendung gewöhnen!
UZ: Rechnen Sie damit, dass sich die Situation im Winter noch weiter verschlimmern wird?
Julia von Lindern: Die Situation wird sich weiter verschärfen, denn es gibt beispielsweise keine neuen Suppenküchen, in denen Menschen witterungsgeschützt essen können. Und auch für den Tagesaufenthalt gibt es bislang keine Lösungen. Im Winter obdachlos zu sein, ist ohnehin schon lebensgefährlich – ohne die Möglichkeit, sich tagsüber aufzuwärmen, wird es noch gefährlicher. Wenn die Politik überall nicht umgehend reagiert, werden wir noch mehr Kältetote beklagen.
UZ: Und wie steht es um die medizinische Versorgung der Betroffenen, von denen ein Teil ja nicht einmal über eine Krankenversicherung verfügt?
Julia von Lindern: Der Gesundheitsschutz, der unter Pandemiebedinungen allgegenwärtig proklamiert wird, ist in der Obdachlosenhilfe kaum umsetzbar. Als vermeintlich einziges Mittel gegen die Übertragung wird schon mal die Quarantäne ganzer Unterkünfte angeordnet – ohne dass Menschen getestet werden oder sich tatsächlich in Isolation begeben können, weil die Einrichtungen nur Gemeinschaftsküchen oder -bäder haben.
UZ: Was muss die Politik denn tun, um besonders gefährdete Gruppen, wozu Wohnungslose aufgrund ihrer angeschlagenen Gesundheit gehören, zu schützen?
Julia von Lindern: Pandemie hin oder her – der beste Schutz sind immer noch die eigenen vier Wände. Dafür müssten Kommunen zuallererst aufhören, ihren Wohnungsbestand zu verkaufen, wieder selbst bauen und die absurden Renditeverlangen der Immobilienwirtschaft verbieten. Wohnen ist und bleibt ein Grundrecht.
UZ: Eine besondere Unterstützung aufgrund der Pandemie erhalten Sie von der Stadt oder dem Land nicht?
Julia von Lindern: Nein. Wohnungs- und Sozialpolitik wird immer noch nicht konsequent zusammengedacht.
UZ: Welche Auswirkungen hat die Pandemie auf die aufgrund des Winters anstehende Unterbringung von Wohnungslosen in Groß- und Massenunterkünften?
Julia von Lindern: Die Notschlafstellen mussten ihre Plätze reduzieren, um eine Unterbringung in Schlafsälen oder Mehrbettzimmern zu vermeiden. Dafür wurden dann von der Stadt Düsseldorf Ausweichquartiere von privaten Eigentümern angemietet, um eine annähernd ähnliche Platzzahl zu erreichen. Das ist ökonomischer Irrsinn und Folge der völlig verfehlten Wohnungspolitik.
UZ: Wäre dann nicht die Unterbringung in den derzeit eh nicht sonderlich frequentierten Hotels und Hostels eine Alternative, wodurch unter Umständen dann auch Arbeitsplätze in diesem Bereich gesichert werden könnten?
Julia von Lindern: Tatsächlich hat Düsseldorf sehr früh diesen Weg beschritten und Hotels angemietet. Die Rückmeldungen der dort untergebrachten Obdachlosen sind durchgängig gut – sie sind vor allem froh über ein Einzelzimmer. Das darf aber doch nicht unser Anspruch an die Wohnungslosenhilfe sein!
Unsere Arbeit ist dann erfolgreich, wenn wir Menschen dauerhaft in eine eigene Wohnung vermitteln, nicht in Notunterkünfte, Heime oder Hotels. Der Ansatz „Housing First“ ist unter Corona-Bedingungen wichtiger und richtiger denn je, denn nur so können sich diese ohnehin gefährdeten Personen real vor einer Infektion schützen.
UZ: Was genau versteht man unter dem „Housing-First“-Konzept?
Julia von Lindern: „Housing First“ bedeutet die Vermittlung direkt von der Straße in die eigene Wohnung, ohne Zwischenschritte oder Umwege. Die Menschen haben reguläre Mietverträge und alle Rechte und Pflichten, die damit einhergehen. Alle evidenzbasierten Untersuchungen zeigen den Erfolg dieses Ansatzes. In Städten mit einem Stufenmodell, also der schrittweisen Integration über Notschlafstellen, Wohnheime, Trainingswohnungen oder ähnlichem steigen die Zahlen der Obdachlosen, während sie in Städten mit „Housing First“ sinken. Denn „Housing First“ beendet Obdachlosigkeit im ersten Schritt.
UZ: Ist „Housing First“ nicht sogar wirtschaftlich betrachtet wesentlich günstiger, als horrende Kosten für überteuerte Wohnungslosenunterkünfte oder die Unterbringung in Hostels und Hotels zu finanzieren?
Julia von Lindern: Der ökonomische Aspekt sollte nicht im Vordergrund stehen, wenn wir über Hilfen für Menschen sprechen. Dennoch ist es richtig, dass der „Housing-First“-Ansatz nicht nur erfolgreicher ist als das Stufenmodell, sondern für die Städte auch günstiger. Dennoch gibt es enorme Widerstände, da Sozialarbeit über Jahrzehnte den erzieherischen Aspekt in den Vordergrund stellte. Noch heute ist ein gängiges Denkmuster, dass Obdachlose sich erst einmal beweisen sollen, wenn sie wirklich wohnen wollen. Das ist perfide und menschenverachtend.
UZ: In NRW engagiert sich die Volksinitiative „Für gesunde Krankenhäuser in NRW – für ALLE!“ für eine bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung. Gilt es da nicht anzudocken und auch die Bedürfnisse von Wohnungslosen verstärkt zu thematisieren?
Julia von Lindern: Die Aktivistinnen und Aktivisten, das Personal und die Gewerkschaften machen eine gute Arbeit und selbstverständlich sind wir solidarisch mit ihren Kämpfen. Und der Titel der Initiative meint bereits genau das Richtige: Gute Versorgung für Alle. Obdachlose Menschen sind also inbegriffen und sie brauchen keine Sonderbehandlung, nur weil die obdachlos sind. Eben genau diese – wenn auch ungewollte – Stigmatisierung versuchen wir im Alltag und im Umgang miteinander aufzulösen.
UZ: Welche Forderungen würden Sie dann mit Blick auf Ihre Arbeit aufstellen?
Julia von Lindern: Keine Wohnung zu haben bedeutet ja nicht, keine Rechte zu haben. Die Forderungen des Bündnissens sind richtig, mit oder ohne Wohnung. Wir sind eine Lobbyinitiative der Obdachlosenhilfe, und beide Kämpfe sind wichtig – der Kampf für gesunde Krankenhäuser und der Kampf gegen die Obdachlosigkeit. Es gibt noch viel zu tun!
Das Gespräch führte Markus Bernhardt



![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)