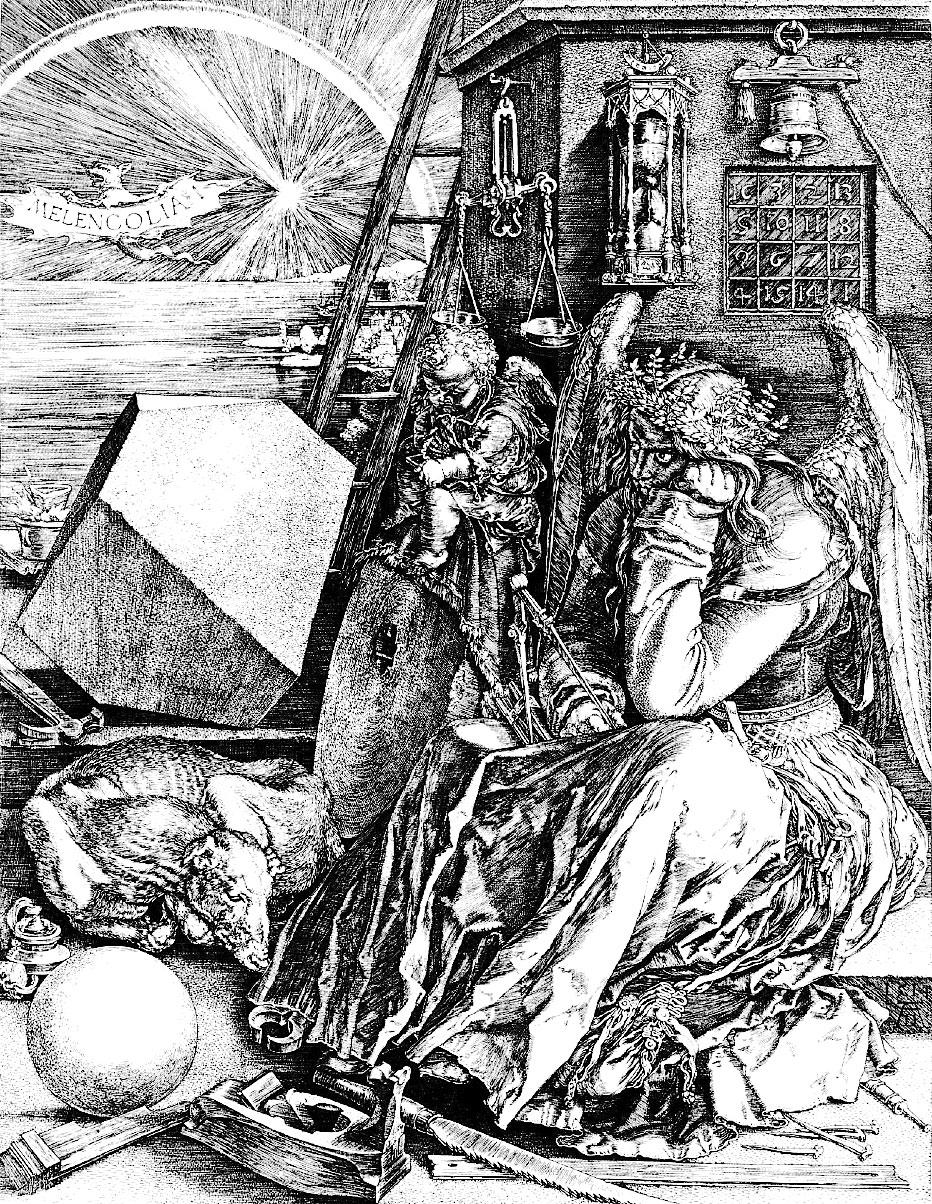Arbeit! Ostdeutsche Arbeitswelt im Wandel 1945–2015
Begleitbuch zur Ausstellung
Hrsg. von Paul Kaiser in Zusammenarbeit mit der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft und dem Dresdner Institut für Kulturstudien e. V., Dresden 2015, 326 S., 400 Abb., 35.- Euro
Vom Oktober bis zum Dezember 2015 gab es in Dresden die Ausstellung „Arbeit! Ostdeutsche Arbeitswelt im Wandel 1945–2015“. Die Veranstalter, das Dresdner Institut für Kulturstudien e. V. und die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft, gaben dazu eine respektablen, reich illustrierten Begleitband (Hrsg.: Dr. Paul Kaiser) heraus, der Beachtung verdient. Das betrifft insbesondere Bewertungen der Veränderungen von 1989. Bereits im Grußwort machen die Verfasser darauf aufmerksam, dass es sich in der Folgezeit „um einen dramatischen Sonderfall der Deindustrialisierung in einem hochindustrialisierten Land“ gehandelt habe. Der Begriff der Deindustrialisierung wird mehrfach in dem Band verwendet und als Ausgangspunkt der „extrem rasanten Verdrängung“ der Arbeiter aus der gesellschaftlichen Öffentlichkeit benannt (Michael Hofmann, Dieter Rink). In einem bemerkenswerten Beitrag weist Wolfgang Engler nach, dass die Folgen gravierend waren und „noch heute wahrnehmbar“ seien. Nachdem die DDR zusammenbrach und die Ostdeutschen fast ihr „Herrschaftssystem in die Knie“ gezwungen hätten – was allerdings nicht nur auf die Ostdeutschen zurückging, sondern auch von geplanten Aktionen anderer Art begleitet wurde –, hätten sie nicht verstehen können, wie sie, „Weltgeschichte schreibend“, unmittelbar danach in die „Rolle von Zaungästen des Geschehens, von Klienten des Sozialstaates“ verdrängt worden wären.
Sie hätten es begreifen können; oft genug hatten kluge Köpfe darauf hingewiesen, zuletzt am 4. November 1989 auf dem Alexanderplatz. Aber als Heiner Müller klarsichtig auf die kapitalistische Zukunft mit ihren katastrophalen Folgen verwies, schlug ihm „der Unmut der Massen“ (Engler) entgegen.
Stefan Wolle, der sich nach einer Relegation in der Produktion bewähren musste, es dann aber bis zum promovierten Mitarbeiter an der Akademie der Wissenschaften der DDR schaffte – was für ein schreckliches Land, dass seine Kritiker förderte und sie bis in die Kreise hoher Wissenschaftlichkeit führte –, musste feststellen, dass die neue kapitalistische Gesellschaft nach 1989 „einen beträchtlichen Prozentsatz der erwerbsfähigen Bevölkerung als nicht brauchbar“ ausgesondert habe: Das waren zum größten Teil nicht die Kritiker dieser neuen Gesellschaft, sondern die, die sie herbeidemonstriert hatten.
Folgt man diesen unterschiedlichen Argumentationen der Wissenschaftler, wird eines deutlich: Sie liefern durchweg Argumente, dass es sich 1989 um die Wiederherstellung alter Besitzverhältnisse und nicht um eine „friedliche Revolution“ handelte – eine Revolution verlangte nach Organisationsformen und gesellschaftlichen Entwürfen, die verwirklicht werden sollen, nicht nach der D-Mark –, dass eine reformierte DDR verhindert werden sollte, wie sie noch im Herbst 1989 möglich schien, dass der „Beitritt der ‚neuen Länder‘ zur Bundesrepublik“ (Engler) schnell erzwungen werden sollte.
Ergeben sich zu diesen wie auch zu anderen Beiträgen des quantitativ gewichtigen Bandes durchaus Anknüpfungspunkte zur Diskussion, so fällt der Aufsatz der französischen Wissenschaftlerin Sandrine Kott „Kurzer Triumph, langer Abschied – Vom ‚Bitterfelder Weg‘ zur ‚Kulturarbeit ohne Kultur‘“ deutlich heraus: Hier ist klarer und entschiedener Widerspruch angesagt; der Titel, der die Kunst in der Kultur der DDR negiert, lässt es ahnen. Die Autorin wurde in Paris promoviert und habilitiert, hat Untersuchungen zur Sozialgesetzgebung im deutschen Kaiserreich und anderes vorgelegt. Bei dem hier behandelten Gegenstand hat sie sich auf eine unzulässig geringe Materialgrundlage gestützt, die weder repräsentativ noch für den Gesamtvorgang aussagekräftig sind und zudem willkürlich ausgewählt. Das ist schlimm, denn es stellt ihre wissenschaftliche Reputation in Frage; schlimmer ist, dass ihre wissenschaftliche Gleichgültigkeit gegenüber dem Thema so groß war, dass sie vorhandenes und leicht zugängliches Material nicht zur Kenntnis genommen hat. Nicht einmal die in Lille (Frankreich) 2011 veröffentlichte umfangreiche Dokumentation zu dem Thema „Culture ouvrière/Arbeiterkultur“, herausgegeben von Dominique Herbet, dort hätte sie zu ihrem Thema wichtige Ergebnisse finden können.
Die wissenschaftlich ausgewiesene Kulturwissenschaftlerin hat grundlegende wissenschaftliche Methoden vernachlässigt – Arroganz, Oberflächlichkeit oder Voreingenommenheit? Es ist wohl vor allem Letzteres. Der Einstieg macht das deutlich: Obwohl die Verfasserin soziale Prozesse des 19. Jahrhunderts untersucht und festgestellt hat, dass die Sozialgesetzgebung um 1880 im deutschen Kaiserreich auf breite gesellschaftliche Vorgänge und nicht nur auf die Gesetzgebung von oben zurückging, lässt sie vergleichbare geschichtliche Entwicklungen beim aktuellen Thema außer Betracht und dekretiert die Bitterfelder Konferenz als „ein dezidiertes Bekenntnis zum Konzept einer genuin ‚sozialistischen Kunst‘“ Sie lenkt keinen Blick auf die Vorgänge Jahre zuvor, in denen sich Zirkel schreibender Arbeiter wie seit 1953 Deuben, Schwarza und Bitterfeld ohne Konferenz, sondern als Bedürfnis entwickelten. Weil es vor der Bitterfelder Konferenz schreibende Arbeiter gab, konnte die Bewegung entstehen; ihre Traditionen reichten in die zwanziger Jahre des 19. Jahrhunderts und zurück bis in die Zeit des Sozialistengesetzes.
Hinzu kam, dass die Häuser für Volkskunst und der Mitteldeutsche Verlag der nach Betreuung strebenden Schreibinteressierten nicht Herr wurden. Dass mit der Bitterfelder Konferenz ein groß angelegter Bildungsprozess für Werktätige eingeleitet wurde, der bei den schreibenden Arbeitern allenfalls beiläufig auch Kunstwerke zum Ziel hatte, aber zuerst Verständnis für Kunst anstrebte, ist der Autorin nicht aufgefallen. Sie hat, wie es scheint, auch die Dokumente der Bitterfelder Konferenzen nicht gelesen und nicht die Aussagen bedeutender Zirkelleiter und Schriftsteller wie Edith Bergner und Friedrich Döppe. Dass eine „Blütezeit der Reportage“ der Konferenz gefolgt sei, hat sie einschlägigen Publikationen westdeutscher Autoren entnommen, die ähnliche Kenntnisse wie sie hatten; ein Blick in die ersten Bände der Buchreihe „Ich schreibe“ (1960 ff.), nicht zu verwechseln mit der Fachzeitschrift für schreibende Arbeiter „Ich schreibe“, die die Autorin auch nicht kennt, hätte sie eines Besseren belehrt. Diese Bände sammelten Gedichte und autobiografische Erinnerungen, Erzählungen bewältigten die Vergangenheit des Zweiten Weltkrieges und beschrieben den Neuaufbau. Die „Deubener Blätter“ (1961), später vier Bände umfassend, beschrieben Lern- und Bildungsprozesse. Die Bewegung schreibender Arbeiter sei das „Paradebeispiel“ des Bitterfelder Weges gewesen; Kotts Meinung nach im „Zentrum“ habe das Brigadetagebuch gestanden. Das Brigadetagebuch hatte indessen nur sehr mittelbar damit zu tun, denn es war eine gewerkschaftliche Empfehlung für die Wettbewerbsführung und ein Dokument der gemeinsamen ökonomisch orientierten Leistung. Mit Literatur hatte es sehr wenig zu tun; allenfalls als Material und so wurden auch Auszüge in die Anthologien aufgenommen. Eine „‚sozial nützliche‘, neue Kunst“ war es niemals, es war Wettbewerbsdokument.
Die irrige Annahme verführte die Autorin dazu, Bitterfelder Weg und gewerkschaftliche Arbeit gleichzusetzen; von einem Zentralhaus für Kulturarbeit, Bezirkskabinetten für Kulturarbeit und ihren Aufgaben ist keine Rede. Zugehörige Beiräte beim Ministerium für Kultur sind ihr unbekannt. Von den Zirkeln schreibender Arbeiter nennt die Autorin einen aus Berlin, der in zentralen Statistiken von 1985 nicht geführt wurde. Dieser Zirkel war ein Zusammenschluss von Brigadetagebuch-Schreibern. Ihre Materialgrundlage besteht aus wenigen zufälligen Berliner Dokumenten: Den Zirkel wählte sie aus, weil die dazugehörige Brigade – niemals gehörte eine Brigade zu einem Zirkel – 1964 aufgelöst worden sei. Die profilbestimmenden Zirkel in Berlin, der in der Druckerei des „Neuen Deutschland“ und der im Haus der DSF, kennt die Autorin nicht; Analysen, die auswiesen, dass die Situation in Berlin „nicht dem Niveau der Hauptstadt angemessen“ sei, wurden nicht ausgewertet. Die Bezirke, in denen die Bewegung schreibender Arbeiter besonders leistungsstark und in Großbetrieben wirksam war – Halle, Dresden, Karl-Marx-Stadt –, werden nicht genannt.
Die Zirkel waren ein Zusammenschluss auf völlig freiwilliger Grundlage ohne jede Bedingung und Verpflichtung. Die Liste dessen, was in diesem Zusammenhang mitzuteilen wäre – von den Organisationsformen über die speziellen Bildungseinrichtungen wie die Elementarschule mit eigenen Lehrplänen bis zu mehrerer Ausgaben des „Handbuchs für schreibende Arbeiter“, das über die schreibenden Arbeiter hinaus große Verbreitung erlebte, ist lang; nicht ein einziger Posten wird von der Autorin erwähnt, wie auch keine einzige Anthologie, keine Buchveröffentlichung, kein Autorenname, obwohl sich manche inzwischen einen großen Namen gemacht haben wie der Träger des Deutschen Buchpreises von 2014, Lutz Seiler.
Die Rolle der Zirkelleiter, ausgewiesene Wissenschaftler, Journalisten und Schriftsteller, wird reduziert auf angeblich meistens weibliche „Klubleiterinnen und Bibliothekarinnen“, die das kulturelle Leben in den Betrieben aufrechterhalten hätten. Die zahllosen Leerstellen in diesem Beitrag entstanden, weil auf Material mit „DDR-offizieller Darstellung“ verzichtet und die Literaturgeschichte zur DDR-Literatur als „offizielle DDR-Literaturgeschichte“ bezeichnet, entsprechend willkürlich ausgewählt und uminterpretiert wurde. Verwendet wurden auch nicht Zentralhaus-Analysen, die Fachzeitschrift, die Dokumente der Volkskunstkonferenzen, die bedeutende Konferenz 1984 in Unterwellenborn mit ihrer zweiteiligen Dokumentation, geschichtliche Abrisse und die statistischen Materialien der Bezirkskabinette, die literatursoziologischen Untersuchungen (Sommer/Löffler u. a.: Leseerfahrung Lebenserfahrung, 1983) usw.
Bei der Beurteilung des Bitterfelder Weges ist es methodisch zwingend, mit Beteiligten zu sprechen, wie es andere Wissenschaftler, der US-Amerikaner William James Waltz für seine Dissertation „The Movement of Writing Workers in the German Democratic Republic“ (2014) und die Germanistin Anne Sokoll, in den zurückliegenden Jahren für ihre grundlegenden Veröffentlichungen zum Bitterfelder Weg taten. Beide Autoren wurden von Sandrine Kott auch nicht zur Kenntnis genommen. So wundert es nicht, dass die von westlichen Kulturwissenschaftlern stereotyp vorgetragene Behauptung vom Ende des Bitterfelder Weges wiederholt wird; bei Kott beginnt das Ende sogar schon 1961. Die von ihr behauptete Absage an „eine ausschließlich politisch engagierte Laienkunst“ hat aber nie stattgefunden, weil es die Forderung nach dieser Laienkunst nie gegeben hat.
Von den literarischen Leistungsvergleichen „Ein gutes Wort zur guten Tat“ hat die Autorin noch nie etwas gehört, sonst hätte sie den Begriff der Laienkunst nicht in den Mund genommen. Die Zahl der Zirkel nahm ihrer Meinung nach ab und sank angeblich schon 1975 auf 270; sie sagt aber kein Wort zu den seit den siebziger Jahren zahlreich werdenden Zirkeln schreibender Schüler und Jugendlicher, die Zirkel der Polizei, NVA usw., die in den Statistiken des Zentralhauses nicht erfasst wurden; sie sagt auch nichts zu den sich hinzugesellenden Gruppen wie Lyrikclubs, Poetenseminare, Bezirkszentren für Autoren usw. Von Zirkeln, die bis in das neue Jahrtausend hinein bestanden und bestehen, weiß sie ebenfalls nichts.
Die Arbeiterfestspiele werden wegen an ihnen geäußerter Kritiken erwähnt, der FDGB-Kunstpreis geradezu diffamiert. Die intensive Beziehung der Schriftsteller zu den Zirkeln und dem Bitterfelder Weg erscheint lediglich in der Bemerkung, Peter Hacks sei froh gewesen, kein FDGB-Literaturpreisträger zu sein; der Grund für diese Äußerung wurde nicht erfragt. Christa Wolfs nachdrückliches Bekenntnis zum Bitterfelder Weg, „dass viele von uns, dem vielgeschmähten ‚Bitterfelder Weg‘ folgend, in Betrieben waren, Freundschaften schlossen, Einblick bekamen in ökonomische Prozesse und Widersprüche“, fehlt ebenso wie auch vergleichbare Aussagen Heiner Müllers, Joachim Rähmers und vieler anderer. Dafür war die Autorin beständig auf der Suche nach Konfliktsituationen und Enttäuschungen; sie wurden dann als Beispiel für die Gesamtsituation genommen. Einzelne richtige Ergebnisse werden uminterpretiert, bis sie in dieses Raster passten. Es ist kein Wunder, dass die „Hypothese“ der Autorin am Schluss geradezu widersinnig ist: Die betriebliche Kulturarbeit sei durch einen „erweiterten Kulturbegriff“ entideologisiert worden, weil es „zahlreiches Konfliktpotential zwischen Gewerkschaftlern und Künstlern, zwischen Arbeitern oder Leitungskadern“ usw. gegeben habe; eine „harmlose Sozial- und Freizeitpolitik“ sei dafür angestrebt worden. „Diese Praxen bewirkten eine trügerische Stabilisierung des Regimes, aber im Grunde trugen sie jeden Tag dazu bei, seine Legitimität zu untergraben.“ Danach waren die Kulturpolitik der DDR und wohl letztlich der Bitterfelder Weg am Zusammenbruch der DDR schuld. Das sollte man ihnen nun wirklich nicht anlasten.



![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)