Schreibenwollen als das Werk selbst: „Sagen, dass man schreiben will, wird damit selbst zum Stoff des Schreibens“, heißt es in Roland Barthes Vorlesungsband „Die Vorbereitung des Romans“. Barthes nennt Beispiele der klassischen Moderne, die Autopoeten Rainer-Maria Rilke und Marcel Proust. Die „Briefe an einen jungen Dichter“ und „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ sind, so Barthes, paradox, sie sollen am Buchende beginnen, wo sie doch bereits schließen.
Auch Ronya Othmanns zweiter Roman „Vierundsiebzig“ ist ein Ausdruck des Schreibenwollens. Anders aber als bei Proust und Rilke steht nicht der angestrebte Anfang am Ende, vielmehr hat Othmanns Roman weder Anfang, noch Mitte, noch Ende, weil er kein Roman ist: „Was ich schreibe hat keine Ordnung. Worte, Sätze, die abbrechen, im Nichts verlaufen. Ich nähe, ich füge zusammen“, heißt es auf den ersten Seiten. „Ich habe keine Sprache“, schreibt sie beziehungsweise die Ich-Erzählerin, die sich mit der Autorin Namen und biografische Eckdaten teilt, kurz darauf und widerspricht sich damit weitgehend selbst, wenn sie weiter vorn bar jeder Ausführung des von ihr Behaupteten festhält: „Jedes Schreiben ist für mich Fiktion. Ob ich über mich schreibe, meinen Vater, meine Großmutter oder eine Figur, der ich einen Namen gebe und eine Geschichte.“ Klingt danach, als setze da jemand im Voraus zum Block an, weil man den Angriff ahnt, der jene treffen mag, die das Hemingwaysche Credo „Write what you know“ verabsolutieren und eben genau das tun und nicht mehr: Aufschreiben. Das mag man dann als Roman betiteln, so wie man Jack Kerouacs „On the Road“ als Roman bezeichnet; was Leute davon abhält, ihr Buch als Reportage zu klassifizieren, ist damit aber nicht beantwortet. Othmanns „Vierundsiebzig“ ist genau das: eine riesige Reportage.
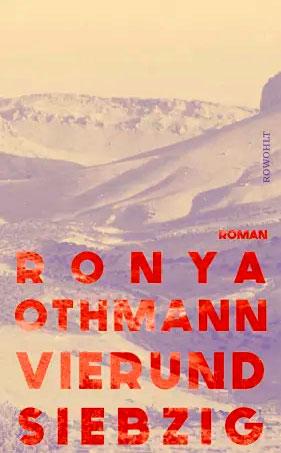
Als solche hat sie ihren Wert. Othmann trägt – kommentiert und mit Haltung versehen – zusammen, was ihre Recherchen zum Genozid an den Jesiden durch den sogenannten Islamischen Staat ergeben haben. Und das ist einiges.
Sie interviewt Vian Dakhil, kurdisch-jesidische Parlamentarierin im Irak, deren Rede im August 2014 weltweit für Aufsehen sorgte. Othmann wohnt Gerichtsverhandlungen bei: Rückkehrerinnen und Rückkehrern nach Deutschland wird der Prozess für ihre Verbrechen als IS-Angehörige gemacht. Frauen und Männer, die Jesidinnen als Sklavinnen kauften, hielten und weiterverkauften, Kinder bei brütender Hitze im Innenhof anketteten, bis diese starben, und sich aktiv am Völkermord an der jesidischen Bevölkerung 2014 im Nordirak beteiligten.
Unendliches Grauen im Kalifat der Gotteskrieger: In Anbetracht des Abschlachtens von Menschen jedes Alters und der systematischen Vergewaltigung jesidischer Frauen gerät Othmann wieder und wieder ins Stocken, formuliert Absätze um, hinterfragt ihr eigenes Schreibverhalten und ihr Verhalten an sich, habe sie doch durchaus überlegt, Deutschland zu verlassen und in den Kampf gegen den IS zu ziehen.
Sprache als Utopie: Ist sie bei Rilke und Proust auf Umwegen erreichter Sehnsuchtsort, dann wird sie bei Othmann grundsätzlich infrage gestellt. Sprache als Vermittlung, als Mittel zum Miteinander – an der Gesellschaftsfähigkeit des Menschen mag man bei all den Gräueln durchaus zweifeln, die Postmoderne spricht sich dafür ja allenthalben aus. Othmann schildert ihre Rechercheergebnisse aus der Bibliothek, schließlich werden Jesiden nicht erst seit der Ausbreitung des Syrienkriegs auf eine ganze Weltregion verfolgt. Seit Jahrhunderten gelten sie als Teufelsanbeter, von denen man hierzulande meist nicht mehr weiß als das, was Karl May über sie schrieb. Das Jesidentum selbst bleibt in Anbetracht der Drangsal im Kastensystem verhaftet, Jesiden wie Ronya Othmanns Vater, der eine Deutsche heiratete, werden des „weißen Genozids“ bezichtigt, der dazu führe, dass die Kultur auch ohne Massenmord ausstürbe. „Ich denke daran, was mein Vater oft sagt: In zwei, drei Generationen gibt es uns nicht mehr.“
Hier kommt die Reportage einem Roman am nächsten: Im Vater-Tochter-Konflikt. Ersterer ist Atheist, wurde als Kommunist gefoltert und schaut bei all der Erschütterung über das Grauen, das seine Verwandten und die Jesiden erleiden mussten, mit Verachtung auf Religion und Tradition. Seine Tochter muss ihn bei Reisen in den Irak gemahnen, dass Jesiden keine blaue Kleidung tragen, gilt doch die Farbe als heilig. Ein Generationenkonflikt: „Wir haben viel gelacht im türkischen Gefängnis, sagt mein Vater. Wir haben die ganze Nacht gelacht. Und wenn es Tag wurde, gezittert, wer kommt heute dran? (…) Schreibe ich über das Lachen meines Vaters, wenn er vom türkischen Gefängnis erzählt, schreibe ich über mein Lachen, wenn eine Freundin mich fragt, wie die Situation für die Êzîden gerade sei, bringe ich das eine mit dem anderen in Verbindung. Mein Vater aber war 1980 im türkischen Gefängnis, ich war 2018 im Irak, vier Jahre nach dem Genozid. Das türkische Gefängnis und der Genozid. Das sind verschiedene Dinge.“ Diese Dinge in ein Verhältnis zu setzen wird mit „Vierundsiebzig“ versucht – mittels Sprache, mittels Reise. Auch wenn man bei der Recherche, dem Festhalten, stehenbleibt, ist auch das ein Anfang: „Ich trenne die Nähte wieder auf und fange von vorne an.“
Ronya Othmann
Vierundsiebzig
Rowohlt-Verlag, 512 Seiten, 26 Euro


![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)





