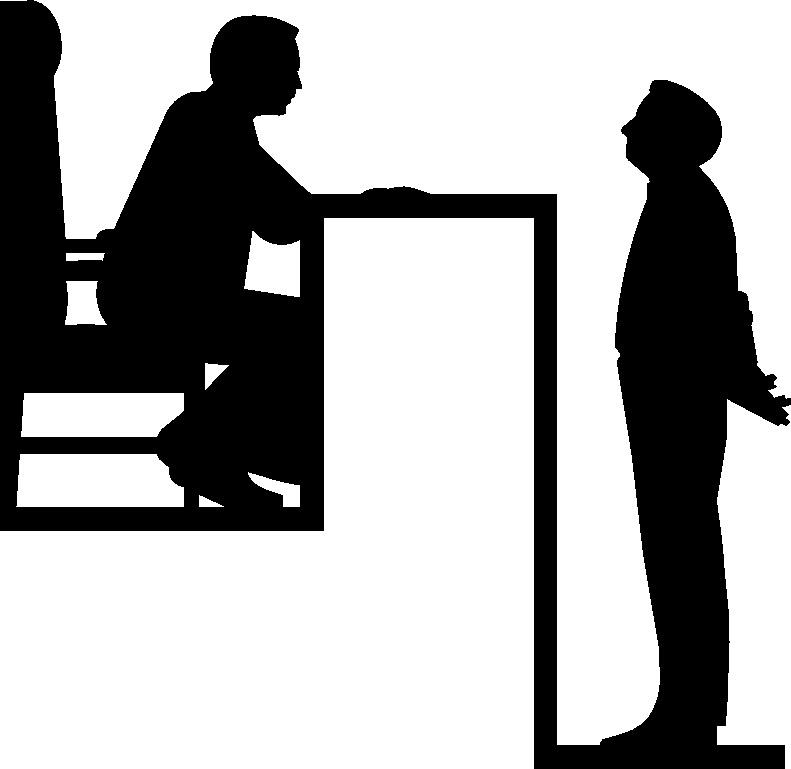Alle schauen zur Zeit in die USA und entrüsten sich über den Polizeimord an dem Afroamerikaner George Floyd. Allzu gerne wird dabei der Rassismus in Deutschland übersehen. Seit 2001 starben mindestens zwölf Schwarze bei der Verhaftung oder in Haft. Offizielle Zahlen gibt es nicht und viele Fälle sind bis heute nicht aufgeklärt. Doch fängt der Rassismus nicht bei Mord an, sondern endet hier. UZ sprach mit Maria Peters, die eigentlich anders heißt, über den alltäglichen Rassismus in Deutschland.
UZ: Alle schauen in die USA, aber Rassismus ist auch in Deutschland nicht fremd. Hast du da mit Erfahrungen gemacht?
Maria Peters: Ja, angefangen hat es in der Schule. Ich wurde von Mitschülern auf Grund meiner Hautfarbe gemobbt und Lehrer schritten nicht ein. Erst wenn die Eltern sich einschalten oder man beim Schulsozialarbeiter landet, kommt es zur Sprache. Oft wird dann versucht zu beschwichtigen: das sind ja Kinder, die entwickeln sich noch und Kinder streiten sich ja auch.
Aber auch zum Beispiel in der S-Bahn: Der Kontrolleur geht am Biodeutschen vorbei und kontrolliert mich und wartet extra, dass ich meinen Personalausweis raushole. Mein Name klingt deutsch und dann denkt sich der Kontrolleur, die fährt bestimmt mit dem Semesterticket einer Kommilitonin. Wenn weiße Deutsche dabei sind, dann passiert mir das fast nie, dass ich meinen Perso zücken muss.
Ich kann verstehen, dass mein Name ungewöhnlich ist für eine Schwarze. Ich habe dadurch auch Vorteile, zum Beispiel bei Bewerbungen, bei Ämtern oder bei der Wohnungssuche. Wenn mich aber die Leute dann in Person sehen, gibt es immer einen Kommentar dazu: „Ach, Sie sehen ja gar nicht aus wie eine Maria.“ Ja, die meisten Marias sehen halt aus wie ein Grabstein.
UZ: Hast du nicht nur mit negativem Rassismus, sondern auch mit positivem Rassismus zu tun gehabt?
Maria Peters: Sprüche wie, „Sie sprechen aber gut Deutsch“, „Sie sind ja schwarz, dann ist das okay“ oder „So gute Noten für eine schwarze Frau“, höre ich oft. Oder Menschen versuchen sich vor mir zu rechtfertigen mit Sprüchen, wie „Ich habe auch schwarze Freunde“.
UZ: Hast du auch mit Klischees zu kämpfen? Zum Beispiel im Club? Schwarze Frauen sind leicht zu haben?
Maria Peters: Ja, total. Ich bin keine große Clubgängerin, weil die Erfahrungen, die ich gemacht habe, schon absurd waren. Von blöden Witzen, bei denen ich mir denke, darauf habe ich jetzt gar keinen Bock, bis zu dummen Anmachen. Manchmal ist es aber schwer zu differenzieren. Ist das so, weil ich eine Frau bin, oder weil ich eine schwarze Frau bin.
UZ: Hattest du schon aufgrund deiner Hautfarbe schlechte Erfahrungen mit der Polizei?
Maria Peters: Ich wohne in einem „sozial schwachen“ Viertel, wie es offiziell heißt. Dort fahren die Polizei und die zentrale Ausländerbehörde regelmäßig herum und kontrollieren die Menschen. Zu Beginn der Corona-Maßnahmen war ich mit meiner Mitbewohnerin in einem Park im Viertel. Dort halten sich viele ausländisch aussehende Leute auf, aber auch Menschen, bei denen man jetzt nicht denkt, die sind irgendwie ausländisch. Eine deutsche Familie mit Kindern wurde nicht angesprochen, dass man nicht auf den Spielplatz darf, sondern meine Mitbewohnerin und ich, die keine Kinder haben.
Aber vor allem kenne ich das von meinem Bruder. Zum Beispiel war er mal mit seinen Freunden feiern. Die Polizei kam und kontrollierte die Gäste. Der eine Beamte stand zwischen meinem Bruder und seiner Jacke. Mein Bruder sagte dem Beamten wiederholt, dass er seine Jacke brauche, weil da sein Personalausweis drin sei. Der Beamte ist dann richtig rabiat geworden und hat meinen Bruder am Hals gepackt und gegen die Wand gedrückt. Mein Bruder war der Einzige, der nicht weiß war, und derjenige, der wirklich extra hart angegangen worden ist.
Ein anderes Beispiel von meinem Bruder wäre, wenn er mit seinen Freunden unterwegs ist und sie haben Gras zum Eigenkonsum dabei, dann nimmt das wie selbstverständlich nicht der Schwarze mit dem Afro an sich, sondern ein deutscher Freund.
UZ: Man gewöhnt sich mit der Zeit an den Alltagsrassismus?
Maria Peters: Um ehrlich zu sein, sind das einfach so Sachen, an die man sich irgendwann gewöhnt. Es bringt mir nichts, wenn ich zum x-ten Mal auf etwas beharre. Man verinnerlicht irgendwie selber, was „deutsch“ ist und was nicht. Dem kann man nicht entgehen.
Traurig, aber ratsam ist, wenn Eltern die Möglichkeit haben, ihre migrantischen Wurzeln zu verschleiern und dem Kind einen deutschen Vornamen geben und den deutschen Nachnamen aus der Beziehung nehmen. Trotzdem ist es ein Problem in dieser Gesellschaft, dass so was tatsächlich einen realen positiven Effekt an vielerlei Stellen hat.
Es werden immer noch Bilder propagiert, welche Eigenschaften schwarze Menschen haben: Alle können tanzen und haben Rhythmus im Blut, bis hin zu lasziven Frauen und aggressiven Männern. Weshalb mein Bruder eine sehr deeskalierende Ader hat und wenn es um offizielle Sachen geht – sei es irgendein Amt oder im Umgang mit der Polizei – sofort nachgibt, auch wenn er unrechtmäßig behandelt wird.
Das Gespräch führte Christoph Hentschel



![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)