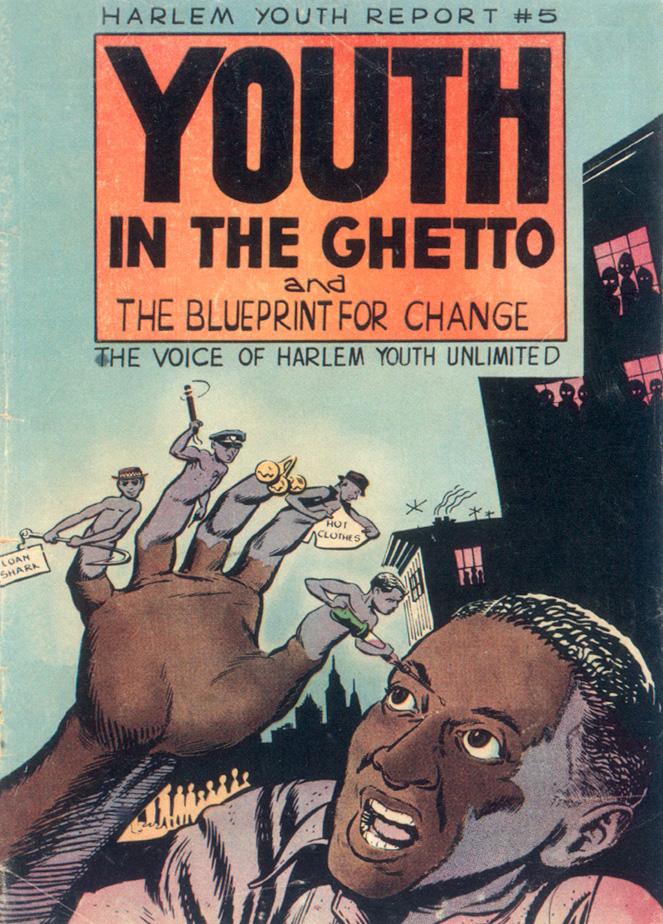In seinem Artikel „Wann blüht das Wasser?“ in der Ausgabe 1/2020 von „Melodie & Rhythmus“ bezieht sich Dietmar Dath auf Erich Köhlers Erzählung „Im Paradies“ als Aussicht auf eine globale Wandlung, unterschieden von einer wiederhergestellten vorindustriellen Idylle. Ich danke Dietmar Dath, dass er mir einen Impuls gegeben hat, Erich Köhlers Werk in Erinnerung zu rufen – oder wohl eher: überhaupt wieder bekannt zu machen. „Was mich betrifft, so bin ich mit der DDR untergegangen. Der Aufforderung, mich mit einer neuen Art Ankunftsliteratur (Ankunft im bürgerlichen Alltag) herauszumachen, kann ich nicht folgen.“ So einen musste man ja abwickeln. Der PEN tat hier das Seine. Dem Vergessen stellt sich seine Frau Petra mit etlichen Getreuen und der Erich-Köhler-Stiftung entgegen.
Ich lernte Erich Köhler als Redakteurin der „Kommunistischen Arbeiterzeitung“ kennen. Er hatte uns sein Buch „Sture und das deutsche Herz“ zur Rezension zugeschickt. An dieser versuchte ich mich zu Beginn des Jahres 1991. Aus dem Briefwechsel und späterer persönlicher Bekanntschaft entstand eine tiefe Freundschaft. In einem seiner ersten Briefe schrieb er mir: „Es ist sinnlos, kein Kommunist zu sein.“ Das war 1991, als die Niederlage des Fortschritts vernichtend schien.
Erich Köhler, geboren 1928 in Karlsbad, gestorben 2003 in Alt Zauche im Spreewald, studierte am Bergtechnikum zu Freiberg (Sachsen), arbeitete dann im Uranerzbergbau. Später wurde er Mitbegründer einer Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft in Mecklenburg. „Neben der Landarbeit betätigte ich mich literarisch, studierte am Literaturinstitut Johannes R. Becher in Leipzig und erwarb ein einschlägiges Diplom der Leipziger Karl-Marx-Universität“, schreibt er über sein literarisches Schaffen. Er ist Träger des Heinrich-Mann-Preises 1977 der Akademie der Künste.
Von den Angehörigen der schreibenden Zunft forderte er, sich nicht auf Tantiemen auszuruhen und sich als etwas Besseres zu fühlen, sondern als Angestellte einer arbeitenden Einheit zu leben. „Die Kunst geht nach Brot/wohin geht der Künstler?“ fragt er zu Beginn von „Paralipomena“, seiner wohl grundsätzlichstem Überlegung zu Funktion und Stellenwert der Schriftstellerei: „Ohne Machtausübung durch die Arbeiterklasse mittels ihres Staates, so gut oder schlecht dieser funktionieren mag, ohne grundsätzliche Abschaffung des Kapitalismus als Herrschafts- und Lebensform ist die Welt nicht zu retten. Das alles wissen oder ahnen die kritischen Schöngeister des Westens. Sie kennen die Alternative, aber die ist ihnen unbehaglich. Sie verwerfen das Alte, aber fürchten das Neue als Zwangsjacke. Und sie malen drei Kreuze dorthin, wo in ihren Werken der Name des historisch Neuen stehen müsste. Und so suchen sie bekümmert nach einem dritten, angenehmeren Weg, den es nicht gibt.“ Vom sozialistischen Dichter fordert er literarischen Avantgardismus. Realismus, also „das Wesen der Diktatur der Arbeiterklasse auf allen Gebieten des Lebens so schlecht und recht darzustellen wie diese Diktatur gerade praktiziert wird“, reicht nicht. Avantgardist ist der Dichter, der sich mit der Bewegung identifiziert, wenn „Volksmassen ihr Leben bewusst gestalten mit dem Ziel, Verhältnisse, in denen der Mensch ein betrogenes, geknechtetes, erniedrigtes Wesen ist, zu überwinden“ und er selber hierauf mit Kunst und Person Einfluss nimmt.
Die DDR verteidigte er glühend ob ihrer Errungenschaften für die Menschen und geißelte sie nicht minder für ihre Beschränktheit: „Was nützt uns dieser vulgäre Materialismus? Was nützt der ständig steigende Lebensstandard, wenn er zur Verfettung, zur geistigen Trägheit führt?
Radikal positioniert er sich mit „Nichts gegen Homer“, mir einer seiner liebsten Texte. Der schlachtentümmelnden Ilias des Homer stellt er Hesiod gegenüber, der in seinen Versen den Ackerbau, den Bau einer Pflugschar besingt.
„Landläufig wirkt die Auffassung, das Homerische, das ist die rhapsodische Darstellungskraft allhin. So wurde Goethe von seinen Zeitgenossen als gewaltiger Homeride begriffen, dabei war er doch seiner ganzen Natur nach ein hesiodischer Dichter. Homerisch ist, auf heutigen Jargon gebracht, wenn Fäuste auf Kinnbacken krachen, Stahl gegen Stahl fetzt, das Dach überm Kopf brennt. … Hesiod lebte um die gleiche Zeit wie Homer. Um wieviel bescheidener nehmen sich seine Ermahnungen zur Arbeit und Gerechtigkeit in dem schmalen Gedicht ‚Werke und Tage’ aus. Kaum wagt man, das ein Epos zu nennen. Zu einer Zeit, in der die Zurückeroberung eines Weibes, die Zerstörung einer Stadt, die Wiederherstellung einer Königsehre so berichtenswert erschien, plagt sich Hesiod in seinen Versen mit der Anleitung zum Bau von Pfluggeräten und der Auswahl agrotechnisch günstiger Termine herum. Da passiert nichts, als dass in einer Welt voller Kriegsgeschrei von gemeiner Arbeit die Rede ist. … Ohne Zweifel erscheint uns der Kampf um Patroklos’ Leiche auf der Trojaebene spektakulärer als Hesiods Beschreibung richtigen Pflügens. Die Einschleusung eines hohlen Holzpferdes wirkt heute noch sensationeller als das Lied von der friedlichen Erntearbeit bei Hesiod. Jedenfalls ist der Bericht vom Trojanischen Pferd die erste journalistisch gefärbte Ausbeutung einer Sensation, vergleichbar heute mit dem Einsatz von Hubschraubern im gegnerischen Hinterland. Wir stehen staunend vor der Geburt jener Literatur vom „Äktschn“-Typ. Es änderten sich nur die Mittel, nicht der Zweck. Homer war ihr Riesenvater, und wenn diese Art von Literatur immer noch anklingt, dann durch seine Titanenkraft, nicht aber durch sittlichen Wandel. Die proletarisch tradierte Literatur der Arbeit hat es schwerer als die Kriegsliteratur. Hier lassen sich mangelnder Tiefgang, poetische Schwächen, ungenügende Konsequenz nicht durch Feldgeschrei kaschieren. Literarische Grundforschung auf dem Felde der Arbeit, Planung und Leitung ist so unbequem wie Hesiods Ermahnung zur Ehrlichkeit.“
Frau von der Leyen und der neue EU-Außenbeauftragte Josep Borrell lassen es derweilen schon mal krachen und fetzen: „Europa muss auch die Sprache der Macht lernen.“

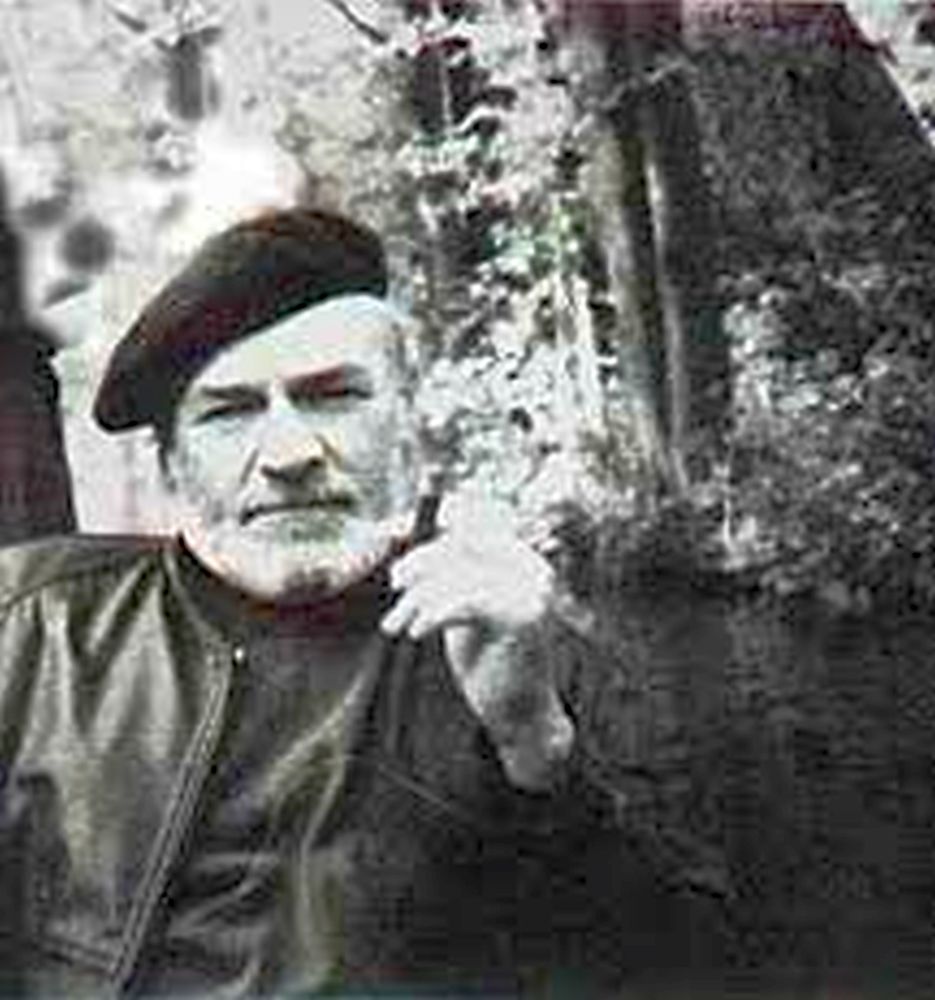

![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)