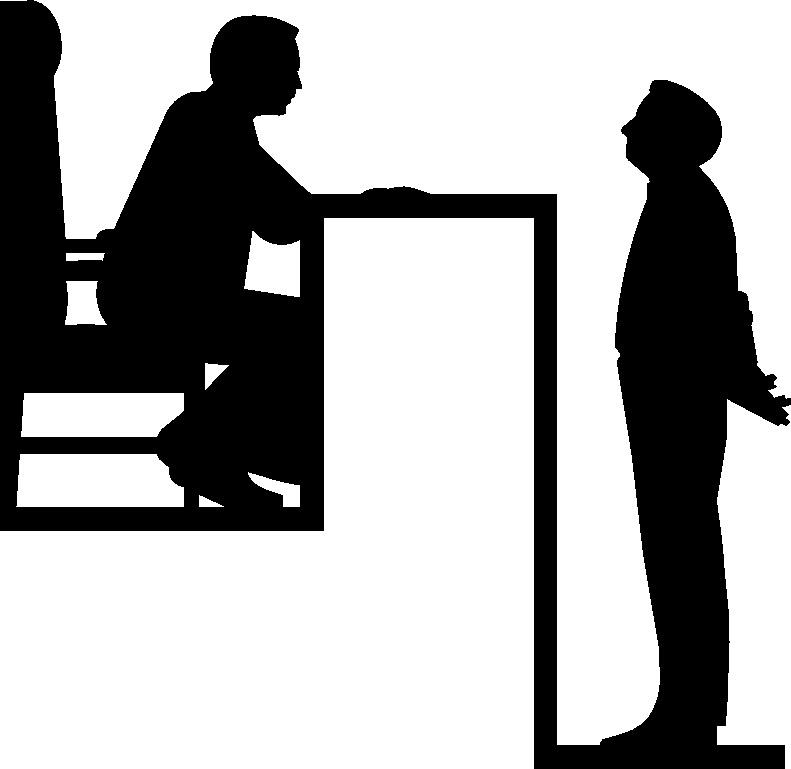Die bürgerliche Debatte über die Verkehrswende ist auf eine seltsame Art verfahren. Sie findet fernab einer Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Verhältnissen statt. Stattdessen werden Pappkameraden aufgestellt und mit großem Tamtam zerschlagen. Im Oktober vergangenen Jahres ließ sich Springers „Welt“ dazu hinreißen, vom „Selbstmord der autogerechten Stadt“ zu schreiben, in der die in „Kolonnen eingepferchten Wagenlenker (…) ihre Wut an Polizisten und Sanitätern auslassen“ und „aggressive Radfahrer auf Automobilisten losgehen“. Die moralische Ausrufung ersetzt auch auf der Gegenseite den politischen Diskurs, wenn „der Autofahrer“ zum verwerflich handelnden Stereotypen gebrandmarkt wird. Es ist notwendig, den motorisierten Individualverkehr (MIV) zurückzudrängen, um Klima und Gesundheit zu schützen. Doch es ist ein Irrweg, dies durch einen Mobilitätsverzicht erreichen zu wollen.
Friedrich Engels erkannte in seiner Schrift „Zur Wohnungsfrage“ den engen Zusammenhang zwischen industrieller Produktionsweise, Wohnungssituation und Mobilität. Er wies alle Vorschläge zurück, die die Wohnungsfrage durch eine Rückkehr zur Scholle zu lösen versuchten. „Für unsere großstädtischen Arbeiter“, so schrieb er, „ist Freiheit der Bewegung erste Lebensbedingung und Grundbesitz kann ihnen nur Fessel sein.“ Ebenso wie es keinen Weg zurück zur lebenslangen Sesshaftigkeit mehr gibt, so kann eine fortschrittliche Verkehrswende auch nicht zurück zum Handkarren führen. Einerseits hängen die Teilhabe an Kultur und Gemeinschaft, der Zugang zu Bildung, Gesundheit und Unterhaltung in hohem Maße vom persönlichen Bewegungsradius ab. Dieser Radius wird hauptsächlich durch den Geldbeutel bestimmt. Mit zunehmender Armut ist eine wachsende Zahl von Menschen, die sich weder Auto noch Bahn leisten können, ausgeschlossen. Anderseits steigt mit sinkender Mobilität die Abhängigkeit von örtlichen Strukturen, insbesondere vom örtlichen Arbeitsmarkt. Die Position der Lohnarbeiter im Arbeitskampf wird geschwächt. Klassenbewusste Verkehrspolitik erscheint paradox: sie muss mehr Mobilität für den Einzelnen fordern und zugleich den motorisierten Verkehr drastisch reduzieren.
Dies kann gelingen, wenn die Wege verkürzt werden: durch eine geschickte Stadtplanung, die einen schnellen Zugang zu Wohnung, Arbeit und Versorgung absichert. Noch wichtiger ist der kurzfristige Ausbau von öffentlichen Verkehren. Sie können die benötigte Flexibilität sicherstellen und zugleich das Grundrecht auf Mobilität gewährleisten. Besonders für den öffentlichen Nahverkehr muss gelten, dass er hoch getaktet, maximal vernetzt, emissionsarm und für die Nutzer kostenlos sein soll. Letzteres ist eine progressive Forderung: der Mobilitäts-Ausschluss wird verhindert, der Umstieg vom MIV erleichtert. Doch der kostenlose ÖPNV ist kein Selbstzweck und es ist nicht egal, wie er gestaltet wird. Man darf sich nicht wundern, wenn „Verkehrswende“ und „Ticketfreiheit“ in Kürze ausgegraben werden, um die Tarifverhandlungen im Nahverkehr zu behindern. Wenn die steigenden Kosten als Vorwand dienen, um Löhne zu drücken und Privatisierungen voranzutreiben, besteht die Gefahr, dass Klimaschutz und Arbeitskampf gegeneinander ausgespielt werden.
Es gilt, den Kampf für eine klimaneutrale Verkehrswende mit den Forderungen nach mehr Mobilität, besseren Arbeitsbedingungen und sozialen Rechten zu verbinden. Dafür darf die Finanzierung des ÖPNV-Ausbaus nicht den Kommunen aufgebürdet werden, da dies nur zu weiteren Einschnitten und Privatisierungen führt. Stattdessen braucht es Geld vom Bund. Das steht zur Verfügung, wenn die Rüstungsausgaben reduziert und Vermögen besteuert werden. Für die Verkehrswende lassen sich viele gute politische Ansätze finden, ganz ohne Moralkeule.


![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)