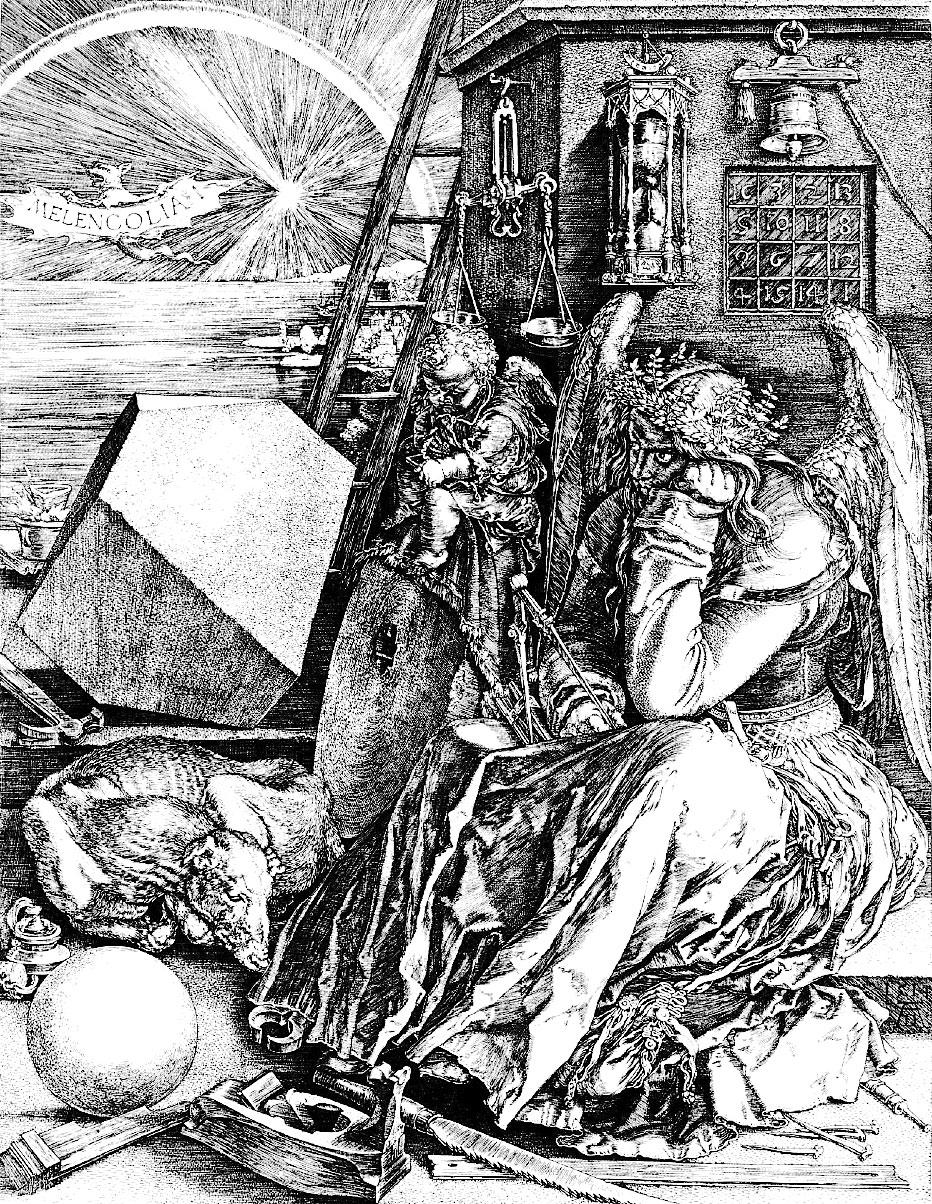Ein Jahr nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs fand in auf dem Längenberg vom 5. bis 8. September 1915 die „Konferenz von Zimmerwald“ statt. Angesichts des bis dahin größten Gemetzels der Geschichte sollte dort diskutiert werden, wie europäische SozialistInnen wieder gemeinsam für den Frieden kämpfen können. Obwohl die sozialistischen Parteien in internationalen Konferenzen zuvor beschlossen hatten, in jedem Fall gegen Krieg zu stimmen, hatten 1914 etliche dieser Parteien die Vereinbarungen missachtet und in den nationalen Parlamenten für Kriegskredite sowie die Beteiligung ihrer Länder am Krieg votiert.
In Zimmerwald trafen sich 1915 38 Delegierte aus Parteien und Organisationen, in denen zumeist Minderheiten sich weiterhin konsequent und aktiv gegen den Krieg engagierten und die sich somit von den Mehrheiten, den anderen sozialdemokratischen Parteien und ihrer „Burgfriedenspolitik“ distanzierten. Organisiert wurde die damalige Konferenz vom Schweizer Sozialdemokraten Robert Grimm; bekannt wurde sie insbesondere aufgrund der Teilnahme des später erfolgreichen kommunistischen Revolutionärs Lenin.
Proletarische Solidarität oder Burgfrieden?
Aus Anlass des 100. Jahrestags der Konferenz von Zimmerwald wurde im Berner Volkshaus, wo auch die damalige Konferenz ihren Ausgang genommen hatte, von der Schweizer Robert-Grimm-Gesellschaft und von „Arbeit und Bildung Bern“ am 4. und 5. September 2015 eine Tagung organisiert unter dem Titel „Die internationale Bewegung der Arbeiterinnen und Arbeiter gegen den Krieg“. Unterstützt wurden sie von einem breiten Spektrum von Organisationen, das von der SP Schweiz über den Schweizerischen Gewerkschaftsbund, die JUSOs bis zu den deutschen Rosa Luxemburg- und Marx-Engels-Stiftungen reichte.
Der Freitag war den historischen Ereignissen gewidmet. Nach einleitenden Referaten beleuchteten Workshops einzelne Aspekte genauer, z. B. die Auswirkungen der Konferenz von Zimmerwald auf die damalige österreichische Arbeiterbewegung oder auch einzelne Exponentinnen wie die russisch-italienische Revolutionärin Angelica Balabanoff.
Vor allem aber wurde diskutiert, inwiefern die damalige und die heutige Situation vergleichbar seien und welche der früheren Lehren auch heute noch zutreffen. Die damaligen Konferenz-TeilnehmerInnen hatten einstimmig ein Manifest verabschiedet, in dem es hieß: „Welches auch immer die Wahrheit über die unmittelbare Verantwortung für den Ausbruch dieses Krieges sei – das eine steht fest: Der Krieg, der dieses Chaos erzeugte, ist die Folge des Imperialismus, des Strebens der kapitalistischen Klassen jeder Nation, ihre Profitgier durch die Ausbeutung der menschlichen Arbeit und der Naturschätze des ganzen Erdballs zu nähren. Wirtschaftlich rückständige oder politisch schwache Nationen fallen dabei der Unterjochung durch die Großmächte anheim, die in diesem Kriege versuchen, die Weltkarte ihrem Ausbeutungsinteresse entsprechend mit Blut und Eisen neu zu gestalten.“
Diskussion um neues Manifest zeigt alte Differenzen
„Europa ohne Krieg. Wie kommen wir dieser Utopie näher“, „Imperialismus gestern und heute“ oder „Internationale Solidarität und linke Friedenspolitik“ hießen entsprechend die Workshops. Im zuletzt genannten wurde vor allem diskutiert, welche Differenzen zwischen den Teilnehmenden bestehen. Der Manifestentwurf „Gegen Krieg und Gewalt – für Frieden und menschliche Sicherheit“, den die vorbereitende Arbeitsgruppe mehrheitlich vorgeschlagen hatte, wurde von den Anwesenden kritisiert, weil er im Unterschied zu dem vor hundert Jahren beschlossenen Manifest die Ursachen von Kriegen ausblendete, das Handeln „neuartiger Akteure“ beschrieb, aber deren Herkunft im Dunklen ließ. In einem anderen Manifest-Vorschlag hieß es stattdessen: „Heute, 100 Jahre später, müssen wir feststellen, dass weltweit so viele Menschen auf der Flucht sind wie seit dem 2. Weltkrieg nicht mehr. Kriege, für wirtschaftliche und geostrategische Interessen geführt, breiten sich mit immenser Geschwindigkeit aus. Hunderttausende Tote und Verwundete, Millionen Flüchtlinge, noch mehr Hunger, Armut und Gewalt sind die Folgen: im Nahen und Mittleren Osten, in Afghanistan, in Afrika.“
Kontrovers diskutiert wurde auch die Frage, warum in Europa fast fünfzig Jahre lang „nur“ ein kalter Krieg stattfand. Während die einen „nicht zuletzt dank der Existenz einer Systemalternative in Gestalt der sozialistischen Staaten fast fünfzig Jahre Frieden“ konstatierten, sahen die anderen vor allem die Europäische Union als Friedensbringerin. Entgegnet wurde ihnen, dass, abgesehen von deren aktueller verheerender Austeritätspolitik, in den grundlegenden Verträgen der EU die Mitgliedsstaaten sowohl zur Aufrüstung verpflichtet als auch auf den Kapitalismus als Wirtschaftsordnung festgelegt werden. In der Diskussion wurde der Neoliberalismus als Wurzel heutiger Probleme benannt und grundlegende Änderungen am Wirtschaftssystem gefordert. „Wir brauchen die 1,35 Billionen Euro, die jedes Jahr weltweit für Rüstung ausgegeben werden – 72 Prozent davon von den Mitgliedsstaaten der NATO! –, für die Überwindung von Hunger und Armut, für Ökologie und Bildung. Die globalen Herausforderungen, die uns und unseren Planeten bedrohen, sind ohne Abrüstung, ohne Frieden nicht zu bewältigen“, hieß es entsprechend im Entwurf der VertreterInnen der Marx-Engels-Stiftung („Gemeinsam für den Frieden!“).
Sie und die GSOA in ihrer Erklärung „Militär-Interventionismus ist Krieg, der zu noch mehr Kriegen führt“ kritisierten außerdem die idealistisch begründete Befürwortung von Armee-Einsätzen im ursprünglich vorgelegten Entwurf. Dagegen wurde von ihnen und in einem JUSO-Papier wie ehemals im Manifest der Konferenz von Zimmerwald das Selbstbestimmungsrecht der Völker gefordert: „Kriege müssen verhindert beziehungsweise gestoppt werden, damit Friedenspolitik möglich wird. Krieg darf kein Mittel sozialistischer Politik sein.“
Eine neue Konferenz von Kiental 2016 ist nötig
Am Samstag wurde die Diskussion auf einem Podium mit TeilnehmerInnen aus verschiedenen Ländern Europas unter dem Titel „Die internationale Bewegung der Arbeiter und Arbeiterinnen für den Frieden, heute und morgen“ fortgesetzt. Dabei wurden die grundlegenden Differenzen wiederum deutlich. Während SP-Präsident Christian Levrat die heutige Sozialdemokratie als Garantin für den Frieden bezeichnete, wurde dies von anderen mit Hinweis auf beispielsweise die deutsche Sozialdemokratie bezweifelt. „Wir brauchen kein Flickwerk des Heutigen, sondern einen Bruch mit dieser Politik“, forderte der französische Diskutant Jean-Pierre Brard.
Auch wenn alle linken Organisationen für den Frieden sind: Um sich auf eine gemeinsame Position zu verständigen, braucht es noch viele Diskussionen und gemeinsame Aktionen. Die Arbeit der Konferenz von Zimmerwald wurde im April 1916 in Kiental fortgesetzt.
Zuerst erschienen in der Berner „Online-Zeitung“ journal-b:
http://www.journal-b.ch/de/082013/kultur/2116/Kann-die-Linke-aus-ihrer-Geschichte-lernen.htm


![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)