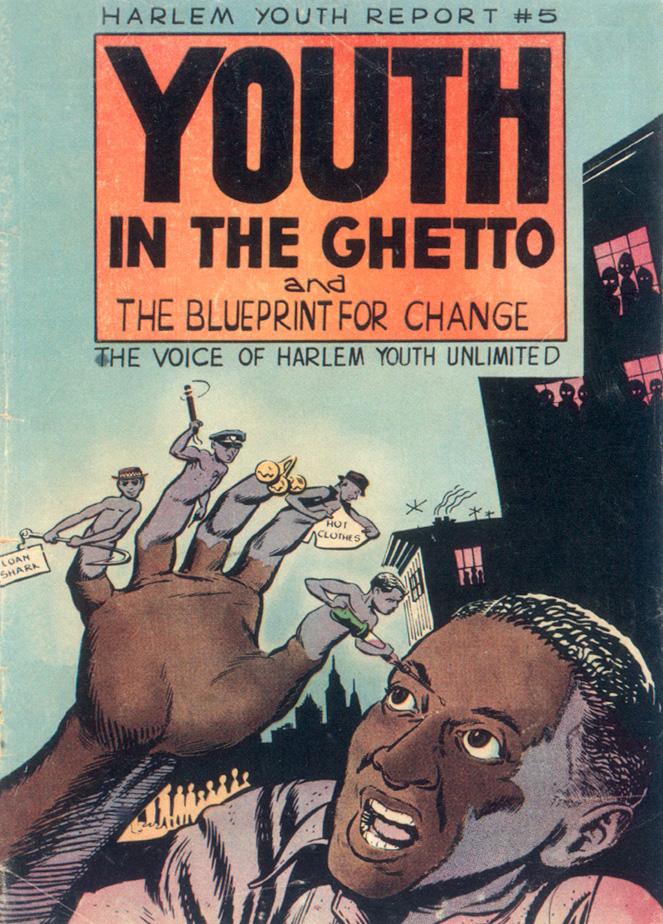Bruce Dickinson hat wieder lange Haare. Sie sind jetzt fast weiß, neu ausgewachsen, als der zweiundsechzigjährige Sänger der englischen Heavy-Metal-Band „Iron Maiden“, die‘s jetzt auch schon seit fünfundvierzig Jahren gibt, eine Weile in relativer Abgeschiedenheit verbringen musste. Bei allem Rockstarkomfort ging es ihm also wie den meisten seiner Kernfans, deren neu über sie gekommene individuelle und kollektive Isolation zwei Namen trägt: „Seuchenbekämpfungsmaßnahmen“ und „Brexit“. Bruce Dickinson weiß, dass beides viele härter trifft als ihn; er hat die Leute, die morgens zur ungeliebten Arbeit gehen müssen, wenn sie nicht entlassen wurden, immer im Auge behalten, nie war er ein im Besserverdienerhorizont gefangener „Tattoed Millionaire“, wie eine Soloplatte heißt, die er 1990 aufgenommen hat. Sein aufmerksamer Umgang mit der Fanbasis gleicht dem von Steve Harris, Bassist und Hauptsongautor der Band, die wir Fans kurz „Maiden“ nennen (gern in stundenlangen Sprechchören). Fußball und Krawallmusik pflegt Harris beharrlich, zwei Sozialtatsachen, die das Kulturleben der englischen Arbeiterklasse prägen. Außer der Kultur dieser Klasse kann man auch deren Moral bei „Maiden“ finden, zum Beispiel als Teamgeist in der Auswechselpraxis: Dickinson hat einst den Vorgänger Paul DiAnno beerbt, war später eine Weile lang weg, in der ihn Baze Bayley nicht schlecht vertrat, und kam dann wieder mit dem ebenfalls zwischendurch abwesenden Gitarristen Adrian Smith, bei dessen Rückkehr Janick Gers, den man an seiner Stelle aufgenommen hatte, nicht gefeuert wurde – gut, dann gibt’s jetzt halt drei Gitarristen, der Arbeitsplatz muss ja nicht gestrichen werden. Würden mehrere Sänger und Schlagzeuger nicht zu viel Klangverwirrung stiften, stünden bei „Maiden“ mittlerweile ein Haufen Leute auf der Bühne.
Wie Arbeiter leben solche Rockmusiker natürlich trotzdem nicht, die Erschöpfung der Ausgebeuteten und die Langeweile des Erwerbslebens bleiben ihnen erspart. Dickinson hat einen Pilotenschein, kann fechten wie ein Profi und schreibt Bücher, öde wird das kaum. Dass es aber zum Beispiel eine Kritik an der EU geben kann, die nicht auf Fremdenhass gegründet ist, sondern sich erinnert, dass Leute mit einer Herkunft wie der von Dickinson (Mutter Verkäuferin, Vater Mechaniker fürs Militär) der Bourgeoisie im Nationalstaatsrahmen ein paar wichtige Rechte und Freiheiten abgetrotzt haben, hat er bei Gelegenheit klar artikuliert – aufregendes Leben muss nicht kindsköpfig machen. „Erwachsenwerden“ heißt im Kapitalismus normalerweise nicht, dass man die je eigenen Fähigkeiten erkennt, entwickelt und entfaltet (Fechten, Fliegen …). Jugend soll vielmehr in Unmündigkeit und Rauschzuständen, unter Rangkämpfen und Erwerb von Statusmüll, ein Dasein üben, das nur aus Kaufen und (Sich-)Verkaufen besteht. Dann ertönt irgendwann ein Gong der Hölle und man ist volljährig, die Piercingprinzessin mit den blauen Haaren kriegt ihr erstes Kind und muss von da an in ständiger ökonomischer Existenzangst irgendwelchen Bossen schmeicheln, während der gleichaltrige, mürrische Heavy-Metal-Krieger sich fürs Vorstellungsgespräch die Haare schneidet.
Jugend- und Gegenkulturen im Kapitalismus, auch die NWOBHM (New Wave of British Heavy Metal), aus der „Iron Maiden“ hervorgingen, sind der Versuch, den instinktiven Hass der Jugend auf diese ganze trostlose Scheiße über den intensiven Einzelmoment (Song, Konzert) hinaus zu verstetigen. Leider heißt „Verstetigung“ da oft nur „Verspießerung“ (so entstehen die läppischen „Berufsjugendlichen“ der Kulturindustrie). Dafür können die Jugend- und Gegenkulturen freilich nichts; das eigentliche Problem lässt sich halt grundsätzlich nicht kulturell lösen. Energie, Ermutigung, Euphorie aber kann schöner Lärm, wie Maiden ihn machen, allemal abwerfen, und das mag auch dem Klassenkampf zugute kommen. Möge die Kraft dazu wachsen – wie Dickinsons Haare im harten Winter, den wir gerade aushalten müssen.



![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)