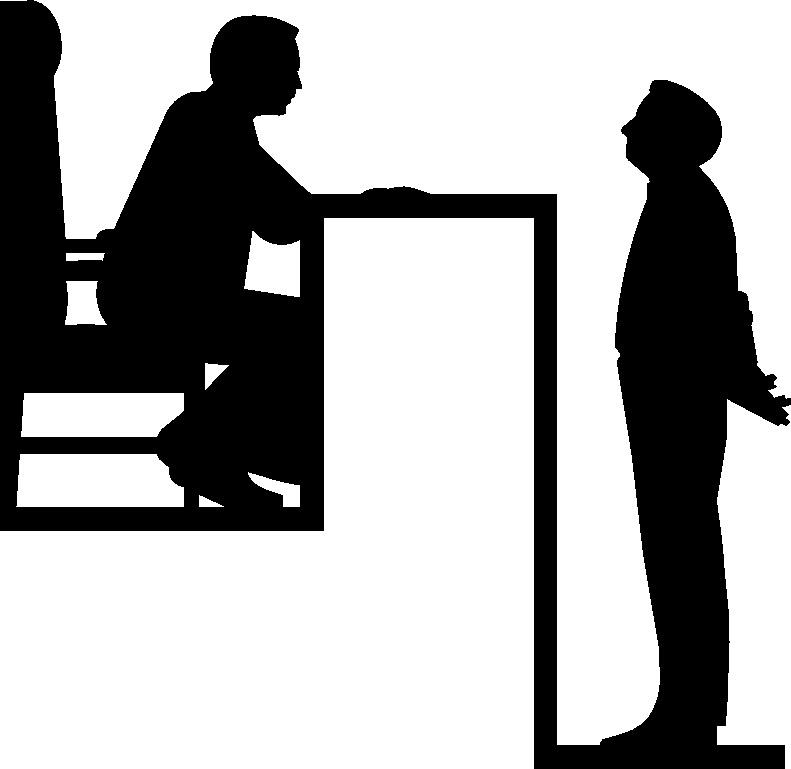Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig erkannte einem heute 56-jährigen Berliner eine Entschädigung wegen Traumatisierung und psychischer Schäden zu, die er 1988 infolge seiner Flucht nach West-Berlin erlitten hatte. Das Gericht begründete das Urteil unter anderem damit, dass die Grenzsicherung der DDR „rechtsstaatswidrig“ gewesen sei. „Die zur Verhinderung eines bestimmten Grenzübertritts ausgelösten Grenzsicherungsmaßnahmen der DDR waren hoheitliche Maßnahmen, die sich konkret und individuell gegen den Betroffenen – hier den Kläger – richteten. Sie waren rechtsstaatswidrig, weil sie in schwerwiegender Weise gegen die Prinzipien der Gerechtigkeit und der Verhältnismäßigkeit verstießen und Willkürakte im Einzelfall darstellten“, heißt es in der Pressemitteilung.
Es scheint mit den Geschichtskenntnissen der Richter nicht weit her zu sein. Die Grenze der DDR zu Westberlin – wie auch die zur Bundesrepublik Deutschland – war die Staatsgrenze eines souveränen Staates. Dass diese zudem nach dem 13. August 1961 besonders gesichert wurde, hatte Ursachen. Seit Gründung der DDR warb die zuvor gegründete Bundesrepublik massenhaft Fachleute ab. Auch anderweitig versuchten die Kapitalisten mitten in der Hochphase des Kalten Krieges vor allem von West-Berlin und der Bundesrepublik Deutschland aus, die DDR wirtschaftlich und politisch zu destabilisieren. Der damalige sowjetische Staats- und Parteichef Nikita Chrustschow erklärte in einem internen Gespräch mit Walter Ulbricht am 30. Mai 1964 über die Ursachen der Grenzschließung: „Die Hauptsache war doch, die Stabilität der DDR zu sichern.“ Es gab, an der Grenze zwischen zwei gegensätzlichen Gesellschaftssystemen und Militärpakten, eine ständige militärische Bedrohung. Die politische und wirtschaftliche Stabilität der DDR und die Abwendung militärischer Konflikte, die Sicherung des Friedens, lag nicht nur im Interesse der DDR, sondern auch im dem der anderen europäischen Staaten in West wie Ost, vor allem aber der Sowjetunion. Deren Führung bestimmte weitgehend die Sicherung der Grenze nach außen und innen. Und daran änderte sich bis zum Ende der 1980er Jahre nichts.
Das Bundesverwaltungsgericht unterstellt – ganz im Sinne der bisherigen Rechtsprechung seit 1991 und der medialen Kampagnen zum bevorstehenden Jahrestag der Grenzöffnung im November 1989 –, dass es in der DDR in Fragen der Grenzsicherung nicht „rechtsstaatlich“ zugegangen sei. Die DDR hatte gesetzliche Regelungen: ein Grenzgesetz, Bestimmungen im Strafgesetzbuch über die Strafbarkeit von Grenzdurchbrüchen, Regelungen für die legale Ausreise – auch wenn Letztere nach der Unterzeichnung der Helsinki-Schlussakte 1975, in der die zwischenstaatlichen Beziehungen geregelt wurden, hätte korrigiert werden müssen.
Die DDR hatte – nach internationalem Bestimmungen – als souveräner Staat das Recht, ihre Grenze zu schützen. Doch nicht erst seit dem Anschluss der DDR wird genau das bestritten, immer wieder und auch bis heute von einer „innerdeutschen Grenze“ gesprochen, obgleich im Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen zwischen der BRD und der DDR vom 21. Dezember 1972 beide deutsche Staaten in Artikel 6 wechselseitig anerkannten, dass sich ihre Hoheitsgebiete jeweils nur auf das eigene Staatsgebiet beschränkte. Sie sicherten zu, „die Unabhängigkeit und Selbständigkeit jedes der beiden Staaten in seinen inneren und äußeren Angelegenheiten zu respektieren“. Doch das ist – soweit in der alten Bundesrepublik überhaupt respektiert – schon lange Geschichte.


![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)