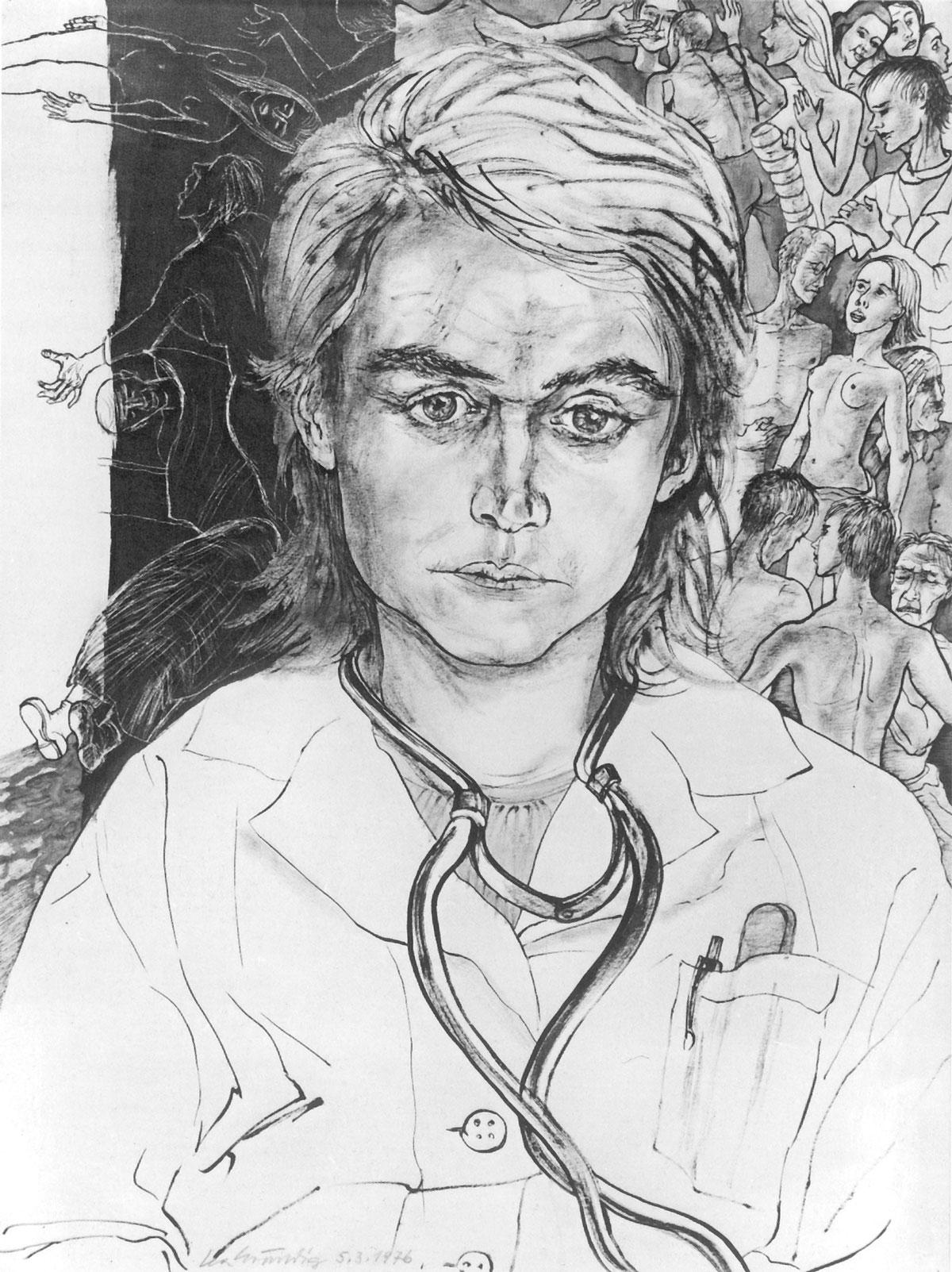Jenny Erpenbeck
Gehen, ging, gegangen.
Roman. München 2015, Albrecht Knaus Verlag, 352 S., 19,99 Euro
Jenny Erpenbecks neuer Roman gehört zu den beeindruckenden Büchern dieses Jahres; es ist vielleicht das wichtigste Buch des Jahres überhaupt. Das liegt nicht allein an seiner außergewöhnlichen Aktualität, doch trägt die Thematik von Flucht und Flüchtlingen dazu bei. Die Autorin nahm sie auf als noch nicht abzusehen war, dass sich dieses Thema zu einem beherrschenden der gegenwärtigen europäischen Politik entwickeln würde.
Diese brennende Aktualität darf nicht den Blick auf die herausragende literarische Qualität des Romans verstellen. Der Roman nimmt die Sprache als ein beherrschendes Merkmal des Themas Flucht auf und führt es durch. Bereits der Titel mit seiner grammatischen Prägung – ein Infinitiv und zwei Stammformen – macht das deutlich; im Verlauf des Romans wird er mehrfach variiert (sehen – sah – gesehen; verderben – verdarb – verdorben; sitzen – saß – gesessen) und bezeichnet das Umfeld der Flüchtlinge. Der Titel wird zum Leitmotiv und lässt das Nachdenken über Sprache präsent bleiben, sogar eine bildliche Darstellung der Sprache – Flüchtlinge spielen Sprachformen – wird versucht. Sie ist das entscheidende Medium für Verständigung und Verständnis und ihr Erwerb sollte die wichtigste Aufgabe des Flüchtlings sein.
Jenny Erpenbeck wurde von Flucht und Exil geprägt: Ihr Vater John Erpenbeck, ein bekannter Wissenschaftler und

Schriftsteller, wurde in Ufa (Sowjetunion) geboren. Seine Eltern, die Schriftsteller Fritz Erpenbeck und Hedda Zinner, waren 1933 vor den Nazis über Zwischenstationen in die Sowjetunion geflohen und hatten sich dort bis zum Kriegsende aufgehalten. Jenny Erpenbeck sagte in einem Gespräch: „In meiner Familiengeschichte ist das Thema Flucht immer präsent gewesen.“
Flucht ist das Thema ihres neuen Romans. Dabei geht es ihr nicht um den Umgang mit Flüchtlingsströmen, sondern sie geht der Frage nach, was die Menschen taten und wie sie lebten, bevor sie zu Flüchtlingen wurden. Sie geht den Einzelschicksalen nach und sucht dort die Auswirkung nationaler Katastrophen. Deren Ursachen schimmern durch; die Bomben der Europäer auf Libyen – das wichtigste Herkunftsland der Flüchtlinge im Roman – lösten eine der Bewegungen aus, Gaddafi schickte Boote mit Schwarzen („with blacks“, S. 238), um so Europa zu bombardieren. Die wirklichen Verursacher, die verbrecherischen Kriege der USA im Irak und in Syrien, wo durch sie der IS entstand, und der daraus entstehende Flüchtlingsstrom aus Syrien war während der Entstehung des Romans noch kein Thema. Gegen Ende wird schließlich eine Liste von Veränderungen zusammengestellt, durch die Flüchtlingsströme verhindert werden könnten: Es ist ein Katalog weltpolitischer Grundprobleme, die Flüchtlingsströme auslösten, von Korruption über Nationalismus, religiöse Terroristen bis zur Politik der USA. Unaufdringlich, aber konsequent wird auf eine Verpflichtung der Deutschen aufmerksam gemacht, die die Autorin für sich auf Grund der Familiengeschichte in Anspruch nimmt. Die Hauptgestalt Richard wird durch die Flüchtlinge erinnert. „Es ist noch gar nicht so lange her … da war die Geschichte der Auswanderung und der Suche nach Glück eine deutsche Geschichte.“ Es ist auch seine Geschichte; ein Schmuckstück der Familie – es wird bei einem Einbruch gestohlen – ist ein Ring der Mutter, „den sie auf der Flucht von Schlesien nach Berlin mitgenommen hat“ (S. 314).
Der gerade emeritierte Professor für Alte Philologie Richard – die Frau ist gestorben, Kinder hat er keine, die Geliebte, eine überflüssige und störende Gestalt, hat ihn verlassen, das alles dient als Kunstgriff, um ihn einsam und also aufnahmebereit für andere Menschen vorzustellen – sieht sich 2013 mit der Neugestaltung seines Tagesablaufs, mit einem anderen Ablauf von Zeit konfrontiert. Nun kann er lesen – Dostojewski und Proust vor allem, auch Dantes „Göttliche Komödie“ –, er kann Musik hören, sich mit Freunden treffen, spazieren gehen, er könnte auch der Bequemlichkeit verfallen, sieht aber darin die Gefahr eines beginnenden Sterbens. Der Blick aus dem Fenster auf einen See lässt die Frage nach Leben und Tod gegenwärtig bleiben, denn er erinnert daran, dass in diesem See im Sommer ein Schwimmer ertrunken ist, dessen Leiche man bisher nicht gefunden hat. Der Tote wird zur Beunruhigung, denn es stellen sich Richard Fragen, was ihm selbst noch als Lebenszeit bleibt und wie er in dieser Zeit auf andere Menschen eingehen soll, denn der Tote im See hätte gerettet werden können, wenn die in seiner Nähe befindlichen Ruderer sein Winken als Hilferuf und nicht als Scherz verstanden hätten.
Gewöhnung wäre Bedrohung. Um ihr zu entgehen, nimmt Richard bewusster als zuvor auf, was um ihn geschieht. Auf dem Weg zu Ausschachtungen, bei denen ein unbekanntes unterirdisches Kellersystem Berlins entdeckt wurde, trifft er auf demonstrierende Afrikaner, Flüchtlinge, die Essen und Trinken verweigern, weil sie arbeiten wollen. Eine zweite Motivation, neben dem Toten im See, wird geschaffen, denn das unterirdische Kellersystem erinnert an das Kellersystem der polnischen Kleinstadt Rzeszów, in das sich Juden flüchteten, bis die Nazis „Rauch in die Gänge“ leiteten: Die Keller erinnern an Vergangenheit, Kriege und Verbrechen; sie verpflichten in der Gegenwart. Der emeritierte Professor Richard kommt dieser Verpflichtung nach: Geradezu wissenschaftlich, wie er sich bisher den alten Sprachen gewidmet hat, gestaltet er sein Projekt des Umgangs mit Flüchtlingen. Er führt Gespräche über die Gründe für ihre Flucht und erfährt von bestialischen Verbrechen, deren Opfer sie und ihre Familien wurden, er unterrichtet sie in deutscher Sprache – der Professor wird zum Sprachlehrer, er sorgt sich um Beschäftigungen für die Flüchtlinge, lässt Osaboro, den Mann aus Niger, bei sich Klavier spielen und Rufu aus Burkina Faso Dantes „Göttliche Komödie“ lesen. Er stellt fest, dass er aus einem Menschen „mit den großen Hoffnungen für die Menschheit“ (S. 217), die er vor der Wende 1989 hatte, zu einem Almosengeber geworden ist, der beinahe „gründlich alle Hoffnungen verloren“ (S. 217) hat, womit Dante auch bei ihm anklingt: „Lasst, die ihr eingeht, jede Hoffnung fahren“ (Göttliche Komödie, Hölle 3, Vers 9). Es gilt, die eigenen Hoffnungen in dieser neuen Zeit nicht völlig zu verlieren und anderen Menschen Hoffnung zu geben, wenn sie sie benötigen: Er kauft für einen der Flüchtlinge in Ghana ein Grundstück, bringt Kranke zum Arzt und gibt anderen, soweit es für ihn möglich ist, Arbeit, sie begründet ihre Hoffnungen. Schließlich aber sollen fast alle nach Italien zurückgeschickt werden; dort sei man für ihr Asyl zuständig. Private Unterbringungsbemühungen beginnen, bei der Kirche, bei Richards Freunden und bei ihm selbst, dessen Haus als Heimunterkunft anerkannt wird. Das utopisch erscheinende Ende, entstanden aus der Selbstlosigkeit Richards und seiner Freunde, ist mehr Frage als Wirklichkeit, die Frage danach, was jeder zu leisten bereit ist, wenn es um das Gleichgewicht der Pyramide geht.
Beiläufig werden auch jene Fragen beantwortet, die vorschnell zu falschen Urteilen führen. Die bei allen vorhandenen Mobiltelefone – nicht alle sind modern – werden benötigt, um sich zu retten, zu orientieren und Verbindung mit der Familie zu halten; sie sind oft der einzige Besitz der Flüchtlinge und überlebensnotwendig, aber kein Ausweis von Reichtum. Der Roman beschreibt ein Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Flucht, zwischen möglicher Hilfe und Überforderung, zwischen Hilfe und Undankbarkeit, zwischen individueller Leistung und staatlicher Bürokratie – sie ist der entscheidende Grund für das Versagen der Flüchtlingspolitik. Wie fragil dieses Gleichgewicht ist, wird an einem beeindruckenden Symbol verdeutlicht: Auf einer Weihnachtspyramide als Sinnbild des Ausgleichs zwischen Christus und Morgenland, Menschen und Tieren, Himmel und „unter Tage“ (S. 232) kommen selbst Engel ins Wanken, wenn nicht alles „sorgfältig austariert“ ist. Die Betrachter der Pyramide sind deren lebendige Realität: „der atheistische Richard, der eine evangelische Mutter gehabt hat, mit seinem muslimischen Gast vor dem illuminierten, heidnischen Weihnachtsbaum“ (S. 234).
In der Diskussion um das Buch gab es kritische Stimmen, z. B. im Deutschlandfunk, die ihm literarische Qualität absprachen, es für zu journalistisch hielten, zumal es Bekanntes wiederhole. Man spürte die Absicht, das Buch wegen der Thematik und ihrer Behandlung zu denunzieren. Dabei ist es voll erzählerischen Glanzes: Flüchtlinge erzählen ihre Geschichte in einem sich endlos wiederholenden Kreislauf, der schon im Erzählen die tödliche Gefahr einbringt: Die Wiederholung von Abläufen wird stereotyp erzählt und wirkt lähmend, soll so wirken (S. 136 ff.): Es geht „viele, viele Male im Kreis“ (S. 136). Manches mutet fortwährend wiederholt wie ein altes Epos an: „Ein Mann denkt daran, wie … „ (S. 343 f.) Mythen klingen an und werden unter dem Eindruck der Flüchtlinge neu gelesen: Am Atlasgebirge, „wo heute Marokko“ ist, stemmte Atlas Himmel und Erde auseinander, damit Uranos nicht wieder Gaia, der Erde, „Gewalt antut“; aber es herrscht Gewalt. Dabei vollzieht sich für den Professor Wichtiges. Was er gelehrt hat, griechische Mythologie, wird durch das neue Wissen verändert, es „mischt sich wieder alles anders und neu“ (S. 177). Iphigenie erscheint als Emigrantin. Unterschiedliche Kulturen treffen aufeinander und korrespondieren, nicht problemlos miteinander. Sogar ein Einbruch des Flüchtlings Osarobo bei Richard, der ihm geholfen hat, scheint möglich.
Der Roman – bezieht man die umfangreiche Danksagung ein ist es fast ein Gemeinschaftswerk aus vielen Erfahrungen – ist kein lauter Aufruf zur Hilfe, sondern die stille, am Ende idealisierte Beschreibung des Helfens, aus der sich Anleitungen zum Handeln ableiten lassen. Er hat das schwierige und keineswegs konfliktfreie Thema differenziert und klar bewältigt und literarisch meisterlich gestaltet.