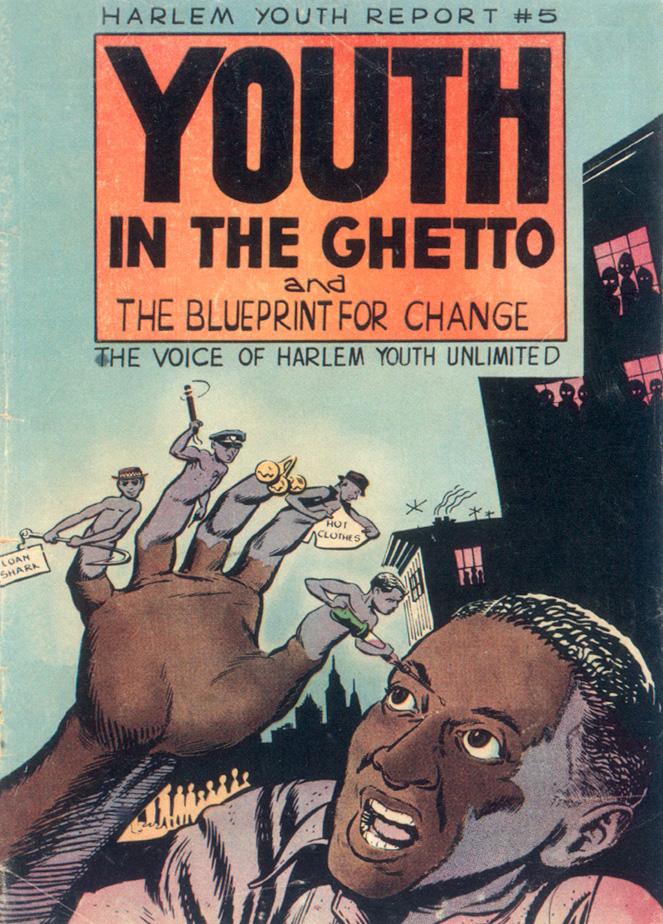Regisseur Shaka King steigt mit dokumentarischen Bildern in „Judas and the black Messiah“ ein. In der Geschichte über den Spitzel William O‘Neal, der vom FBI in die Black Panther Party in Chicago eingeschleust wurde, um zu verhindern, dass mit dem Panther-Vorsitzenden Fred Hampton ein „schwarzer Messias“ entsteht, hat der Spitzel zuerst das Wort. Die Auszüge aus dem einzigen Interview O‘Neals, das er 1989 für „Eyes on the prize 2“ gab, zeigen bereits etwas von der Zerrissenheit, die er über den Verrat empfunden haben muss.
Der Film folgt dann der Figur O‘Neals (wunderbar gespielt von Lakeith Stanfield) vom kleinen Gauner, der mit Hilfe einer gefälschten FBI-Marke Autos klaut, zu seiner Verhaftung, der Erpressung durch das FBI, für sie zu spionieren oder für fünf Jahre in den Bau zu gehen, bis zu seinem Aufstieg zum Sicherheitschef der Black Panthers. Mehrfach versucht er aus der Spitzeltätigkeit auszusteigen, immer wieder lässt er sich vom FBI mit Drohungen erpressen und mit Geld, Autos und schicken Restaurantbesuchen verführen. Auch O‘Neal war scharf auf die 30 Silberlinge – nach heutigem Wert hat er für seine Spitzeltätigkeit 200.000 US-Dollar erhalten.
Weil es O‘Neals Auftrag war, nah an Fred Hampton zu sein, ist der Film es dann auch.
Daniel Kaluuya spielt den charismatischen Fred Hampton kämpferisch und mit einer Energie, dass es eine Wonne ist, ihm zuzuschauen. Den Oscar für die beste Nebenrolle hat er sich mehr als verdient.
Wenn Kaluuyas Hampton erklärt, dass Rassismus nicht mit Rassismus zu bekämpfen sei, sondern mit Solidarität, und dass die Panthers dem Kapitalismus nicht schwarzen Kapitalismus entgegensetzen, sondern Sozialismus, wenn er Menschen aufstehen lässt, um mit ihnen immer wieder zu rufen: „Ich – bin ein Revolutionär“, beginnt man zu ahnen, warum das FBI Angst vor ihm hatte. Wenn man dann sieht, wie es Hampton nicht nur gelungen ist, die schwarzen Gangs Chicagos mit den Panthers zu vereinen, sondern auch die puertoricanische Emanzipationsbewegung „Women of the Young Lords“, weiß man, warum J. Edgar Hoover befahl, Hampton aus dem Weg zu räumen. Hampton marschierte furchtlos in das Hauptquartier der „Young Patriots“, stellte sich unter die Südstaatenflagge und machte den Rednecks klar, dass sie genauso ausgebeutet sind und mit den Schwarzen und Puertoricanern mehr gemein haben als mit den Weißen der herrschenden Klasse. Mit seiner „Rainbow Coalition“ hat Fred Hampton den bürgerlichen Staat das Fürchten gelehrt. Selbst im Knast wäre dieser Mann noch zu gefährlich gewesen.
Und so beauftragt das FBI O‘Neal, Hampton Schlafmittel in den Drink zu schmuggeln, damit er nicht bei Bewusstsein ist, wenn nachts das Mordkommando kommt. Als es kommt, schläft Fred Hampton tatsächlich. 99 Schüsse hat die Polizei in dem Panther-Haus abgeben, die Panthers einen einzigen. Fred Hampton wurde 21 Jahre alt, seine Freundin Akua Njeri (herausragend: Dominique Fishback) überlebte den Mordanschlag. 25 Tage später brachte sie den gemeinsamen Sohn zur Welt.
Regisseur King hält sich fern von klischeehafter Guerillaromantik, kann aber den fast schon ikonischen Bildern der Black Panthers in Aktion nicht widerstehen, genauso wenig wie der (überaus wohldosierten) Musik des Jahres 1968. Zusammen macht das den Film streckenweise zu einem großen Vergnügen, trotz des bitteren Endes.
Nachdem William O‘Neal die Ermordung Fred Hamptons ermöglicht hatte, bespitzelte er noch jahrzehntelang seine Genossinnen und Genossen der Black Panther Party. 1989 gab er das einzige Interview zu seiner Spitzeltätigkeit. Am Abend der Ausstrahlung nahm er sich das Leben.
Der bürgerliche Staat hat sich viele Möglichkeiten geschaffen, denen auf den Leib zu rücken, die seine auf Sand gebaute Ordnung bekämpfen. „Judas and the black Messiah“ zeigt schonungslos eine der widerwärtigsten.
Judas and the Black Messiah
Regie: Shaka King
Buch: Will Berson, Shaka King
Kamera: Sean Bobbitt
Mit Daniel Kaluuya, Lakeith Stanfield, Jesse Plemons, Dominique Fishback
Jetzt im Kino



![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)