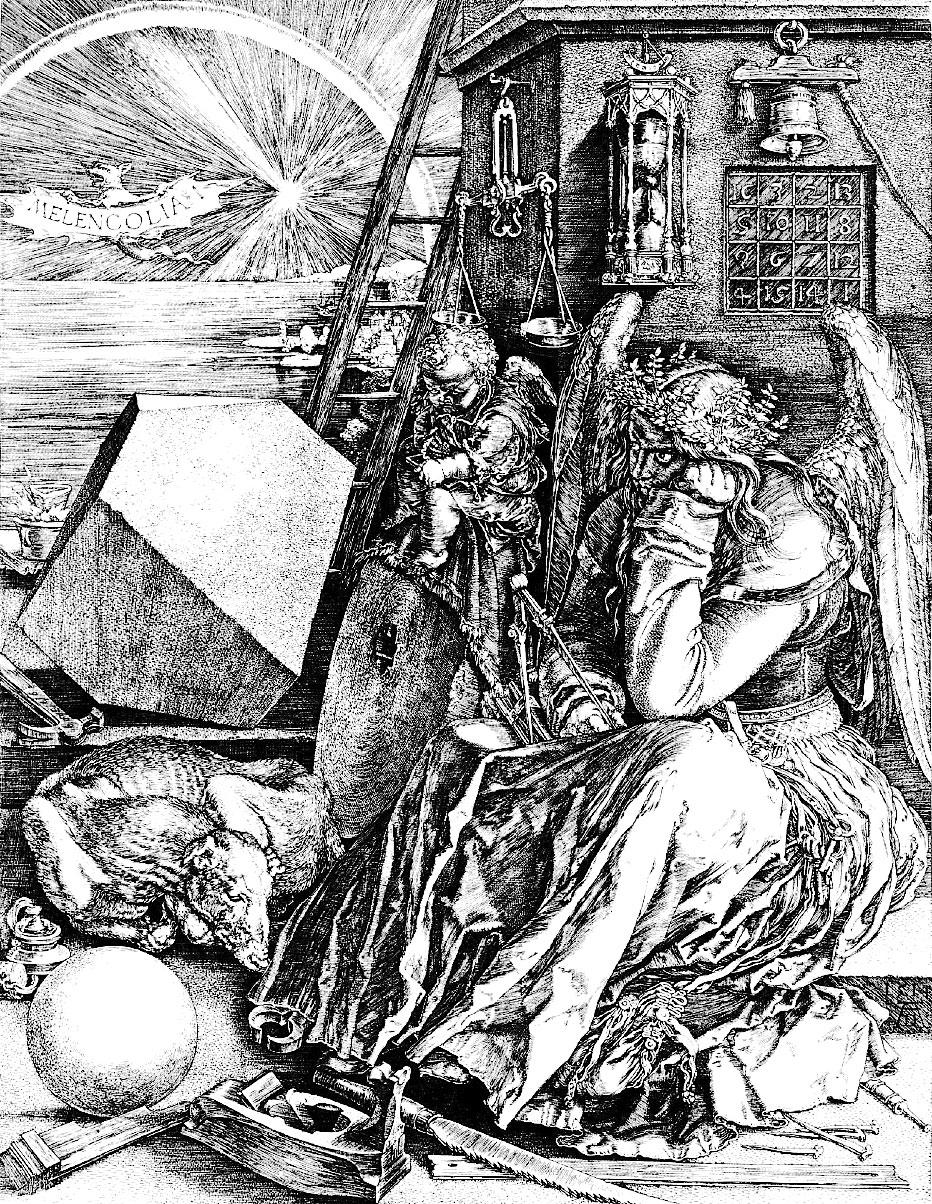In der Zeitschrift „antifa“, deren Herausgeber der Bundesausschuss der VVN-BdA ist, erschien im Juli der Artikel „Als es keine Brandmauer gab“. Autorin ist die Referentin für Geschichts- und Erinnerungspolitik der VVN-BdA, Maxi Schneider. Sie unterstellt darin, dass „Querfront-Ambitionen vor dem Hintergrund des Kriegs Russlands gegen die Ukraine bei manchen der traditionell im linken Spektrum zu verortenden Akteure anschlussfähig zu sein scheinen“. Genannt werden von Schneider mehrfach die DKP und ihre Zeitung Unsere Zeit. Im ersten Teil des Artikels setzt Schneider sich mit dem Antifaschismus der KPD auseinander. Sie bemerkt, diese machte zwar keine gemeinsame Sache mit der NSDAP, aber „der Stimmenfang bei den Völkischen bestärkte nationalistisch Gesinnte, wertete die extreme Rechte als Gesprächspartner auf und unterlief die internationalistische Haltung der KPD ebenso wie ihren Kampf für Frauenrechte und ihren antifaschistischen Grundkonsens“. Der Vorsitzende der DKP, Patrik Köbele, wandte sich an die Redaktion der „antifa“ mit der Bitte, Positionen richtigstellen zu können, da die Autorin „eine Um-Schreibung der Geschichte des antifaschistischen Kampfes“ vornehme und die Postionen der DKP verdrehe. Diese Möglichkeit wurde nicht eingeräumt. Deshalb veröffentlichen wir an dieser Stelle den ersten Teil der Antwort, die sich mit den historischen Einschätzungen beschäftigt.
Die KPD habe im Laufe der 1920er und 1930er Jahre laut Schneider folgenschwere Fehler begangen, als sie versuchte, der radikalen Rechten Wähler dadurch abspenstig zu machen, indem sie die Trennlinie zu ihnen aufweichte. Sie verweist auf die „Schlageter-Rede“ von 1923, mit welcher Karl Radek – der „Deutschland-Experte“ der Komintern – den persönlichen Mut des von der französischen Armee im Zuge der Ruhrbesetzung hingerichteten rechten Freikorpsleutnants bäuerlicher Herkunft Albert Leo Schlageter würdigte – verbunden mit dem Appell an die ihm nahestehenden Kräfte in Deutschland, sich nicht länger der Einsicht in den Zusammenhang von sozialer und nationaler Befreiung zu verschließen. Als nationalistische Verirrung wird auch die „Programmerklärung zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes“ der KPD von 1930 mit ihrer Stoßrichtung gegen den Versailler Vertrag gewertet. Zudem habe die KPD 1931 einen von der NSDAP initiierten Volksentscheid zur Auflösung des preußischen Landtags mitgetragen und beim BVG-Streik in Berlin 1932 sich nicht gescheut, mit der Nationalsozialistischen Betriebszellenorganisation (NSBO) zu kooperieren. Die ideologische Basis für diese Irrwege habe sich unter anderem aus der von der Komintern vorgegebenen Sozialfaschismusthese ergeben, wonach der Hauptstoß nicht gegen die Nazis, sondern gegen die „sozialfaschistische“ SPD zu richten sei.
Nation und Volk
Wenn Schneider kritisiert, die KPD habe versucht, sich als die konsequentere Vertreterin nationaler Interessen zu empfehlen, so ist zunächst eine prinzipielle Klarstellung nötig. Die KPD bekannte sich programmatisch zum Marxismus-Leninismus. Ist es auf dieser Basis überhaupt anrüchig, sich nationaler Interessen anzunehmen? Oder ist es nicht sogar vielmehr geboten? Karl Marx und Friedrich Engels stellten im „Kommunistischen Manifest“ klar: „Indem das Proletariat zunächst sich die politische Herrschaft erobern, sich zur nationalen Klasse erheben, sich selbst als Nation konstituieren muss, ist es selbst noch national, wenn auch keineswegs im Sinne der Bourgeoisie.“ Offenbar gibt es also verschiedene Begriffe oder vielmehr Klasseninhalte von „Nation“ – und somit aus marxistischer Sicht keinen Grund, in dieser Frage eine bloß verneinende Haltung einzunehmen.
Nicht anders verhält es sich mit dem Begriff des „Volkes“. In der Französischen Revolution gewann ein Begriff seine Gestalt, der unter „Volk“ die Gesamtheit der arbeitenden, aber nicht an der Herrschaft beteiligten Menschen verstand – in Abgrenzung zu Adel und Klerus. Danach bildete sich im Gegensatz dazu von rechts ein Verständnis, dem zufolge ein „Volk“ eine mystisch-blutsbasierte Schicksalsgemeinschaft sei, welche Herrschende und Beherrschte gleichermaßen einschließt. Bei aller möglichen Kritik an der Programmatik der KPD der Weimarer Republik ist festzustellen, dass diese sich immer dem revolutionär-republikanischen Volksbegriff verpflichtet gesehen hat und bestrebt war, der deutschen Nation einen sozialistischen Klasseninhalt zu geben.
Als Radek bei der Sitzung des Exekutivkomitees der Komintern (EKKI) am 20. Juni 1923 sich auf Schlageter bezog, stellte er klar, dass es nicht darum gehen könne, „an der Leiche die Feindschaft zu vergessen“. Schlageter sei ein „mutiger Soldat der Konterrevolution“ gewesen – überzeugt davon, seinem Land zu dienen. Männer wie er stünden aber vor der Entscheidung, ob sie ihr Blut für den Profit der Monopolherren vergießen oder ob sie ihr Wirken in den Dienst des arbeitenden deutschen Volkes stellen wollen. Der Gedanke ist insofern schlüssig, als Schlageter seiner eigenen sozialen Herkunft nach nicht von vornherein für den von ihm beschrittenen Weg bestimmt war. In der achtbändigen „Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung“ des Instituts für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED wird die Interpretation von Radeks Rede als Querfrontbestrebung zu Recht als Verleumdung zurückgewiesen, finden sich doch in ihr keine Revisionen der Parteiprogrammatik oder inhaltliche Konzessionen an den Faschismus. Allerdings haben die Historiker Heinz Marohn und Eberhard Czichon auch darauf hingewiesen, dass der Bezug auf Schlageter, der immerhin auch an Terroraktionen gegen Arbeiter beteiligt war, an der KPD-Basis vielfach als Zumutung empfunden wurde. Es kann also darüber gestritten werden, ob sich Radek politisch klug verhalten hat. Allerdings ist es zweifelhaft, ob diese Episode der KPD-Geschichte nur auf die Namen Radek und Schlageter zugespitzt werden kann. Immerhin hatte Clara Zetkin auf der gleichen EKKI-Sitzung festgestellt, „dass der Faschismus eine Bewegung von Hungrigen, Notleidenden, Existenzlosen und Enttäuschten ist“. Es müsse darum gehen, „dass wir die sozialen Schichten, die jetzt dem Faschismus verfallen, entweder unserem Kampfe eingliedern oder sie zum Mindesten für den Kampf neutralisieren“.
Volksentscheid und BVG-Streik
Kritisch zu sehen ist das Verhalten der KPD beim von NSDAP, DNVP und Stahlhelm initiierten Volksentscheid zur Auflösung des preußischen Landtags 1931. Die Unterstützung dieses Volksentscheids wurde im Politbüro abgelehnt, dann aber auf Drängen des EKKI doch beschlossen. Ursache war hier eine unrealistische Einschätzung der politischen Kräfteverhältnisse, der vor allem Heinz Neumann Vorschub geleistet hatte. Er hatte gehofft, die von den rechten Parteien gestartete Initiative in eine Offensive der KPD ummünzen zu können. Es gehört aber auch zur Wahrheit, dass sich die KPD vor der Abstimmung an die sozialdemokratisch geführte Landesregierung von Preußen mit einem Vorschlag antifaschistischer Maßnahmen wandte, um von dessen Beantwortung das weitere Verhalten zum Volksentscheid abhängig zu machen. Carl Severing lehnte im Namen der SPD Gespräche darüber ab.
Nicht beanstandet werden kann die Taktik der KPD beim Streik in den Berliner Verkehrsbetrieben im November 1932. Anlass des Ausstands waren fortgesetzte Lohnsenkungen, die für die Beschäftigten bis dahin dramatische Auswirkungen angenommen hatten. Wer hier das Verhalten der beteiligten Akteure kritisieren möchte, könnte zunächst die Frage stellen, warum weder SPD noch ADGB sich berufen fühlten, den Beschäftigten in ihrem Kampf beizustehen. Treibende Kraft wurde stattdessen die KPD-nahe Revolutionäre Gewerkschaftsopposition (RGO). In der Streikleitung saßen Kommunisten, ADGB-Gewerkschafter und Sozialdemokraten, die sich über die Haltung ihrer Organisationen hinweggesetzt hatten, sowie zwei Mitglieder der NSBO. Die letzteren von vornherein auszuschließen, hätte darauf hinauslaufen können, sie direkt in die Streikbrecherrolle zu drängen. Zum anderen bot sich die Gelegenheit zu einer Probe, wie es um den „sozialistischen“ Charakter dieser angeblichen „Arbeiterpartei“ real bestellt war. Und das Ergebnis war aufschlussreich: Bereits am dritten Tag des Streiks zogen sich die NSBO-Vertreter aus der Streikleitung zurück und die NSDAP begann für den Abbruch des Arbeitskampfs zu werben. Sie waren in eine recht unkomfortable Lage geraten – einerseits musste die „sozialistische“ Fassade gewahrt werden, andererseits drohte Irritation unter den inzwischen reichlich vorhandenen potenten Geldgebern, die mit ihren Zuwendungen natürlich andere Erwartungen verbanden. Letztlich zeigten die Faschisten aber, dass sie immer noch wussten, wohin sie gehören, als der Berliner NSBO-Chef mit der BVG-Direktion darüber zu sprechen begann, wie der Streik möglichst schnell beendet werden könne. Die im Zeichen des BVG-Streiks stattfindenden Novemberwahlen zum Reichstag bestätigten den Kurs der KPD durch deutliche Stimmengewinne bei gleichzeitigen Verlusten der NSDAP. Bisherigen proletarischen NSDAP-Anhängern konnten die Augen geöffnet werden – und dies nicht mithilfe moralischer Belehrung, sondern durch praktisches Erleben. Übrigens erschoss die Polizei im Streikverlauf drei Arbeiter und eine unbeteiligte Frau – ein Umstand, der heute bezeichnenderweise gar nicht mehr von Interesse ist, wenn von diesem historischen Ereignis gesprochen wird.
Die Programmerklärung von 1930
Zur „Programmerklärung zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes“ behauptet Schneider, dass die sich dort ausdrückende Opposition gegen den Versailler Vertrag nur denkbar gewesen sei vor dem Hintergrund der Stalinschen Doktrin vom „Sozialismus in einem Land“. Dies ist in zweierlei Hinsicht fragwürdig. Zum einen hatte bereits Lenin in seiner Schrift „Über das Genossenschaftswesen“ gesagt, dass sein Land durch die proletarische Staatsmacht, die staatliche Verfügung über die großen Produktionsmittel sowie durch das Bündnis von Arbeitern und Bauern über die Voraussetzungen des sozialistischen Aufbaus verfüge. Und zum anderen war es derselbe Lenin, der den Versailler Vertrag einen „Frieden von Wucherern und Würgern, einen Frieden von Schlächtern“ nannte, in dessen Zeichen Deutschland und Österreich „ausgeplündert und zerstückelt würden“. Er blieb bei seiner Einschätzung, dass es sich beim Ersten Weltkrieg um einen Raubkrieg aller Seiten gehandelt habe. Dass der deutsche Imperialismus sich dabei als besonders aggressiv erwiesen hatte, ändert nichts an der Berechtigung von Lenins Einschätzung. Mit ihrem „Dekret über den Frieden“ hatte die Sowjetregierung 1917 einen Frieden ohne Reparationen und Gebietsabtretungen vorgeschlagen, um nicht direkt Keime für einen neuen Krieg zu setzen. Versailles widersprach diesem Geist gleichberechtigter Verständigung völlig. Als Ernst Thälmann 1932 Paris besuchte, bekundete auch die Kommunistische Partei Frankreichs ihre Ablehnung des Versailler Vertrags. Was Schneider als nationalistische Verirrung kritisiert, war also in Wahrheit Internationalismus in Aktion.
Die Sozialfaschismusthese
Die Sozialfaschismusthese ist in den Reihen der kommunistischen Bewegung ausführlich analysiert und vor allem kritisiert worden. Spätestens mit dem VII. Komintern-Kongress von 1935 gehörte sie der Vergangenheit an. Führende Kommunisten zeigten sich hier von ihrer besten Seite, nämlich als Lernende. Die bei dieser Gelegenheit vorgetragene berühmte Dimitroff-These, wonach es sich beim Faschismus an der Macht um die terroristische Herrschaft der reaktionärsten Teile des Finanzkapitals handele, wurde und wird als grobe Vereinfachung angegriffen. Auch hier ist zu widersprechen, denn Georgi Dimitroff hat nicht behauptet, mit seiner Formel das Wesen des Faschismus erschöpfend behandelt zu haben. Daher machte etwa der Vertreter der britischen KP, Rajani Palme Dutt, weiterführende Anmerkungen zur Beschaffenheit der faschistischen Demagogie, der es gelinge, auch Menschen anzusprechen, deren Interessenlage von der des Monopolkapitals grundverschieden ist. Fragt man nach den Ursachen des Fehlers in Gestalt der Sozialfaschismusthese, so ist auf den blutigen Terror der (proto-)faschistischen Freikorps gegen die Arbeiterbewegung unter der Verantwortung eines sozialdemokratischen Reichspräsidenten in der Frühphase der Weimarer Republik hinzuweisen. Sozialdemokraten wie Friedrich Ebert und Gustav Noske paktierten erwiesenermaßen mit der radikalen Rechten. Auch spätere Ereignisse waren in diesem Zusammenhang bedeutsam. Zu nennen ist hier vor allem der Befehl Karl Zörgiebels, des sozialdemokratischen Berliner Polizeipräsidenten, die Maidemonstration in der Hauptstadt 1929 zusammenzuschießen. Die Annahme einer Nähe von SPD und Nazis konnte an das unmittelbare Erleben revolutionärer Arbeiter – auf der Erscheinungsebene – emotional anknüpfen. Trotzdem setzte sich auf kommunistischer Seite schon vor dem offiziellen Abschied von der Sozialfaschismusthese die Erkenntnis auf praktischer Ebene durch, dass der „Hauptstoß gegen die Sozialdemokratie“ nicht richtig sein konnte. Dies drückte sich in zahlreichen Einheitsfrontinitiativen an der Basis aus. Kurz nach der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler bot die KPD der SPD an, nun gemeinsam auf die Ausrufung des Generalstreiks zu orientieren. Es bleibt die Verantwortung der SPD, diese letzte Chance in den Wind geschlagen zu haben.



![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)