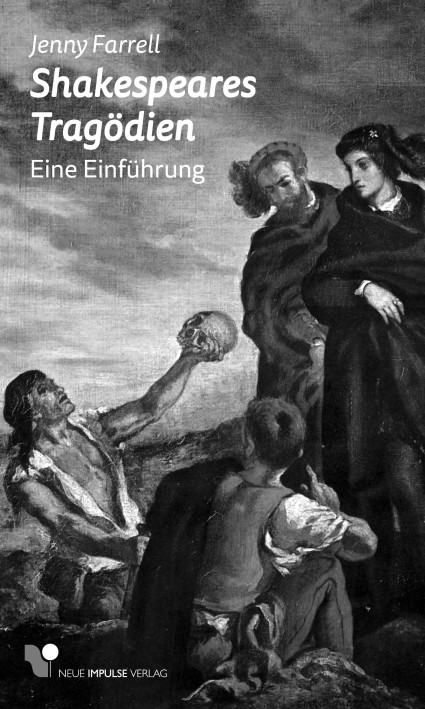
Jenny Farrell
Shakespeares Tragödien
Eine Einführung
Neue Impulse Verlag
Essen 2016
207 Seiten, 12,80 Euro
Hier muss der Superlativ gestattet sein: es gibt keinen Autor der Weltliteratur (und Autorin hier mitgedacht), der so viel gespielt und gelesen wird wie Shakespeare, und es gibt auch keinen zweiten, über den in den letzten 400 Jahren so viel geschrieben wurde – und immer noch geschrieben wird. Die Literatur zu Shakespeare hat weltweit einen Umfang erreicht, den heute niemand mehr auch nur in den Konturen zu überschauen vermag. Und doch werden weiterhin Bücher zu Shakespeare veröffentlicht, ohne dass sich die Auffassung einstellen würde, dass ein solches Unternehmen überflüssig sei. Warum dies so ist, kann hier nur angedeutet werden. Des Pudels Kern jedenfalls ist, dass dieses Werk, es sind immerhin 38 Dramen, in seinem Zusammenhang eine Qualität der Welterfahrung besitzt, die in Tiefe und Umfang von keinem anderen Werk der dramatischen Weltliteratur erreicht wird. Die Summe seines geschichtlichen Gehalts, die in ihm gestaltete Totalität realer und möglicher Welterfahrung ist so umfassend, dass diese Dramen in allen Kulturen heimisch wurden. Der Erdball, hat Heine treffend gesagt, ist der Ort, auf dem Shakespeares Dramen spielen, die Menschheit ihr verborgener Held. „Noch nach wie viel Zeiten/Ahmt einst man nach dies unser hehres Schauspiel/In ungebornen Ländern, künftigen Sprachen“, heißt es in prophetischer Vorausschau im „Julius Caesar“.
Anders als die Literaturen der klassischen Antike oder des Mittelalters ist mit Shakespeare eine Kunst entstanden, die sich ihres geschichtlichen Charakters selbst bewusst ist, die Wirklichkeit, die sie darstellt wie den Akt der Darstellung selbst als geschichtlich begreift, sich selbst also als geschichtlich versteht. Shakespeares Protagonisten, die männlichen wie die weiblichen, und die Konflikte, in die sie gestellt sind, sind psychologisch wie historisch-sozial geschichtliche Wesen, und zum Wesen der Geschichtlichkeit gehört die Veränderung – die Anforderung, die in den Dramen gestalteten Themen und Konflikte in wechselnden Perspektiven sichtbar zu machen. Dies gilt für alle Kunst, doch für keine so wie für Shakespeare. Geschichtliche Veränderung ist in ihm selbst angelegt. Mit seinen interpretativen Aneignungen wandelt sich dann auch das Werk, in dem Sinn, dass bislang verborgene Perspektiven erkannt und spielerisch erschlossen werden. Die unabschließbare Vielfalt der Interpretationen ist also in diesen Werken selbst angelegt. Sie treten so aus der geschichtlichen Distanz in die Gegenwart – nicht durch simple Aktualisierungen, sondern durch das Ausarbeiten ihrer Potenzen.
Orientierungslosigkeit und Beliebigkeit
Dies soll und darf nicht bedeuten, dass Shakespeares Werke „Spieltexte“ sind, gar „offene Kunstwerke“ (Umberto Eco), die nach Lust und Beliebigkeit der Interpreten, den Moden des Markts und der Macht der Ideologien entsprechend ihre Bedeutung wechseln. Wenn dies geschieht wird ihre Authentizität verraten. Sie haben sehr wohl einen substantiellen Kern, einen psychisch-sozialen geschichtlichen Konflikt, von dem her sie gebaut sind, wobei dieser Kern höchst vielschichtig sein kann. Diese unerhörte Vielfalt besteht gerade in Pluralität und Vielgestalt der Kernkonflikte, die Shakespeares Dramen zugrunde liegen. Jedes dieser Werke aber besitzt einen solchen substantiellen Kern – der allein erst diesen Werken Identität und Kohärenz verleiht. Solche Kernkonflikte unterscheiden über die Gattungsgrenzen hinaus bestimmte Werkgruppen – wie dies dann auch mit Shakespeares Tragödien der Fall ist. Die Aufgabe der Interpretation nun – im Theater wie in der wissenschaftlichen Kritik – besteht darin, die thematische Grundkonstellation zu erfassen, die in dem dargestellten Konflikt zum Ausdruck kommt. Hier liegen, über das subjektive Urteil hinaus, objektivierbare Kriterien für die Richtigkeit oder Falschheit von Interpretationen, das Gelingen oder Misslingen eines theatralischen Spiels. Eine solche Einsicht will nicht in Abrede stellen, dass Shakespeares Werke vielschichtig und unterschiedlich interpretierbar sind – aber immer nur in einem bestimmten, weit gefassten Rahmen.
Betrachtet man den gegenwärtigen Umgang mit Shakespeare in der kritischen Literatur wie im Theater, so ist kaum zu leugnen, dass dieser im hohen Maß von Orientierungslosigkeit geprägt ist. So gibt es kaum noch Interpretationen oder Inszenierungen, die imstande oder auch nur willens sind, die Dramen Shakespeares vom substantiellen Kern her zu erfassen. Von einem Kernkonflikt ist nur noch selten die Rede, oder wenn dann doch ein solcher ausgemacht wird, lässt er sich an Trivialität kaum überbieten. Da kann es geschehen, das Hamlet als pubertierender Jüngling erscheint, oder es spielt „Romeo und Julia“ in einem beliebigen Kleinbürgermilieu. Die konservative Variante ist, den Hof von Dänemark als Kostümstück auszustaffieren oder Hamlet als Verkörperung Jakobs I., des Nachfolgers Elisabeths, aufzufassen, ein Einfall des faschistischen Staatstheoretikers Carl Schmitt, der heute wieder Konjunktur hat. Und selbst ein Kenneth Branagh war sich nicht zu schade, in seinem (in vielem passablen) Hamlet-Film Szenen einzublenden, die den Dänenprinzen mit Ophelia im Bett präsentieren.
Hierzulande hat sich der Ausdruck „Regietheater“ eingebürgert – für eine dramaturgische Auffassung, die dem Text einen stabilen und benennbaren Konfliktkern abspricht und die Einfälle der Regie ins Zentrum der theatralischen Veranstaltung stellt. Shakespeares Dramen sind dann allein noch „Spieltexte“ ohne objektiven und tradierbaren Sinn. Was der „Hamlet“ bedeutet steht dann völlig im Belieben der Regie. Dass es in diesem Stück um Fragen von Leben und Tod geht, Probleme, die alles andere als beliebig sind, hat sich da nicht herumgesprochen. Wenn dann überhaupt noch Konflikte zur Sprache kommen, sind es solche, die allein dem Kopf (oder der Psyche) der Regieführenden entspringen und für die eigentlich die Psychiatrie zuständige Instanz wäre. Das Resultat ist eine ästhetische Beliebigkeit, die das Theater zu einem Stück Kulturindustrie degradiert und den Werken ihre historischen wie aktuellen Bedeutungen nimmt. Müßig zu sagen: der Zustand von Forschung und Kritik entspricht weitgehend dem des orientierungslos gewordenen Theaters. Sicher, es gibt Ausnahmen, der Allgemeinzustand aber ist hier leider die Regel, die die Ausnahme bestätigt.
Es verwundert daher auch nicht, dass der Restbestand eines gebildeten Theaterpublikums im Durchschnitt jede Orientierung verloren hat und mit ihr auch die Kriterien solider ästhetischer Kritik – wie auch Schüler, Studierende und Lehrende, die sich mit Shakespeare befassen (oft wider Willen, wie zu befürchten ist), mit diesem nicht viel anzufangen wissen. Wenig Hilfe kommt von der Theaterkritik, die in der Vergangenheit, zumindest in den großen Feuilletons, doch einige Orientierung zu geben wusste.
Mehr als eine Einführung
Angesichts dieses Sachverhalts macht es Freude, hier ein Buch anzuzeigen, das mit Mut, Intelligenz und Entschiedenheit gegen den Strom schwimmt: Jenny Farrells „Shakespeares Tragödien“. Das Buch ist genau, was es zu sein vorgibt, eine Einführung in die vier großen Tragödien Shakespeares: „Hamlet“, „Othello“, „König Lear“ und „Macbeth“. Es will leisten, was heute nur noch wenige Bücher tun: Es richtet sich an alle, die sich aus Interesse an Text und Theater mit Shakespeare befassen und in ihrem Interesse meist allein gelassen sind. Dabei steht im Zentrum der Deutung der Text: das genaue Lesen, eine Methode mit grundsolider philologischer Tradition, deren Kenntnis auch für sogenannte Spezialisten von zentraler Bedeutung ist. Shakespeares Text – die vier großen Tragödien – wird in guter marxistischer Schule in die geschichtlichen Zusammenhänge gestellt, aus denen er hervorgegangen ist: den „Kontext“. Nach dieser Einsicht gliedert sich das Buch. So behandelt das erste Kapitel eben diesen Kontext: die frühe Neuzeit als Zeit epochaler Umwälzungen, der Ausbildung der ersten Phase der bürgerlichen Gesellschaft, die Renaissance als europäische Erscheinung, den Tudor-Absolutismus als die nationale Epoche, in der das Theater Shakespeares, als kulturelle Institution entstand. Der Bogen wird in höchster Kürze bis hin zu Shakespeares Leben geführt, über das schon viel geschrieben, aber wenig bekannt ist. Dass Farrell hier nur eine Skizze gibt – nicht mehr als 20 Seiten – ist bedauerlich; doch wer mehr wissen will, greife zu der auch von marxistischer Seite umfangreichen Literatur. Für Menschen, die sich zum ersten Mal mit dieser Epoche befassen, wird der historische Zusammenhang jedenfalls im Umriss gegeben und damit der Kontext, ohne den eine genaue Deutung der Texte nicht möglich ist. Die Kapitel II bis V enthalten den Kern des Ganzen, eben die genaue Lektüre im Sinne einer einführenden Interpretation. Ein abschließender Teil, seiner Kürze wegen nicht mehr als Kapitel markiert, gibt in höchster Konzentration den Umriss einer Gesamtinterpretation, für die man sich ein wenig mehr Raum gewünscht hätte. Denn hier zeigt sich, dass die gedankliche Substanz des Buchs weit mehr ist als der Untertitel einer „Einführung“ suggeriert. Was Farrell freilegt, ist sehr genau der substantielle Kern der Shakespeare-Tragödie, von dem her die Einzelwerke gebaut sind – eben das, was in der großen Mehrzahl ihrer Studien die „große Forschung“ gerade verfehlt.
Im Zentrum des Buchs stehen die vier Textinterpretationen. Die Autorin folgt dabei einem einfachen methodischen Schema: der Frage nach der Handlung, der Frage nach den Figuren, der Frage nach Thema und Problemkonstellation, der Betrachtung der ästhetisch-dramaturgischen Mittel (Stilmittel), der Frage des Endes sowie, als Abschluss, der Frage nach dem tragischen Gehalt. Die Methode leuchtet ein Was Farrell praktiziert, ist die bewährte Methode des „New Criticism“: die Kunst des genauen Lesens.
Kräfte im Widerstreit
Die Stärke des genauen Lesens, wie es Farrell praktiziert, besteht darin, dass es ihm gelingt, den substantiellen Kern der Tragödien, der ihr Konfliktpotential ausmacht. Sie geht nicht, wie es der in manchem ähnlich verfahrende André Müller tut, mit einer großen These an die Dramen heran (Müller mit der der Anhängerschaft Shakespeares an den Absolutismus Elisabeths I.), die nicht unplausibel, von den Texten selbst her aber nicht zu beweisen ist, sondern orientiert sich an den in den Tragödien gestalteten Konflikten. Diese sind ihrer überzeugenden Deutung nach der Ausdruck eines Grundkonflikts widerstreitender geschichtlicher Kräfte, die nach dem Zusammenbruch der mittelalterlichen Welt und dem Aufstieg der frühen Bourgeoisie hervorgetreten sind. Steht auf der einen Seite eine sich befreiende Humanität, deren Werte Frieden, Recht, das Wohlergehen aller, in der Konsequenz die Vorstellung menschlicher Gleichheit ist, so auf der anderen der Wille zur Macht (wie später Nietzsche sagen wird), der Trieb nach Herrschaft und Unterwerfung, der Ausplünderung schließlich unsres Planeten. Farrell bezeichnet diese sich widerstreitenden Kräfte – sie sind mit Begriffen, die sie der Zeit Shakespeares selbst, der Renaissance entnimmt: Humanismus und Machiavellismus; Humanismus im Sinn eines Erasmus von Rotterdam und Thomas Morus, Machiavellismus nach dem Verfasser des berühmten Breviers des Machtgewinns und Machterhalts „Der Fürst“. Als dritte Kraft treten in die hier aufgezeigte Grundkonstellation die Vertreter der alten Ordnung, der mittelalterlich-feudalen Welt. Diese drei Kräfte sind es, die in der Grundkonstellation die Konflikte der vier Tragödien fundieren. Inwieweit für die von Farrell angeführten Kräfte – sie umfassen psychologische, sozial-kulturelle und ökonomische Dimensionen – auch andere Terminologien möglich wären, kann hier nicht das Thema sein. Fakt ist, dass der Konflikt der Tragödien in diesen Kräften ihren Ursprung nimmt. Die vier Tragödien nun zeigen den Konflikt dieser Kräfte in einer Vielfalt und Verschiedenheit der Konfiguration, die in der dramatischen Weltliteratur ohnegleichen ist. Die spannende Lektüre, die die Interpretationen zu bieten haben, kann keine Rezension ersetzen.


![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)





