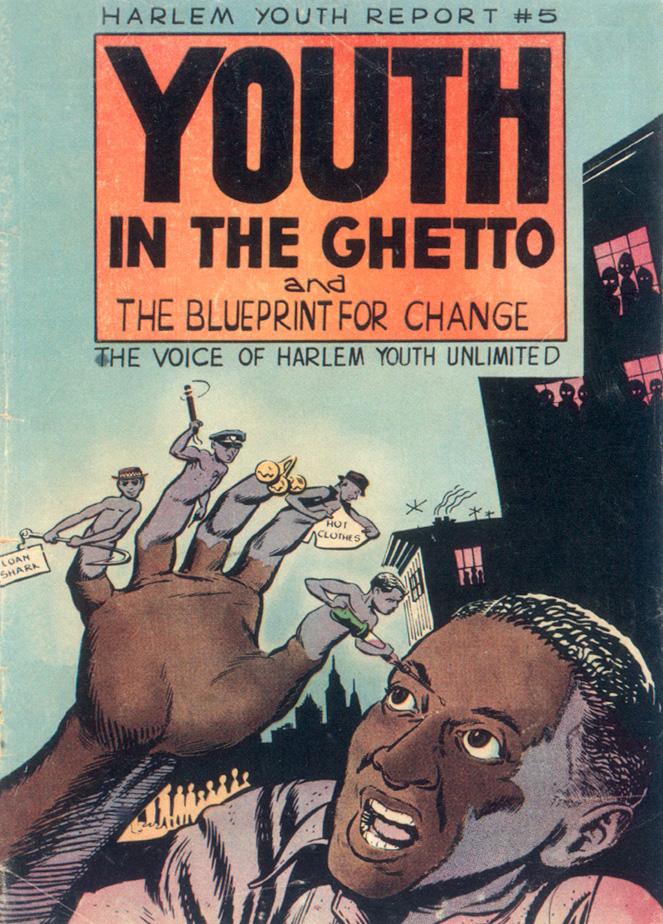Im US-Bundesstaat Kalifornien brennt es. Natürlich hilft das, den laufenden Wahlkampf anzuheizen zwischen Republikaner Trump und Demokrat Biden. Letzterer macht für den Brand den Klimawechsel verantwortlich, Ersterer sagt laut „LA Times“ dazu: „Ich denke nicht, dass die Wissenschaft es weiß.“ Was? Dass es laut Trump ja schon wieder kühler wird. Er wiederum gibt den Demokraten für die Katastrophe die Schuld. Schließlich regieren die den Bundesstaat und haben die umgefallenen Bäume wegzuräumen und nicht liegen und ausdörren zu lassen, bis sie „explodieren“. Biden beharrt darauf, dass es nur ums Klima geht.
Reibereien zweier Kontrahenten um Wählergunst und ohne viel Interesse für die von dem Feuer Bedrohten – würde man sie wie einen der kalifornischen Redwood-Bäume aufschneiden und reinschauen, statt auf der Wahlkampfoberfläche zu bleiben, man könnte sehen, wie sie sich innen(-politisch) nicht viel nehmen.
Dieses Aufschneiden von und Reingucken in zwei alte Kerle, das unternimmt die Serie „Cobra Kai“. Nicht neu, bereits 2018 in der Bezahlrubrik von „Youtube“ angelaufen, sind jetzt die ersten beiden Staffeln auf Netflix verfügbar. Die dritte Staffel ist fertig produziert, kommt aber erst, nachdem sich entschieden hat, wer die nächsten vier Jahre Admin der USA sein wird.
Die Serie ist ein Sequel der Karate-Kid-Filme der 1980er, also die mit Ralph Macchio als Kampfkunstkind, nicht Will Smiths Nachwuchs Jaden. Besonders der erste Film (1984) und der finale Kampf zwischen dem gemobbten Lauch Daniel LaRusso und Johnny Lawrence (William Zabka) vom fiesen, Schwarz tragenden Co-bra Kai-Dojo ist filmisches Kollektivwissen. Der entscheidende Kranich-Kick hat in seiner Nachahmung wohl Unzähliges an zerbrechlichem Wohnzimmerinventar auf dem Gewissen.
In der Serie ist LaRusso gutverdienender Autoverkäufer und Familienvater. Lawrence klebt an der Bierflasche und losert solo vor sich hin, ständig wiederholend, dass der Kick, der ihn 34 Jahre zuvor umgenietet hat, illegal war. Also macht er Cobra Kai wieder auf. LaRusso hat was dagegen und gründet Miyagi-Do, benannt nach seinem verstorbenen Sensei, der ihn das „Auftragen-Polieren“ lehrte.
Dann geht es los, das Ringen um Zuspruch. Cobra Kai wirbt mit Hau-drauf bei den Teenagern und Lawrence lässt sich nur mühsam überreden, auch Frauen zu trainieren. Anderes Genderzeugs und „Nein heißt nein“, auch außerhalb von Körperlichkeit, bleibt ihm aber fremd. Im Miyagi-Do üben die Schülerinnen und Schüler viel Esoterikhampelei und irgendwann stellt auch LaRussos Frau fest, dass das Zaunstreichen und Autoputzen kein Training ist, sondern unbezahlte Kinderarbeit.
Rechts- und linksliberale Egos stehen sich in „Cobra Kai“ wie spinnefeind im Weg und teilen sich doch einen Kern: sie verwirren die, die sie sammeln, und richten sie aufeinander aus. Beide Dojos pöbeln und prügeln gegen ihr Gegenüber. Da, wo kein Widerspruch zwischen den pubertierenden Karate-Kids ist, ziehen die Kampfschulen einen hoch. Beide Philosophien, das „Keine Gnade!“-Gemacker von Johnny Lawrence und Daniel LaRussos Zumba-Zen, sind als Wahlkampagnen die Rinden auf morschem Holz, das jubelheischend mit der Handkante zerschlagen werden soll.
So ernste Sachen wie die Unversehrtheit der Person (ob gegenüber Mobbern, Schlägern oder Feuersbrünsten), werden zu einem Zirkus aus zwei Manegen gemacht, beide dirigiert von einem, der auch den Clown kann. Kommt bekannt vor.


![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)