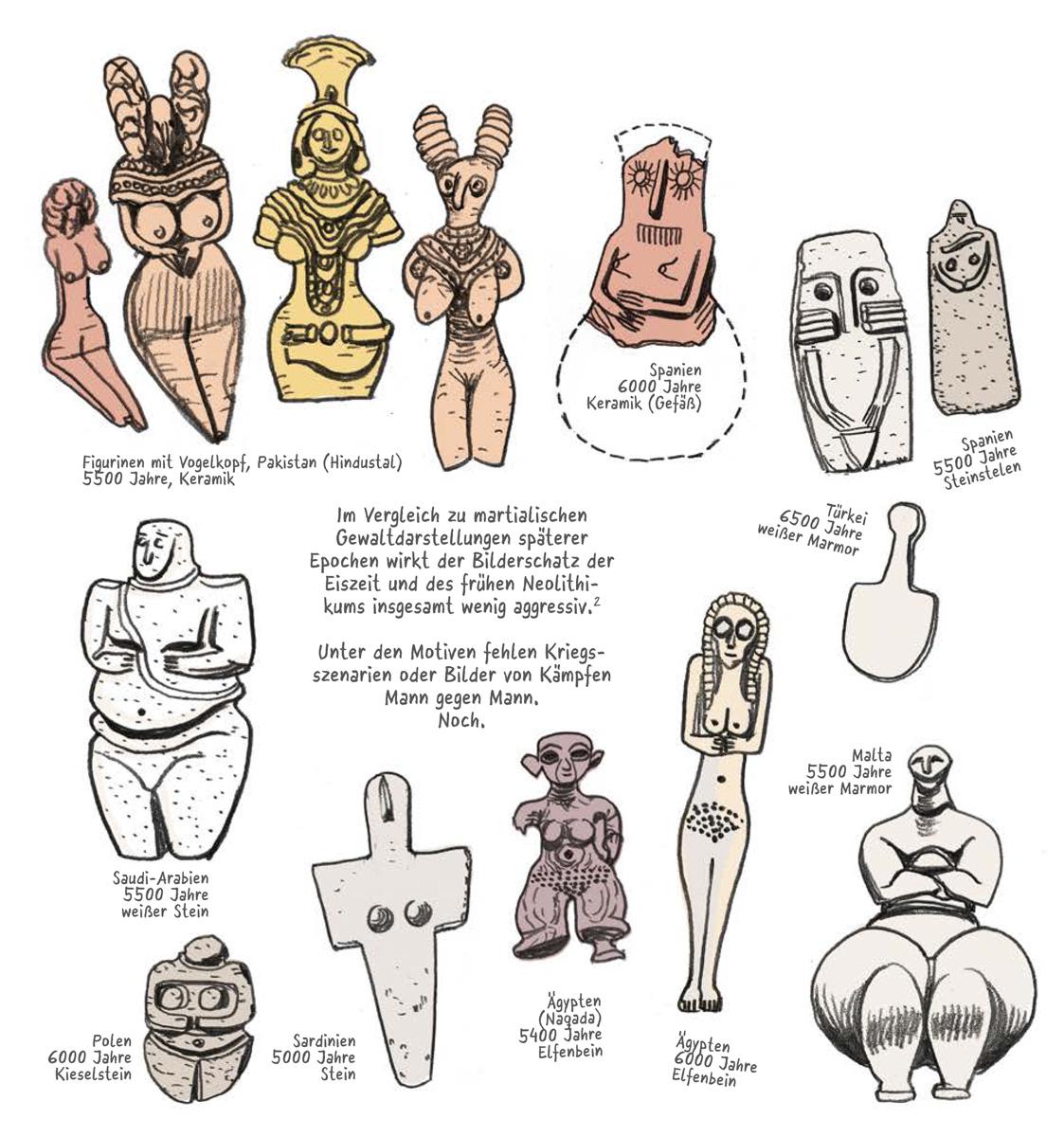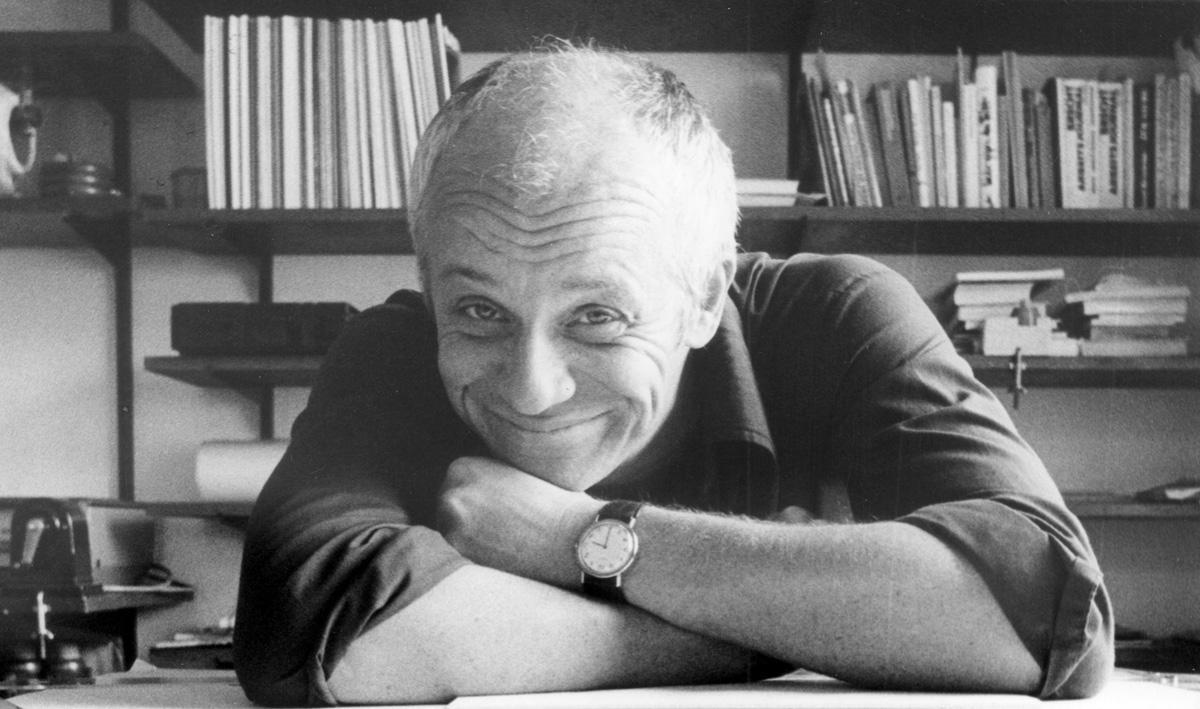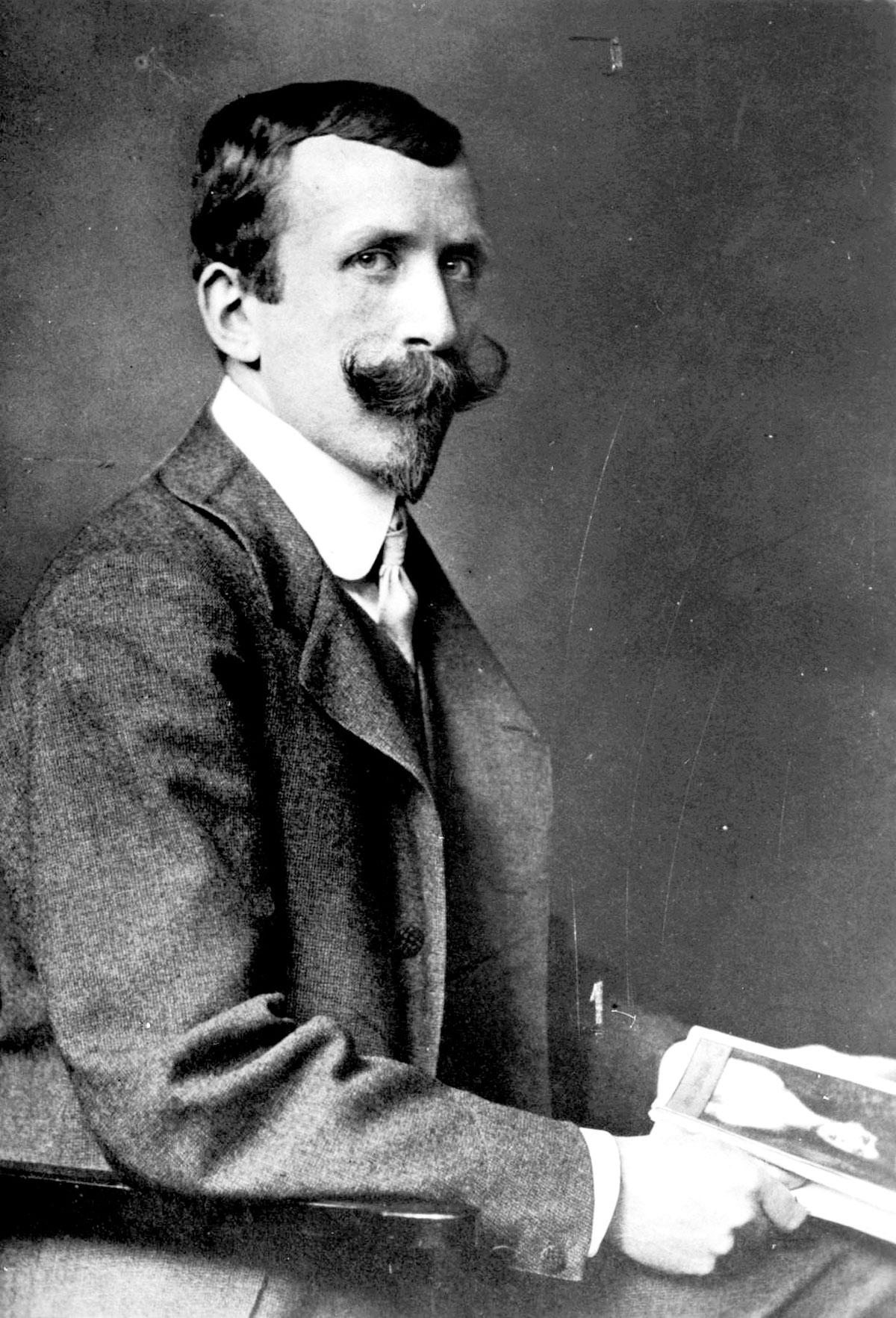Soeben ist Christoph Heins Roman „Das Narrenschiff“ erschienen, der die Geschichte der DDR thematisiert. Sein Titel sucht die Parallelität zu Sebastian Brants gleichnamigem Werk von 1494, „Das Narrenschiff“ war ein Literaturerfolg und wird für Heins Werk zur literarischen Säule.
Was bedeutet das? Der Roman arbeitet mit vielen Bestimmungen eines Narren. Narrenliteratur nimmt historisch einen bedeutenden Platz als Gesellschaftskritik und als verbreiteter Versuch ein, in unbekannte geistige Welten vorzudringen. Unter vielen Sprichwörtern zum Narren stellen viele überdurchschnittliche Intelligenz aus: „Der klügste Mann kann von Narren etwas lernen“ oder „Kinder und Narren sagen die Wahrheit“. Hein bestimmt das Narrentum in seinem Roman in dieser Breite. Seine Narren sind keine spaßigen Gestalten, sondern Menschen, die auf Trümmern einen Staat gründen wollen. Brant setzte konservativ auf die kaiserliche Reichsidee; Hein beschreibt ein Leben in gemeinschaftlicher staatlicher Sicherheit. Frieden ist eines der meistgenannten Themen im Roman. Der ist eine literarische Chronik vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis zum Ende der DDR 1989/90.
Am 1. Mai 1945 flog Karsten Emser, einen Tag nach der „Gruppe Ulbricht“, aus der Sowjetunion nach Berlin zurück, nachdem er sich im NKFD (Nationalkomitee Freies Deutschland) auf diese Rückkehr und die Arbeit in dem zerstörten Land mit kaputten Menschen vorbereitet hat. In einem Gespräch in „Narrenschiff“ sagt er gegen Ende zu seinem ehemaligen Schüler Eduard Schwelhahn, einem Kombinatsdirektor im Schwermaschinenbau Magdeburg: „… was ist aus unseren Hoffnungen und Träumen geworden? Wir wollten ein anderes Land, einen anderen Staat aufbauen, friedlicher, solidarischer und vor allem gerechter.“ Das sagt er kurz vor dem Zusammenbruch dieses Staates, für den er sein Leben konsequent eingesetzt hat. Dieser Emser ist eine auffällige Gestalt in dem riesigen Figurenensemble. Ausgezeichnet wird er von seiner Frau, die ihn liebevoll als „Narren“ bezeichnet.
Zu den mit Heins Roman vergleichbaren Werken gehört neben dem Werk Sebastian Brants auch Thomas Manns ähnlich umfangreicher Roman „Der Zauberberg“, der 1924 erschien und vergleichbare Ansprüche an seine Leserschaft stellte: Der Roman gab in einem Schweizer Sanatorium einen Querschnitt der europäischen Spannungen und Widersprüche kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges wider, mit dessen Ausbruch Manns Roman endet. Heins Roman beginnt mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und erscheint in einer Zeit, in der sich besonders europäische Politiker kriegswütig geben, um „Frieden“ zu schaffen. Thomas Manns Patientenversammlung in dem Sanatorium im Gebirge entspricht Christoph Heins Nachkriegsgesellschaft auf dem Narrenschiff. Hein schreibt mit diesem Roman nicht nur die Geschichte der DDR, sondern einen Antikriegsroman.
Heins Personenensemble hat drei Gruppen: Reale historische Personen werden mit Namen genannt (Ulbricht, Honecker, Gorbatschow u. a.) oder werden leicht verfremdet: Der Chef des Auslandsgeheimdienstes Markus Wolf hat den Namen Fuchs wie auch sein Vater, der Schriftsteller Friedrich Wolf, dem Karsten Emser das Leben gerettet hat. Dann gibt es Personen, die Züge bekannter Personen tragen, ohne diese als Gestalt zu repräsentieren: So trägt der Literaturwissenschaftler Benaja Kuckuck, der ebenfalls gegen Ende des Romans stirbt, unverkennbare Züge des berühmten Literaturwissenschaftlers Hans Mayer, der nach dem Exil in der Schweiz an der Leipziger Universität lehrte. Er ist einer von fünf Menschen, die in der weit verzweigten Handlung agieren. Diese fünf Personen sind zwei Ehepaare und der homosexuelle Kuckuck. Sie treffen sich regelmäßig im privaten Kreis und erörtern dort Probleme, mit denen sie öffentlich konfrontiert werden. Das erinnert an Christoph Heins Stück „Die Ritter der Tafelrunde“ (1989), manche Zuschauer sahen darin eine Beschreibung des Zusammenbruchs der DDR. Die größte Zahl der handelnden Gestalten sind fiktive Menschen aus allen Schichten der Bevölkerung, so dass ein durchaus repräsentativer Querschnitt entsteht. Eine Gestalt wird zur Symbolfigur des gesamten Geschehens, Yvonnes Tochter Kathinka: Es ist der Name einer kurz nach ihrer Geburt verstorbenen Tochter Goethes. Ihr gehören Anfang und Ende des Romans, sie steht für werdende deutsche Kultur und ihr gehört die Zukunft, wenn es die Verhältnisse zulassen. Der Name, von den Eltern bewusst gegeben, bedeutet „die Reine“ (griechisch: katharos) und bezieht Literatur – Goethe – ein. Er ist eine Kurz- und Koseform der russischen Katharina (Jekatarina).
Heins ästhetische Methode, um einen so umfangreichen Komplex abzubilden, ist die Chronik; diese Form hat er zur Vollkommenheit entwickelt. Was bedeutet das? 1990 erklärte er in einem Interview: „… ich verstehe mich als Chronist, der mit großer Genauigkeit aufzeichnet, was er gesehen hat. Damit stehe ich in einer großen Tradition von Johann Peter Hebel bis Kafka. Aber der Schriftsteller ist kein Prediger, der den Sachverhalt, den er darstellt, auch noch selber kommentiert.“(Gespräch mit Sigrid Löffler 1990) Hein war mit manchem in der DDR nicht einverstanden, aber seine literarische Arbeit war durchaus in ihrer kritischen Bestandsaufnahme der Entwicklung förderlich.
Dieser Umgang mit der Chronik führt zu einer zweiten Säule des Romans, das ist der Einfluss des historischen Materialisten und marxistischen Philosophen Walter Benjamin. Walter Benjamins (1892 – 1940) berühmte Thesen „Über den Begriff von Geschichte“ haben bei diesem Werk, das nicht nur ein Roman und eine Chronik, sondern auch eine historische Dokumentation ist, den Zusammenhang von Einzelbild – die Romane und Erzählungen Heins bilden die Grundlage – und Gesamtbild (Das Narrenschiff) bestimmt. Im Roman wird ihm und seiner Familie, scheinbar nebenbei, ein Denkmal gesetzt, indem zweimal auf die medizinische Fachschule „Georg Benjamin“ – den Namen trug sie bis 1990, dann wurde er wie so viele beseitigt – verwiesen wird. Georg Benjamin (1895 – 1942) war Kinderarzt und Widerstandskämpfer und wurde im KZ ermordet. Walter Benjamins Verständnis für den „historischen Materialismus“ ermöglicht die Zusammenschau – wie sie Hein versucht: Er versucht zu sichern, „dass nichts was sich jemals ereignet hat, für die Geschichte verloren zu geben ist“ (Walter Benjamin). Andererseits stelle sich die Aufgabe, die Bilder zu sichern: „Das wahre Bild der Vergangenheit huscht vorbei. Nur als Bild … ist die Vergangenheit festzuhalten.“ Christoph Heins Roman „Das Narrenschiff“ mutet wie eine literarische Umsetzung von Walter Benjamins Geschichtsverständnis an. Entstanden ist eine kritische Chronik eines repräsentativen Ausschnitts der Geschichte nach 1945 bis zum Ende des Jahrhunderts. Am Ende steht Kathinka vor einem Anfang. Wie wird er sein?
Christoph Hein
Das Narrenschiff
Suhrkamp Verlag, 750 Seiten, 28 Euro

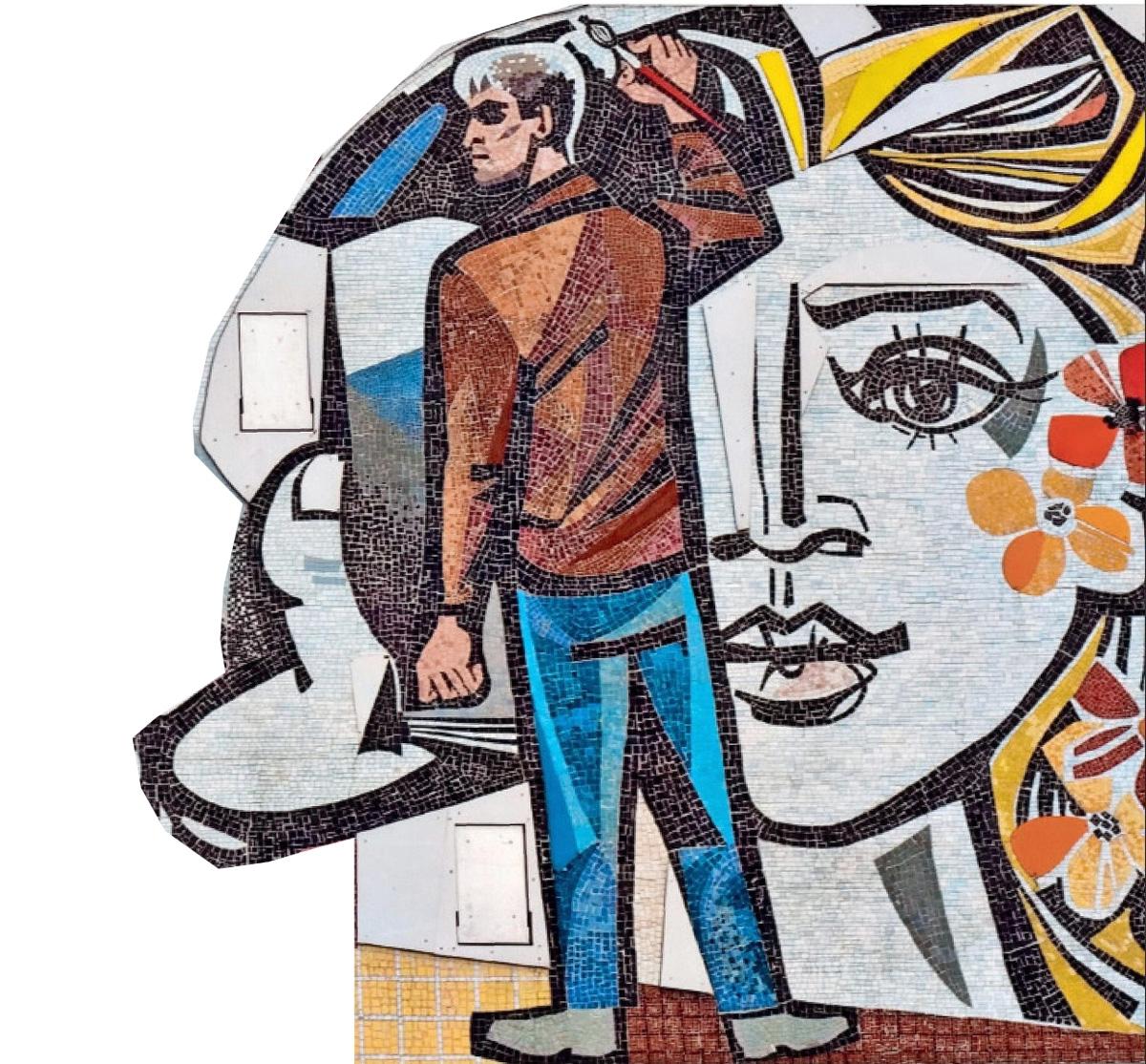

![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)