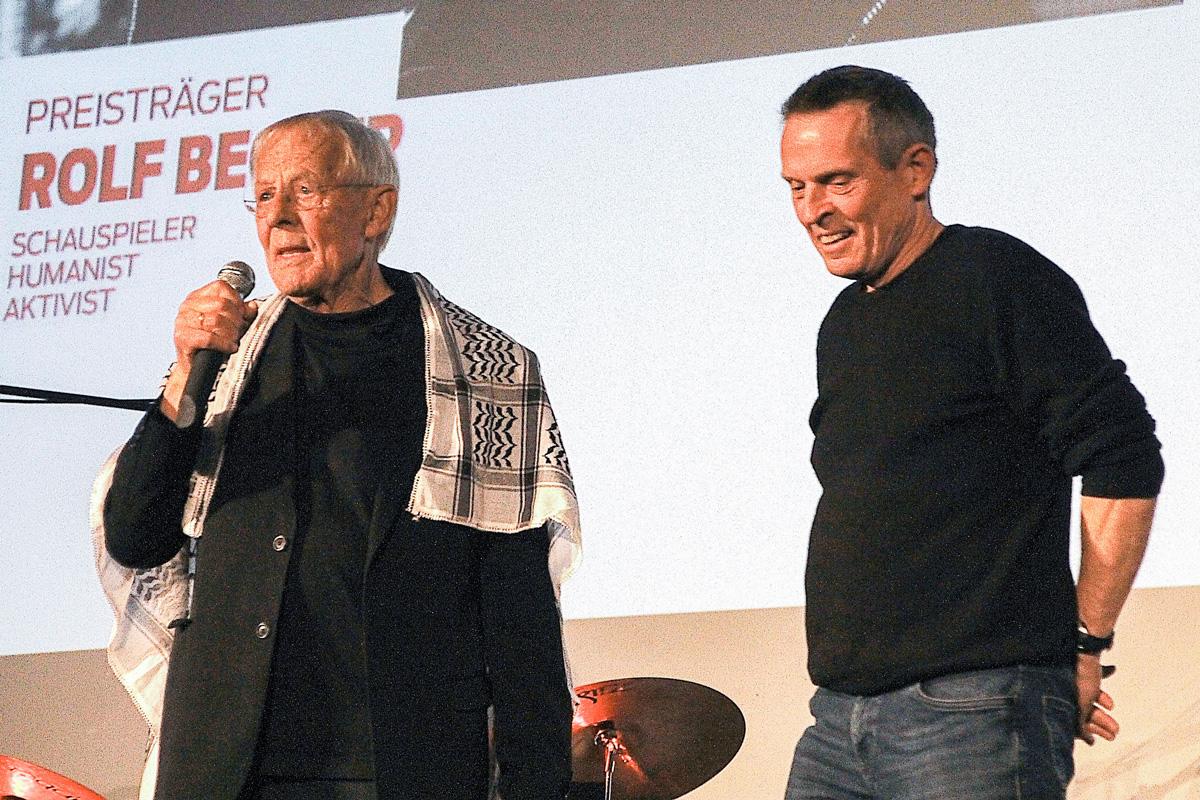Georg Lukács wurde am 13. April 1885 in Budapest geboren. Mit diesem Beitrag von Hans Heinz Holz, erstmals erschienen in „junge Welt“ vom 13. April 2010, erinnern wir an den 140. Geburtstag des großen Philosophen, Literaturwissenschaftlers und Kommunisten. Wir danken „junge Welt“ für die freundliche Genehmigung, den Beitrag nachdrucken zu dürfen.
Unter den marxistischen Wissenschaftlern ist Georg Lukács eine geradezu legendäre Figur. Von der Literaturwissenschaft zur Soziologie und Philosophie reicht seine Wirkung, und keiner von den Jüngeren – selbst wenn sie ihm höchst kritisch gegenüberstehen – könnte den Einfluss leugnen, der von dem temperamentvollen und präzis formulierenden Gelehrten auf jeden von ihnen ausgegangen ist.
Der Name Georg Lukács hat auch in der bürgerlichen Wissenschaft einen guten Klang. Er ist verknüpft mit den aktuellen Auseinandersetzungen über die ideologischen Positionen im geistigen Ringen unserer Zeit wie auch mit der tiefschürfenden Analyse der philosophischen und literarischen Entwicklung seit der Aufklärung. Lukács’ Thesen, unnachsichtig gegen eingewurzelte Vorurteile und streitbar wie die besten Traditionen klassischer Polemik, sind der Sprengstoff wissenschaftlicher Diskussionen. In profundester Sachkenntnis fundiert, vom Elan einer exakten, Theorie und Praxis vereinigenden Methode getragen, kann Lukács auch bei seinen Gegnern Achtung und Beachtung erzwingen.
Um revolutionäre Praxis
Die Klarheit und Prägnanz, die das Denken von Georg Lukács auszeichnet, ließ ihn zu einer Art wissenschaftlichen Gewissens für alle diejenigen werden, die in dem Irrgarten der gegenwärtigen Geistesverwirrung den rechten Weg verloren hatten oder nicht finden konnten.
Georg Lukács wollte als Marxist Erkenntnis als politische Aktion. Als solcher will er nicht weltfremde Wissenschaft an sich betreiben, sondern die theoretische wissenschaftliche Wahrheit in revolutionäre Praxis umsetzen. Es kam ihm nicht nur darauf an zu entdecken, was gewesen ist; aus der Vergangenheit versuchte er das Werden der Gegenwart, die Triebkräfte und Faktoren unserer Zeit zu verstehen und zugleich die Erkenntnis des historisch richtigen, notwendigen eigenen Verhaltens abzuleiten. Nicht, was geworden ist, sondern was not tut ist die Grundfrage aller wohlverstandenen Wissenschaft. Nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft ist ihr Anliegen. Und diese Zukunft soll eine bessere sein. So steht das Pathos einer großen Idee im Hintergrund seiner Arbeit.
Der kleine agile Ungar mit dem scharfgeschnittenen Gesicht und dem noch schärfer zugeschnittenen Intellekt war immer ein Kämpfer. Schon seine frühen Schriften, vor dem Ersten Weltkrieg verfasst, enthielten geistigen Sprengstoff. Sie gehören in die Aufbruchbewegung jener Jahre, die mit den alten Formen der Wissenschaft und Kunst brach, die die bestehende Gesellschaftsordnung ablehnte, die eine Revolutionierung der Gemüter bewirkte und der politischen Revolution den Boden bereitete, dem Prinzip getreu: „Die Avantgarde steht links.“ Später hat Lukács seine ersten Werke, „Die Seele und die Formen“, die „Theorie des Romans“, „Geschichte und Klassenbewusstsein“, verworfen; er hat den „Avantgardismus“ verpönt und den Expressionismus, gar die surrealistische Montage als Verfallformen der Literatur abgelehnt, ihnen das klassizistische Ideal eines integralen Realismus (im Sinne Thomas Manns) entgegengestellt. Dennoch blieb er, auch im Wandel seiner Auffassungen, erfüllt von dem Impuls jener Jugendzeit, einem Impuls, der zur Aktivierung der Theorie drängte, der Wissenschaft und Kunst als Mittel der Weltveränderung verstand und sie in politische Tat umsetzen wollte.
Klassisches Erbe als Richtschnur
So wurde für Georg Lukács Erkenntnis zu politischer Aktion. Zweimal nahm er an Erhebungen teil, einmal als Kommissar für Volkserziehung in der Revolutionsregierung des ungarischen Kommunistenführers Béla Kun am Ende des Ersten Weltkriegs, zum zweiten Mal als kurzzeitiger Kultusminister in dem Kabinett von Imre Nagy, nicht zum ersten Mal in seinem Leben irregehend, in den verhängnisvollen Herbsttagen der ungarischen Konterrevolution 1956. 1919 zwang ihn die Niederschlagung der Revolution durch die Horthy-Faschisten ins Exil. 1956 durfte er nach kurzer Verbannung wieder nach Budapest zurückkehren und konnte im Zuge der ausgleichenden Befriedungspolitik Kádárs seine wissenschaftlichen Arbeiten fortsetzen. Heute erscheinen seine gesammelten Werke in Westdeutschland, zunächst im Luchterhand-Verlag, heute im Aisthesis-Verlag. Sozusagen als Fazit eines langen Lebens in den Wirrnissen unserer Zeit, irrend, suchend, engagiert, kündigte der Achtzigjährige ein umfassendes Werk über marxistische Ethik an, zu dessen Ausarbeitung er nicht mehr gekommen ist.
Mehr als zwanzig Jahre galt Lukács’ Kampf dem Faschismus. Sein Anknüpfen an die Aufklärung, seine Kritik des Irrationalismus in den Studien unter dem Titel „Die Zerstörung der Vernunft“, seine Auseinandersetzung mit der Hegelschen Philosophie galten der Mobilisierung der ideologischen Widerstandskräfte gegen die Hitlerbarbarei. Dieser leidenschaftliche Einsatz für humanitäre Traditionen und für einen humanen Realismus der Zukunft führte ihn zum klassischen Erbe in der Literatur, zu Walter Scott und Honoré Balzac, zu Goethe und Tolstoi; in der Weltliteratur des 18. und 19. Jahrhunderts suchte er die lebendigen Kräfte des unentfremdeten Menschentums freizulegen, die ein Maßstab und eine Richtschnur für die Gegenwart sein konnten. In den dreißiger Jahren entstanden seine großen literaturwissenschaftlichen Essays über den Realismus. Die politische Auseinandersetzung mit dem deutschen Phänomen kommt hinzu: der Aufsatz über das Preußentum, die Studien über Nietzsche und den deutschen Faschismus und über Hegel und den deutschen Faschismus. Unermüdlich als Schriftsteller, der das geistige Erbe als eine aktive Potenz in der Auseinandersetzung um die Lebensform des Menschen von heute und morgen betrachtet und wirksam erhält, ging Georg Lukács seinen Weg.
Soziologische Betrachtungsweise
Der Tendenz seines Schaffens gemäß entwickelte Lukács eine eigene Methode, die inzwischen Schule gemacht hat: die soziologische Betrachtung der Literatur und Philosophie, die das Kunstwerk und das Denksystem als eine durch die gesellschaftliche Struktur seiner Entstehungszeit bedingte Antwort auf eben diese gesellschaftliche Situation versteht. Ein Meisterwerk in der Anwendung dieser Methode ist seine Untersuchung des historischen Romans. Hier führt er eine literarische Gattung auf ihre soziologischen Hintergründe zurück, zeigt auf, wie die Veränderungen der Gestaltungsweise innerhalb dieser Gattung auf dem Wandel in der Einstellung zur Geschichte beruhen, wie dieser Wandel eine Widerspiegelung historischer Prozesse ist; und unversehens gewinnt er dabei einen Wertmaßstab für die Beurteilung des historischen Romans, der aus seiner „gesellschaftlichen Richtigkeit“ abgeleitet werden kann. Ein exakter Historiker wie Walter Markov hat wohl nicht Unrecht daran getan, als er in der Festschrift zum siebzigsten Geburtstag von Georg Lukács gerade im Hinblick auf seine Methode dem derart kritisch aufgenommenen historischen Roman einen über die Grenzen der wissenschaftlichen Historie hinausreichenden objektiven Erkenntniswert zuschreibt – und Bert Brechts nachgelassenes Romanfragment „Die Geschäfte des Herrn Julius Caesar“ macht dazu sozusagen die Probe aufs Exempel.
Entlarvung als Methode
Das Pathos des Klassenkampfs trübt keineswegs die Sauberkeit seiner Untersuchungen; es schärft vielmehr den Blick für das Wesentliche und macht die Methode zum chirurgischen Instrument, das die zentralen Organe einer geistesgeschichtlichen Lebenseinheit freilegt. So etwa in seiner grundlegenden Darstellung des jungen Hegel, in der er die Beziehungen von Philosophie und Ökonomie heraushebt, oder in seiner Kritik des deutschen Irrationalismus im 19. und 20. Jahrhundert. Die Methode der Philosophiegeschichte ist hier die Entlarvung: Die hochtrabenden metaphysischen Ansprüche der irrationalistischen Philosophien werden auf ihre historisch-gesellschaftlichen Bedingungen reduziert und ihr sozialer Auftrag – Verschleierung, Ablenkung, Unterdrückung der fortschrittlichen Entwicklung – wird aufgewiesen. Daneben stehen die Werke, die sich dem Realismus in der Literatur des 19. Jahrhunderts widmen. In diesen wird das positive Erbe der vergangenen Zeit herausgestellt und in eine bestimmte Perspektive gebracht. Leitender Gesichtspunkt ist die Widerspiegelung der widerspruchsvollen Tendenzen und Kräfte der bürgerlichen Welt.
So sind Lukács’ literatur- und philosophiegeschichtliche Arbeiten die breite Basis zu einer überschauenden Darstellung der bürgerlichen Welt. Bewusst beschränkt Lukács sich auf diese Gesellschaftsepoche. Die Fragen der Antike, der mittelalterlichen Feudalgesellschaft, das von Mehring angegangene Problem der Entstehung der Neuzeit liegen ihm fern. Mit der Aufklärung und der Vorbereitung der Französischen Revolution setzen seine Studien ein und folgen dem Lauf der kapitalistischen Gesellschaft bis in ihre letzte, faschistische Form. Wohl keiner ist in die innere Dialektik und Problematik dieser historischen Bewegung so tief eingedrungen wie Lukács, der die ideologischen Reflexe dieses Prozesses im Rückbezug auf ihre Basis genauestens beschrieben und gedeutet hat. Manche seiner Wertungen mögen dabei umstritten sein. Die Gesamtkonzeption bietet jedoch das geschlossenste und überzeugendste Bild jener Periode, das bisher überhaupt gegeben wurde.
Polemischer Stil
Dem politisch-historischen Aspekt der Lukácsschen Theorie entspricht auch ein ihm eigener Stil, den man in zweifacher Hinsicht als „polemisch“ bezeichnen könnte: im äußerlichen Sinne als Polemik gegen die idealistische Behandlung der Geistesgeschichte, in einem tieferen Sinne jedoch auch als Polemik mit seinem Gegenstande selbst, als kritische Bloßlegung der Schwächen und gesellschaftlichen Fehlerquellen der Großen der Weltliteratur, als Entlarvung des Zusammenhangs zwischen dem Denken eines Schriftstellers und seiner Position in den sozialen Auseinandersetzungen seiner Zeit. Lukács war zu sehr Wissenschaftler, um dabei einseitig zu sein.
Er erkannte durchaus, dass gerade die politische Entscheidung eines Autors ihn zu einer literarisch mangelhaften Enge des Geistes und der Darstellung führen kann, während innere Zwiespältigkeit, schöpferisch gestaltet, dem Reichtum einer gesellschaftlichen Situation besser gerecht zu werden vermag. So ist ihm Zola zwar der politisch Klarere, Bewusstere, Balzac aber der künstlerisch Reichere, der „Richtigere“, Realistischere (im Gegensatz zu einem der vollen Wirklichkeit nicht gerecht werdenden Naturalismus). Diese Betrachtungsweise kritisch auf die Literatur des „sozialistischen Realismus“ angewandt zu haben, wurde Lukács von seinen marxistischen Kollegen gerade zum Vorwurf gemacht.
Subjektives Moment betont
Der revolutionäre Impuls, von dem Lukács ausging, prägte nicht nur seine ideologiekritische Methode, nicht nur seinen polemischen Stil. Er hielt sich vielmehr auch gerade im Allgemeinen, ich möchte sagen „metaphysischen“ Aspekt seiner Theorie durch. Das subjektive Moment in der Geschichte schien ihm immer ein entscheidender Faktor, eine treibende Kraft der Entwicklung zu sein. Die Abhängigkeit des Bewusstseins von den gesellschaftlichen Bedingungen besagt für ihn nicht, dass das Bewusstsein auf diese Bedingungen nicht auch verändernd einwirken könne. Derart stellt sich ihm die Geschichte als eine komplizierte Subjekt-Objekt-Dialektik dar, in der der Mensch, in dem sich die objektive, widerständige Welt und das subjektive, hochfliegende Wollen schicksalhaft kreuzen, die Schlüsselposition innehat.
So bewegt sich das Lebenswerk dieses großen Denkers und Streiters im Raume zwischen Ökonomie, Philosophie und Dichtung. Die wechselseitigen Beziehungen zwischen der ökonomischen Basis und dem gedanklichen Überbau werden nach den Methoden des historischen und dialektischen Materialismus erforscht, die Rolle der objektiven Bedingungen und die Funktion des subjektiven Faktors gegeneinander abgegrenzt und miteinander vermittelt. Die von Lukács erstmals und von ihm allein in so umfassender Weise erprobte Anwendung der marxistischen Geschichtserkenntnis auf die Literatur hat zu Ergebnissen geführt, die für alle weitere Beschäftigung mit geisteswissenschaftlichen Problemen richtungweisend sind.
Von den ersten Jugendschriften an bleibt das aktivistische Moment in Lukács‘ Denken erhalten; der „klassenkämpferische Humanismus“, der der Kern dieser Theorie ist, verliert jedoch in der Durchführung des Gedankens zuweilen den konkreten, leibhaftigen Menschen aus dem Blick und erstarrt zu einem Schema – eine Gefahr, der auch Lukács nicht immer entronnen ist. So werden gelegentlich bei ihm und öfter bei seinen Epigonen die inhaltsvollen Begriffe der Literatursoziologie zu leeren Abziehschemata, mit denen nur mehr das Gerippe, nicht aber mehr die menschliche Fülle des Kunstwerks dargestellt werden kann.
Auch Georg Lukács war davon bedroht – und es macht die Bedeutung und Größe seines Werkes aus, dass er stets wieder die eigenen Schematismen überwinden und die ganze unverkürzte Realität des Menschen in seinem Denken reproduzieren konnte.



![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)