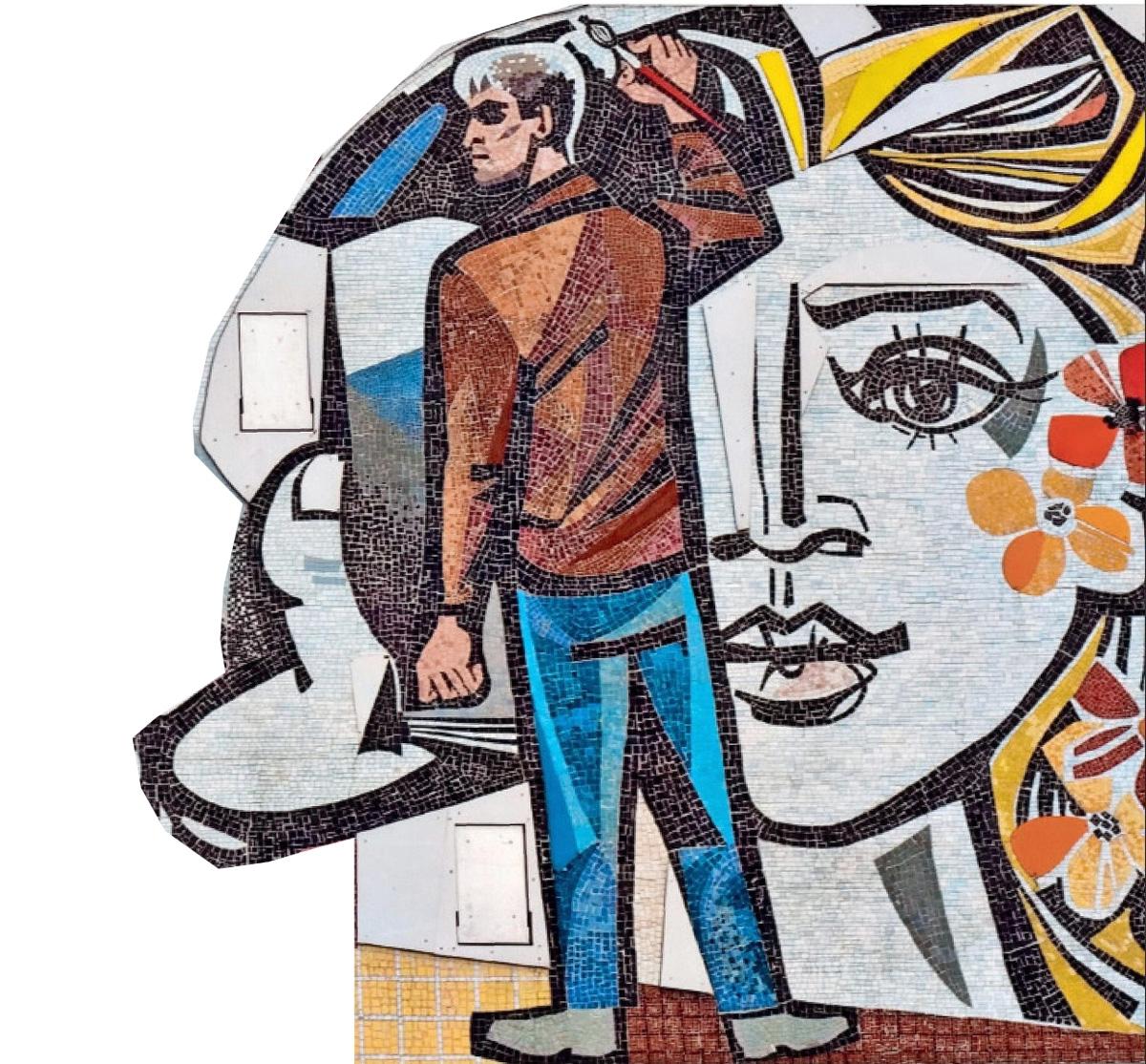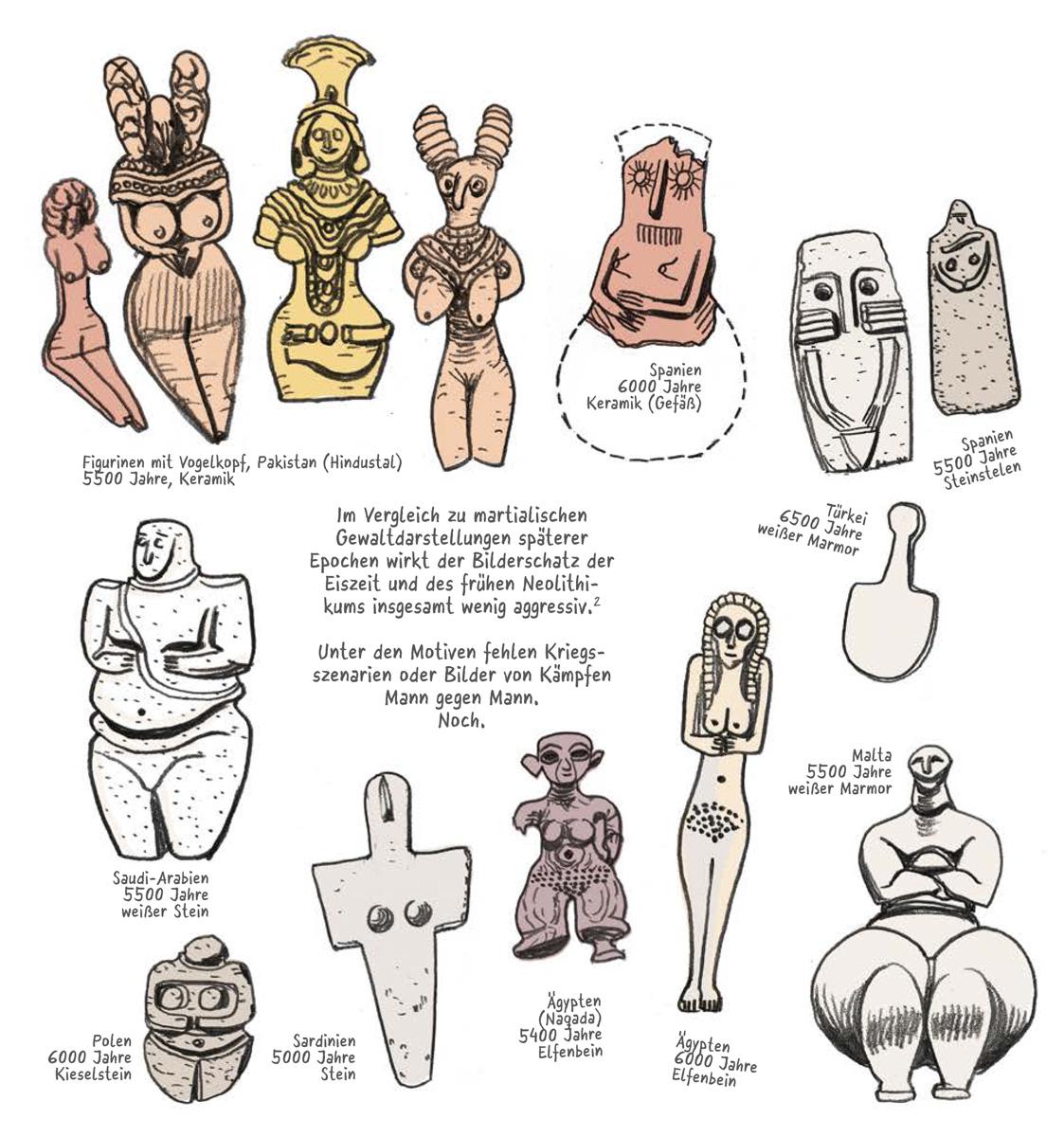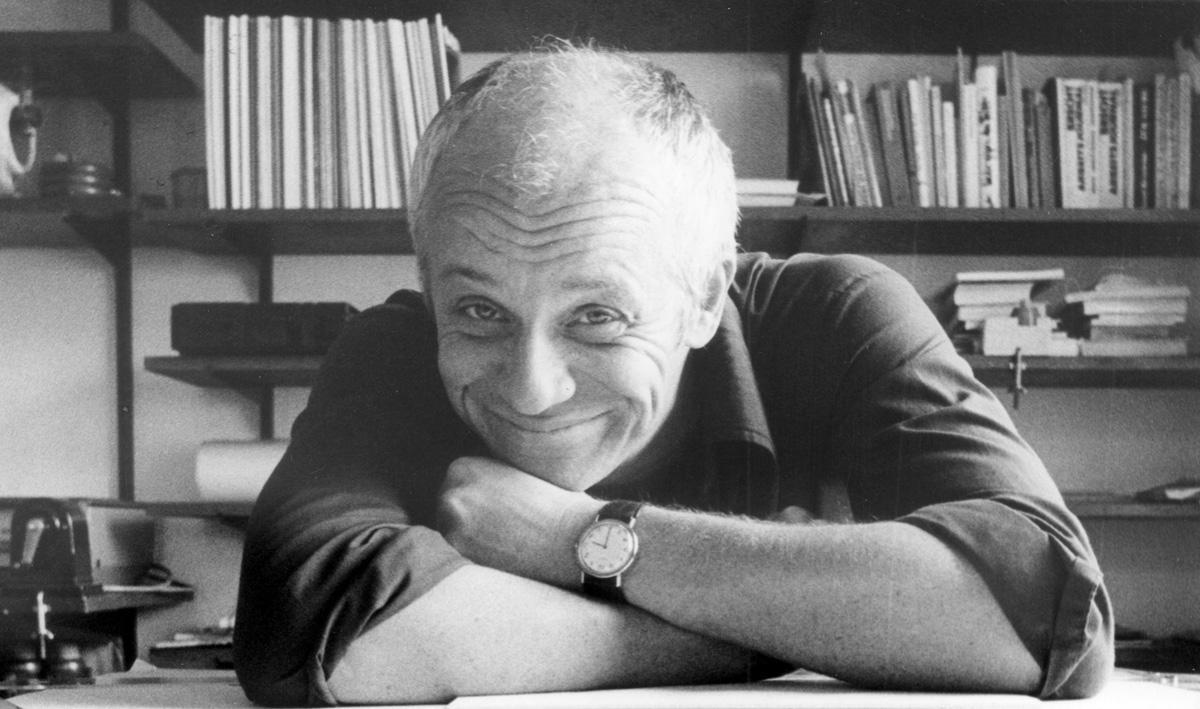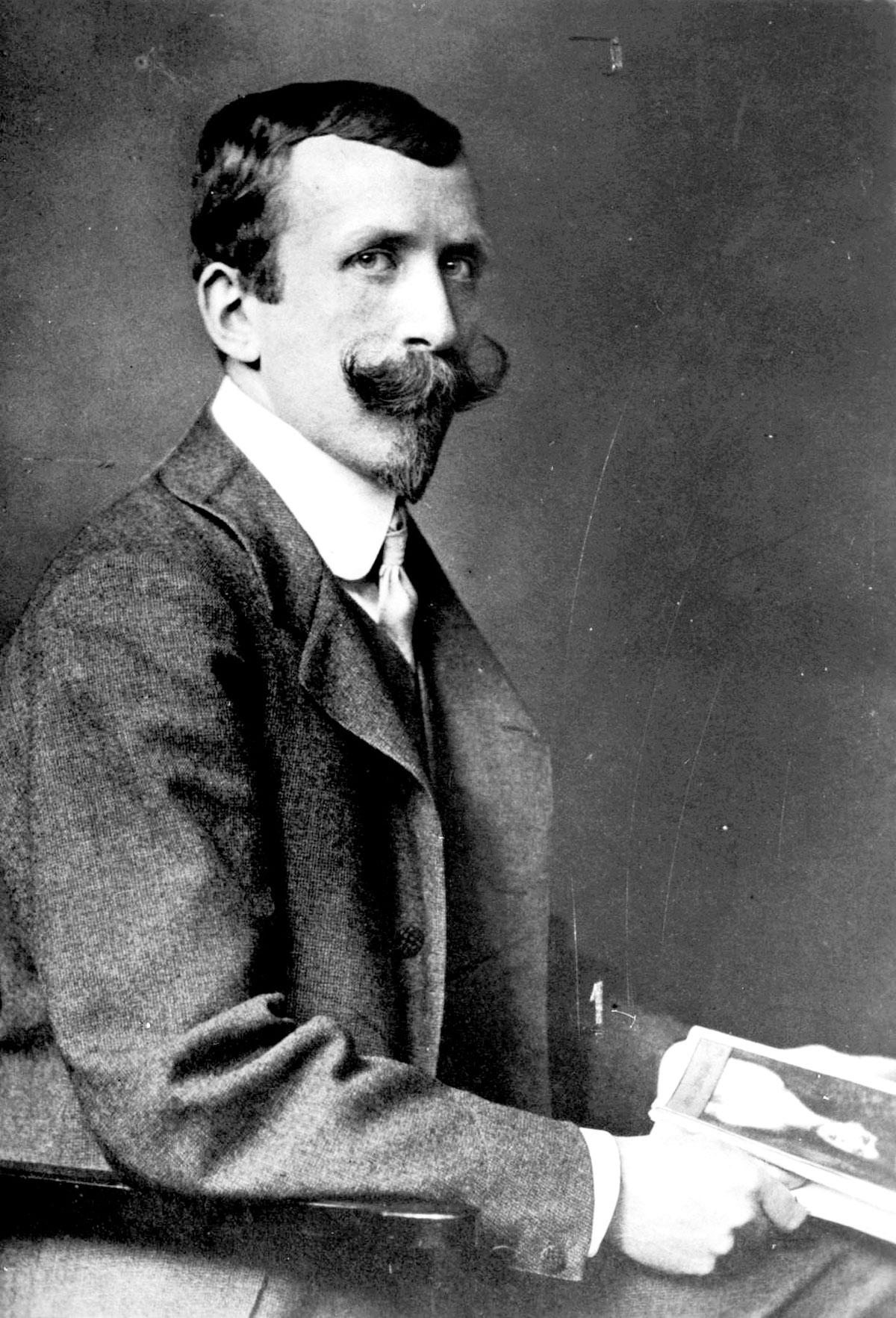Von der Utopie ist der Utopismus gleich weit in die religiöse Richtung entfernt wie der Moralismus von der Moral. „Gertraud Klemm hat einmal zu mir gesagt: ‚Zuerst schreibst du, wie es ist, und dann schreibst du, wie es sein kann.‘ Damals wusste ich noch nicht, dass sie recht hat, und tatsächlich bildet ‚Die Wut, die bleibt‘ die Realität ab, während ‚Und alle so still‘ zeigt, wie die Welt sich ändern könnte.“ Was da Mareike Fallwickl in ihrer Danksagung zu „Und alle so still“ von ihrer österreichischen Schriftstellerkollegin zitiert, ist ein poetischer Ratschlag mit viel Gehalt. Literatur setzt an der Welt an, in der sie verfasst wird, und weist als Vorgriff über das Gegebene hinaus. Kühnheit als Pflicht.
Fallwickl nun hat in ihrem Nachtrag, der nicht nur jenen dankt, die ihr für die Zuarbeit ihres Buchs „Und alle so still“ bei Recherche, Lektorat und Leben neben dem Schreiben geholfen haben, das zusammenschnurren lassen, was man vorab auf Romanlänge lesen konnte. Anders als „Die Wut, die bleibt“, in dem der Protest autoaggressiv geschieht, durch einen Sturz vom Balkon, ist der Widerstand gegen doppelte Ausbeutung und patriarchale Gewalt hier weit weniger selbstverletzend und immens erfolgreich.
Eine der ersten Frauen, die sich dem System verweigert und sich vor einem Krankenhaus ablegt, verweist auf den Streik der Roten Strümpfe, als im Oktober 1975 auf Island ein Zehntel der Bevölkerung streikte; Frauen, die alle Arbeit verweigerten, als Krankenpflegerin, Lehrerin und Mutter, und so bis dato auf der Insel ungekannte Rechte für sich erkämpften. „Im Oktober 2023 haben sie es nochmal gemacht. Hunderttausend Frauen haben ihre Arbeit niedergelegt, für einen Tag, die bezahlte und die unbezahlte. Die Gesamtbevölkerung von Island beträgt dreihundertsiebzigtausend.“
Zu jenem Zeitpunkt, als das eine der streikenden Frauen ihren Mitstreiterinnen sagt, hat ihr Protest schon ungekannte Ausmaße erreicht: Das kaputte Gesundheitssystem ist genauso kollabiert wie die meisten Lieferketten. Wer sich dagegen stemmt, ist Ruth, eine Pflegerin, die ihren Dienst im Krankenhaus längst gegen etwas getauscht hat, das man ein eigenes Leben nennen könnte; eine, die nicht streikt, weil ihr Fürsorgepflichtbewusstsein internalisiert ist und der man nicht erst sagen muss, wie relevant sie ist. Nuri derweil – ein „Wegwerfmensch“, migrantisch, Arbeiterkind, ohne Schulabschluss, alles andere als ein Heteroalphamännchen – versucht noch sein Glück, in den Wirren Jobs per App zu finden. „Er ist neunzehn und fühlt sich alt wie ein Klumpen Erde“, heißt es über den Krankenbettenschieber, Putzer, Essenauslieferer und was sonst noch für maximalprekarisierte Notwendigkeiten anfallen, sich zu verdingen. Eine Festanstellung im Onlineshop, der Fallwickls Merchandise vertreibt, käme ihm einem Traum gleich. „Wie kann es sein, dass Menschen unter solchen Bedingungen arbeiten an den Rändern der Tage und Nächte? Es ist, als gäbe es eine zweite Stadt hinter der eigentlichen. Eine, in der alle unsichtbar sind.“
Nuri lernt Elin kennen, Ruths Nichte, die von der Existenz ihrer Tante bislang nichts wusste, auch wenig über ein Leben von der Hand in den Mund, betreibt ihre formalfeministische Mutter doch ein Wellnesshotel und engagiert sich die Tochter mit gutlaufendem Instagramaccount selbst als dessen Werbeikone. Elin, zwei Jahre älter als Nuri, erfährt bei einem Date sexualisierte Gewalt, als der Mann unabgesprochen das Kondom abstreift.
Der sich mit der Frauenbewegung alliierende Nuri ist eine der wenigen Männerfiguren, die das Aufbegehren („Aber es ist kein Aufstand, nicht einmal wörtlich, niemand steht.“) gutheißen, während das spontan kollektivierte „I would prefer not to“ („Ich möchte lieber nicht“), das Herman Melvilles Schreibgehilfe Bartleby als letztverbliebenen Akt seiner sonst eingestellten Emsigkeit wiederholte, von den Männern mit Gewalt beantwortet wird. Streikende Frauen werden überfallen, vergewaltigt, ermordet; der Staat verbietet die Arbeitsniederlegung, genauso wie das symbolische Ablegen im öffentlichen Raum.
Der Kampf ums Ganze, gegen Ausbeutung und Unterdrückung, verdient so sehr Sympathie wie „Und alle so still“ als schnöde Agitpropliteratur Kritik. Das, was der Theorie von Haupt- und Nebenwidersprüchen mindestens in deren Anwendung nicht stets zu unrecht vorgeworfen wurde, nimmt hier selbst feministische Gestalt an: Alle Frauen sind sich ohne Männer schnell einig, keiner behagt es nicht, wenn sie sich mit einer Kopftuchträgerin einhaken muss, oder einer Transfrau, oder einer, die davon profitiert hat, dass das Kapital mittlerweile weiß, dass Managerinnen und Regierungspolitikerinnen systemrelevant im für die Ausgebeuteten schlechtesten Sinne sind. Stattdessen sind es Polizistinnen, die streikende Geschlechtsgenossinnen aus dem Knast befreien und damit etwas zutage tragen, das stets auch Instrument regressiver Machtstabilisierung war, wenn es darum geht, dass es so Bullshit wie weibliche Intuition gibt: „Aber Elin hat Gänsehaut und ein konkretes Bild vor Augen. Wenn nichts von dem, was gerade passiert, geplant war, war es eine intuitive Idee, das Einzige, was den Frauen geblieben ist, einzusetzen? Den eigenen Körper dort abzulegen, wo er sogar im absoluten Erschöpfungszustand noch eine gewisse Wirkmacht hat?“
Auf literarischer Ebene keine Parteien mehr, sondern nur noch Gender zu kennen, ist für einen Roman nichts, was verdammt sein muss. Dafür aber, dass die in „Und alle so still“ getauschten Argumente nicht nur wenige sind und für die Gegenseite herausragend billig gepickt wurden, darf durchaus eingewandt werden, dass hier ein utopistischer Roman sowohl die Bindung an eine Welt aus mehr als nur einem Widerspruch verloren hat, als auch das Ding Literatur verfehlt. Elin beginnt etwas mit Charlie, die in ihrem Pathoskitsch allen anderen Figuren mit Redeanteilen in nichts nachsteht, deren Phrasen aber – es muss schließlich erwähnt sein, weil es ja das Gegenteil dessen ist, was da zu lesen ist – „nicht dramatisch“ seien, „sondern klar.“ Genau: Gänsehaut.
Mareike Fallwickl
Und alle so still
Rowohlt-Verlag, 368 Seiten, 23 Euro



![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)