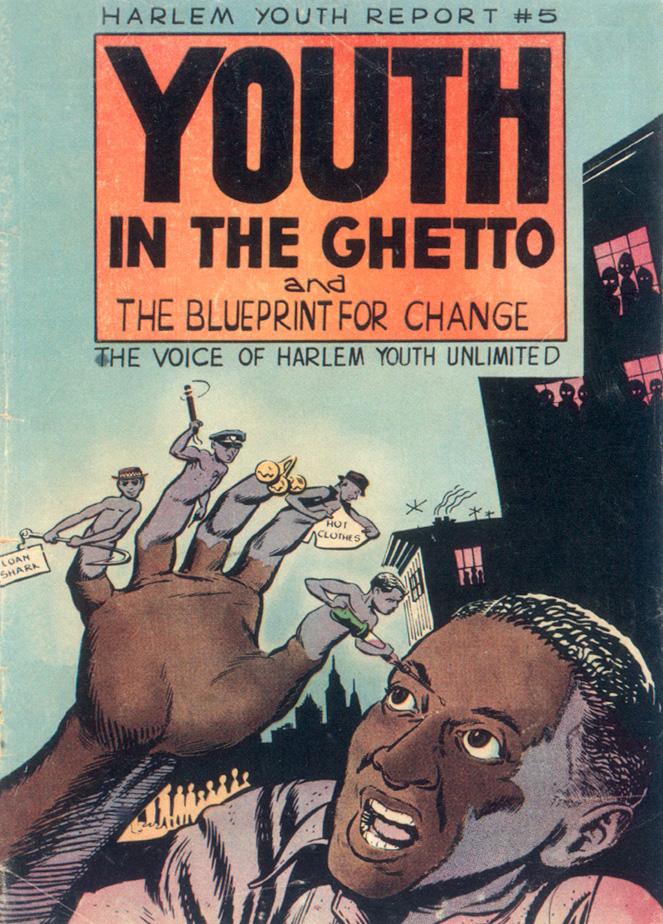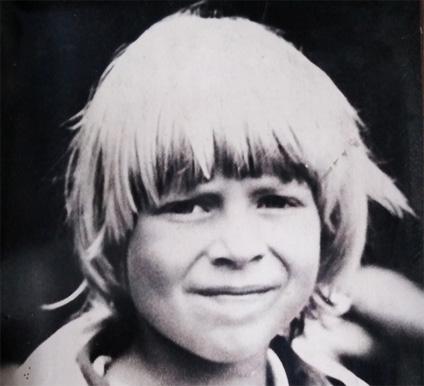Irgendwann in den 90er Jahren traumatisierten meine Frau und ich unsere keine zehn Jahre alten Kinder mit der Nachricht von einem Zusatzstoff für Brötchen, der aus Menschenhaaren gewonnen sei. Als ich jetzt nach einer Bestätigung für meine Erinnerung suchte, stieß ich bei „Zeit.online“ auf einen Artikel aus dem Jahr 2001. Er beantwortete die Frage, ob „das typische Aroma eines Brötchens ursprünglich aus dem Haar von Chinesen gewonnen wurde?“: Das sei bis vor Kurzem so gewesen, schrieb der „Zeit.online“-Autor, eine Boulevardzeitung habe „das einmal zu den ‚Schamhaaren thailändischer Prostituierter‘“ überhöht.
Das Wort „überhöhen“ mit Bezug auf Schamhaare ist stilistisch mutig gewählt, der Sache nach ging es um die Aminosäure Cystein, die als „Mehlbehandlungsmittel“ E 920 in der EU zugelassen ist, aber nicht deklariert werden muss. Weil sie ja nur im Teig, nicht in der gebackenen Ware wirkt. Menschliches Haar als Ausgangssubstanz verbot die EU ab 1. April 2001, ließ aber Schweineborsten weiterhin zu. Seither wird das Zeug aber vor allem aus den Ausscheidungen genveränderter Darmbakterien gewonnen. Die EU vertreibt den Ekel aus der Welt.
Der Verdacht, dass das Westbrötchen seine typische Konsistenz (laut ostdeutschem Volksmund wie die des Wessis: Außen knusprig, innen hohl) nur mit solchem Doping erreicht, ist jedenfalls bestätigt. Eine kleine Recherche zur DDR-Schrippe ergibt: Die kam ohne Zusatzstoffe aus. Sie bestand und besteht aus Weizenmehl Type 405, frischer Hefe, Zucker, Wasser und Salz. Bäckermeister Werner Gniosdorz aus Potsdam fügte dem 2018 in der „Berliner Morgenpost“ hinzu: Er habe nach 1990 auf West-Technik umgestellt, da seien die Kunden weggeblieben. Er habe sie mit dem DDR-Rezept zurückgewonnen: Keine Emulgatoren, keine Teigstabilisatoren und der richtige Ofen, kein Umluftofen. Der Berliner Bäcker Thorsten Schnell sagte dem „Berliner Kurier“ im Jahr 2018: „Das Mehl in der DDR war unbehandelt, also frei von Ascorbinsäure und Enzymen.“ Der Teig sei damals mit mechanischem Werkzeug schonend geknetet worden statt mit modernen Spiralknetern. Und Bäcker Peter Wese verriet der „Märkischen Allgemeinen“ schon 2009: Zur alten Rezeptur gehört „Hellegold“, ein Malzmehl, das für Geschmack und Bräune der Schrippe sorgt – es kommt seit 1907 aus Teltow und ging in so ziemlich alle DDR-Bäckereien.
Zeitweise zog die Ostschrippe in den 90ern bis in den „Spiegel“ hinein Hass auf sich. Das ist vorbei. Heute liegen vielerorts Brötchen „nach alter Rezeptur“ friedlich neben denen „nach neuer“ – in getrennten Körben. Erst im November wurden von Lesern der „Leipziger Volkszeitung“ die jeweiligen „DDR-Brötchen“ aus drei Bäckereien zu den besten des Landkreises Leipzig gewählt.
Das Entsetzen unserer Kinder erscheint jedenfalls gerechtfertigt. Noch entsetzter wären sie gewesen, hätten wir vorhergesagt, dass ein Brötchen zu ihren Lebzeiten einmal einen Euro, also zwei Mark, kosten werde. Die „Allgemeine Bäckerzeitung“ kündigte das jüngst an. In der DDR kostete ein Brötchen fünf Pfennig. Das wurde sogar literarisch gefeiert. Der Regisseur und Schriftsteller B. K. Tragelehn schmachtete zum Beispiel einst in seiner „Ode an zwei Brötchen“: „Sättigende! Billige! 5 Pfg. das Stück. / Ihr vom Erlös der leeren Milchflaschen / Erschwinglichen! Ihr / In der rauhen Zeit vor Honorarempfang / Treuen! // Braune! Knusprige! Innen weiße und weiche.“
Der damals noch westdeutsche Dichter Ronald M. Schernikau veröffentlichte 1986 in der „Deutschen Volkszeitung“ eine Reportage aus dem Backwarenkombinat Magdeburg unter dem Titel: „Der Weg der Brötchen in den Sozialismus“. Darin hieß es: „Alle, mit denen ich gesprochen habe, alle sagen: Fünf Pfennig für eine Schrippe, das ist zu wenig. Wir aasen mit dem Zeug, weil wir es nachgeschmissen kriegen. 73 Pfennig für ein Brot, das ist nicht gut. Die Leute kaufen sich im Konsum ein Brot und gehen bei Privats vorbei; wenn sie dort noch eins gekriegt haben, schmeißen sie das Konsumbrot weg. Das machen die Preise.“
Hermann Kant hat 1981 in „Der dritte Nagel“ das Brötchenproblem der DDR zusammengefasst: Wer sich beim Bäcker nicht anstellen wollte, sondern seinen privilegierten Schrippenbeutel an einen Nagel im Hof hängen durfte, konnte scheitern. Wie der Staat. Die Backware ohne Haare- und Borstenkram allerdings bleibt.


![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)