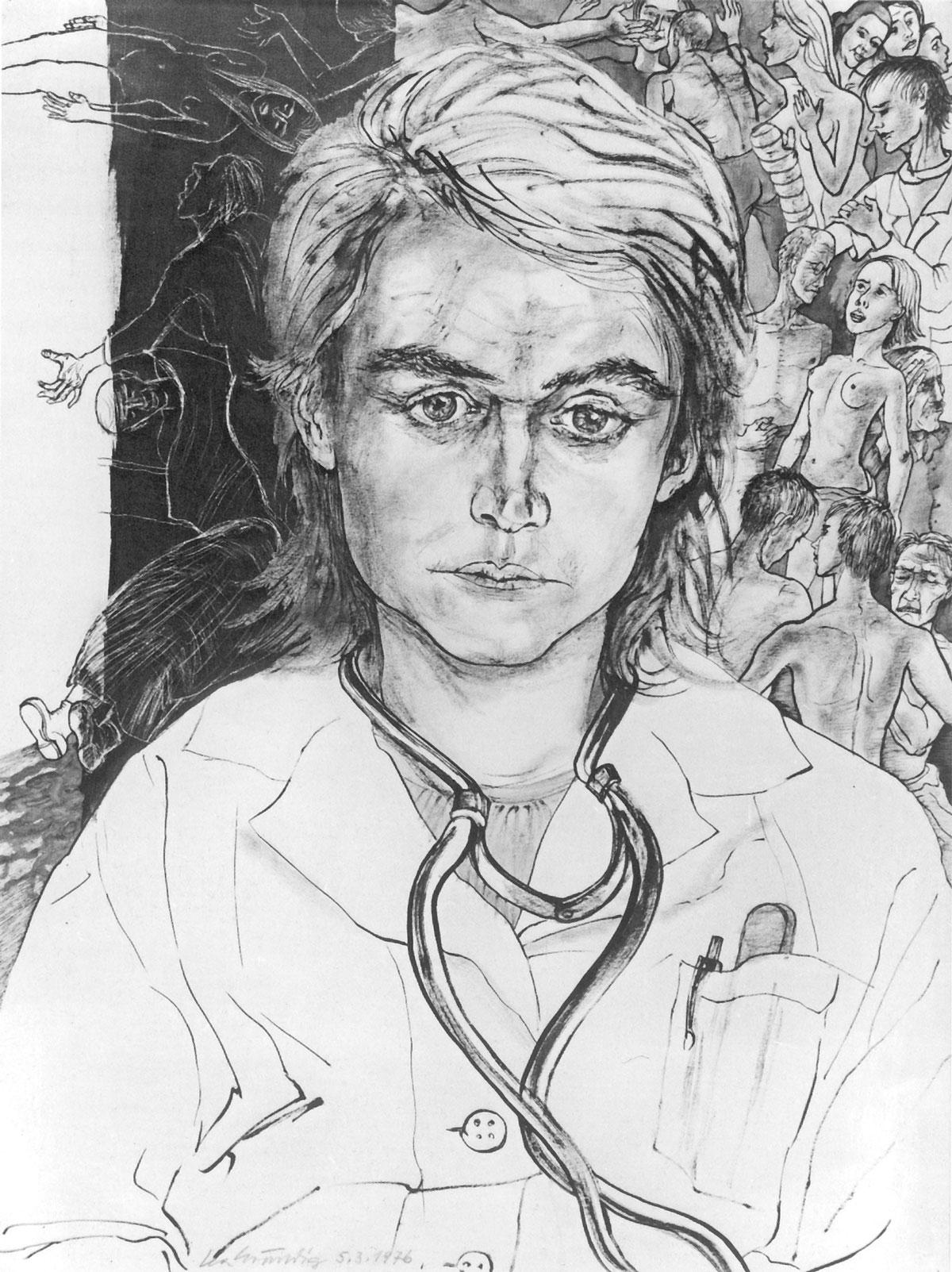Eine Quote von hundert Prozent: alle, wirklich alle, die nicht nachvollziehen wollen, warum man sich auf theoretisches Wissen beruft, das „alt“ ist, teils aus dem 19. Jahrhundert stammt, steigen in den Linienbus ein, auf den sie gewartet haben. Sie bleiben nicht stehen und warten auf den Bus mit Schwebeantrieb oder dass Scotty sie zum Ziel beamt, um – wären sie konsequent – das Rad als Steinaltding zu boykottieren.
Das Rad in der Popmusik ist die Ballade. Ihre Strophen-Refrain-Form dominiert bis heute, was wir im Autoradio hören, alles andere wirkt auf uns befremdlich, muss als avantgardistisch oder post-irgendwas gekennzeichnet sein und ist eh meist aus dem Radio verbannt. Ausnahmen gibt es, aber selbst die sind als solche klar markiert, wie Queens „Bohemian Rhapsody“.
In Anlehnung an Goethe (also einer von den Köpfen, die uns angeblich nichts mehr zu sagen haben, weil sie aus einer anderen Zeit stammen, was für manche heißt: aus einer anderen Welt) und dessen Theorie von der Ballade als „Ur-Ei“, die alle Gattungen der Poesie in sich trägt, leitet Peter Hacks ab, „dass eine Kunstsorte (wie die Ballade), die das lyrische, dramatische, epische, tänzerische und musikalische Geschäft auf einen Hieb betreibt, in Wahrheit einer fernen Stufe der Menschheitsentwicklung zugeordnet werden muss. Es ist dies die Stufe des magischen Denkens, wo alles noch alles bedeutete und nichts nicht abhing.“
Völlig narrenfrei waren sie dann doch nicht, die ersten Popstars, unter denen die Beatles (auch solche Dinosaurier) am 30. Januar diesen Jahres ihre fünfzigjährige Abwesenheit von der Bühne feiern. Das Rad, das sie (mit-)anstießen, war oval und alles andere als bruchsicher. Eben weil die Ballade als Gussform des Popsongs soviel in sich birgt, ebnete das zum einen seinen ungebrochenen Erfolg und zum anderen unser Leid, wenn wir uns durch eine nicht aufhören wollende Fülle an schlechtem Pop-Gut quälen, bis wir uns zu einigen wenigen Perlen vorgehört haben.
Produktivkraftentwicklung macht es möglich: Songs aufnehmen ist nicht mehr Privileg der wenigen entdeckten Popstar-AnwärterInnen. Es kann auch ein teures Hobby mit Tonstudio auf dem Dachboden sein. Oder ein wenig lukrativer Nebenjob als akustische Untermalung des Kneipenabends.
Die technischen Bedingungen waren Grund für das Pilzkopf-Quartett, ihre Live-Karriere im Anschluss an ihre Nordamerikatour 1967 frühzeitig an den Nagel zu hängen. In ihrem Jahrzehnt, den 60ern, war die Soundtechnik im Vergleich zum heutigen Stand kaum besser entwickelt als zu Zeiten Goethes. Der Hype stand im Widerspruch zu Boxen, die nicht gegen zehntausende kreischende Teenies ankamen. Sie spielten und inszenierten gegen sich selbst, so populär, dass sie sich auf der Bühne nicht hörten, „im Blindflug“ spielten, wie Ernst Hofacker in seinem Buch „1967 – Als Pop unsere Welt für immer veränderte“ (Reclam 2016) schreibt.
Was die Beatles nach ihrem legendären letzten Gig auf dem Dach ihres eigenen Firmensitzes in der Londoner Einkaufsstraße Savile Row bewog, sich im Studio für fünf weitere wegweisende LPs einzusperren, entsprang dann aber doch eher einem Irrtum. War es doch der für die 67er-Tour engagierte Soundman Bill Hanley, der kurze Zeit später mit Monitoren auf der Bühne jene Technik entwickelte, die einem „Quantensprung auf dem Weg zu einer praxistauglichen Bühnentechnik“ (Hofacker) gleichkam.
Sei‘s drum. Denn ein anderer Fortschritt hatte schon wieder die alten Verhältnisse unterhöhlt. Mit „Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band“ war bereits 1967 nicht nur eines der ersten Konzeptalben erschienen, sondern auch – gemessen an der Arbeit beim Abmischen, den aufgenommenen Takes und der Anzahl an Studiomusikern – das Startsignal für den Pop als Heimarbeit. Der letzte Song, den Lennon, McCartney, Harrison, Starr und (als fünftes Rad am E-Piano) Billy Preston damals vor einer zufällig anwesenden Menge spielten, war „Get back“.
Die Verlagerung des Schwerpunkts von der Reproduktion auf der Stage zur akribischen Produktion im Studio war endlich getan – und von den Beatles selbst in „Sgt. Pepper“ thematisch angerissen.
Seitdem hat uns der Pop und seine Neo-Magie, die unsere Bedürfnisse nach schwammig-tumber Weisheit überbefriedigt, so viele Türen eröffnet: wir können konservativ wählen zwischen Schallplatte oder Spotify-Playlist (seit 2015 sind da auch die Beatles zu finden). Zwischen Festival (öffentlich) und kabellosen Kopfhörern (privat). Zwischen „Halo“ von Beyoncé und At the Gates‘ „Blinded by Fear“. Eine kulturelle Erfolgsstory sondergleichen. Da hatte John Lennon schon recht, als er sich am Ende des Rooftop-Gigs im Namen der Band und bei der Band selber bedankte: „I‘d like to say thank you on behalf of the group and ourselves and I hope we passed the audition.“
Das vom penetrantesten Beatle aller Zeiten scherzhaft angesprochene „Vorspielen“ war wohl ein Seitenhieb gegen das Label Decca, bei dem die Liverpooler noch 1962 abgeblitzt waren. Die Pop-Massenwaren dringen seit über einem halben Jahrhundert nicht endenwollend wie süßer Brei aus den Studios. Ob man die Beatles, The Who, Jefferson Airplane, Hendrix und Co. nun noch hört oder nicht: Was seit ihnen vom Band rollt, geht nicht wenig auf ihre Betriebseinstellungen zurück.