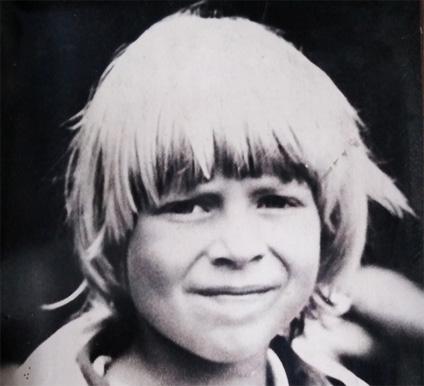In der Nacht von Montag auf Dienstag ging der „März-Wahnsinn“ (March Madness) mit dem Finale der Männer zu Ende. Dabei handelt es sich um die US-Hochschulmeisterschaft im Basketball. Jedes Jahr nehmen je 68 Teams daran teil, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Sie spielen drei Wochen lang im K. O.-System um den Titel.
Die Endspiele der Frauen fanden in der Amalie Arena in Tampa (Florida) statt und die der Männer im Alamodome in San Antonio (Texas). Zu den Zehntausenden, die die Finalspiele vor Ort verfolgten – die Amalie Arena verfügt über mehr als 20.000 Plätze, der Alamodome über mehr als 70.000 – kamen Millionen, die das Ereignis live im Fernsehen oder über Streaming-Dienste verfolgten.
In Sachen Medienaufmerksamkeit, Zuschauerzahlen und Werbeeinnahmen ist die March Madness nur noch mit dem Super Bowl im US-Football vergleichbar. Dass College-Sport in den USA derart beliebt ist, hat seine Gründe: Zum einen bleiben diejenigen, die studiert haben, ihrem College verbunden. Die Frage, wo man studiert hat, begleitet US-Amerikaner oft ein Leben lang – und damit auch die Begeisterung für Sportteams des eigenen College. Dazu kommt, dass Sportlerinnen und Sportler, die bereits landesweit bekannt sind, sich auf dem gleichen Campus bewegen.
Sie sind die Stars der Zukunft – sofern sie sich nicht ernsthaft verletzen. College-Sportlerinnen und vor allem ihren männlichen Kollegen winkt eine lukrative Karriere im Profisport. Die besten Basketballerinnen und Basketballer werden bereits lange vor ihrem Abschluss als künftige Stars von WNBA und NBA gehandelt.
Auch Sportfans, die nicht studiert haben, schauen College-Sport, denn die Spiele sind oft wesentlich spannender als zum Beispiel Spiele in der NBA und die Ergebnisse weniger vorhersehbar. Das trägt wesentlich dazu bei, dass March Madness vor allem eines ist: eines der größten Wett-Ereignisse der USA. Im Vorfeld wurde geschätzt, dass während des Turniers 3,1 Milliarden US-Dollar auf die Basketballspiele verwettet werden. Illegale und private Wetten sind in dieser Summe noch nicht einmal berücksichtigt.
Online-Sportwetten sind in den USA erst seit 2018 erlaubt. Heute können in den meisten Bundesstaaten Wetten online und per Smartphone platziert werden. Mit dramatischen Folgen: 2017 lag die Gesamtsumme der Sportwetten in den USA noch bei 4,9 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2023 waren es bereits 121,1 Milliarden, um 2024 noch einmal um 28,5 Milliarden auf 149,6 Milliarden US-Dollar anzusteigen. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht. Immer weitere Bereiche geraten in den Sog der Glücksspielindustrie. Der College-Sport und Ereignisse wie die March Madness scheinen dabei besonders geeignet, neue Opfer für Sportwetten zu begeistern.
Es kann sich nicht nur auf den Ausgang einzelner Spiele oder den Turnierverlauf gewettet werden, sondern auch auf Punktedifferenzen, die Performance einzelner Spielerinnen und Spieler oder sogar live im laufenden Spiel. Das führt dazu, dass die Opfer der Glücksspielindustrie während eines Spiels mehrere Wetten abschließen, auf den Spielverlauf reagieren und je nach Spielverlauf immer weiteres Geld nachschießen können. Den Überblick darüber zu verlieren, wieviel man gerade verzockt, ist einer der erwünschten Effekte der Live-Wetten.
Am lukrativsten für die Glücks-spielindustrie sind diejenigen, die völlig die Kontrolle verlieren. Nach Schätzungen sind in den USA bis zu 23 Millionen Menschen spielsüchtig, Tendenz steigend. Vor allem bei jungen Menschen ist das Risiko einer Spielsucht hoch. Da die Glücksspielindustrie ihre Opfer über Smartphone-Apps direkt erreichen kann, ist es für sie besonders schwer, sich zu entziehen.
Erkenntnisse darüber, wie Menschen trotz massiver gesundheitlicher und finanzieller Probleme bei der Stange gehalten werden können, ist bei den Entwicklern neuer Glücksspiel-„Produkte“ reichlich vorhanden. Kein Wunder also, dass in der Branche Goldgräberstimmung herrscht.



![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)