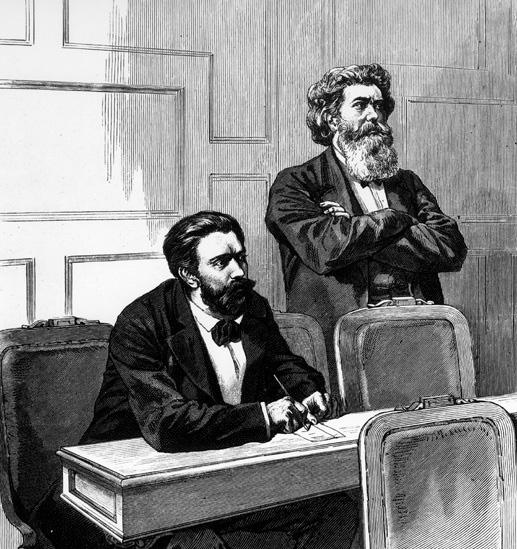Zum Verständnis der 68er gehört die nicht unwichtige Tatsache, dass dieses parlamentarische System seit der Großen Koalition 1966 (CDU/CSU und SPD) keine relevante Opposition im Parlament erlebte. Der Sozialdemokrat Theo Pirker (er war mehr Sozialist als Sozialdemokrat) stellte schon 1965 in seinem kritischen Buch zur SPD-Geschichte „Die SPD nach Hitler“ (München 1965) fest: „In der ersten Hälfte des Jahres 1962 wurde die Gefahr offen sichtbar, die politische Beobachter befürchtet hatten, als die SPD ihre große Reform von Godesberg durchführte, die Gefahr nämlich, dass die zweitstärkste Partei im Bundestag ihre oppositionelle Funktion nicht mehr würde ausüben wollen oder ausüben können.“ Er schlussfolgerte: „Die Aufgaben der Opposition mussten in der autoritären Demokratie mit einer institutionalisierten und damit minimalisierten Opposition beinahe automatisch auf Personengruppen und Organe außerhalb der Parteien fallen.“ Also „auf der Straße“ übernommen werden. Und dies fand 1967/68 in der APO, der Außerparlamentarischen Opposition, seinen Höhepunkt. Mit den ersten Bemühungen um eine Regierungsbeteiligung der SPD wurden alle sozialen, Demokratie- und Friedens- sowie weitere Forderungen, die auch von der SPD streckenweise in ihrer Oppositionsposition mitgetragen worden waren, aufgegeben. Der Hunger nach Regierungsverantwortung war stärker. Auf dem Nürnberger Parteitag (17. bis 21. März 1968) wurde diese Orientierung offiziell festgeklopft.
„Alle Erwartungen der Sozialdemokraten, dass die Parteiführung auf dem Parteitag in Nürnberg einen demokratischen Weg als Alternative zum reaktionären Kurs in der Bundesrepublik zeigen würde, wurden tief enttäuscht.“ Dies stellte die KPD als Resümee des SPD-Parteitages in Nürnberg fest. 15 Monate Große Koalition, Konzertierte Aktion, eingeschränkte Mitbestimmung, Vietnamkrieg, Notstandsgesetze, Fortführung der Politik des Godesberger Programms und Parteiausschlüsse wegen Beteiligung an demokratischen Aktionen waren Themen, die nicht nur die Sozialdemokraten beschäftigten. „Schon seit Jahren waren die rechten Führer der SPD nicht mehr einem derartigen Druck außerparlamentarischer Kräfte und auch aus der SPD selbst ausgesetzt. Dieser Druck bestätigt in vollem Umfang die Einschätzung im Programmentwurf der KPD über die wachsende Unruhe, Unzufriedenheit und die Verschärfung der Klassenwidersprüche und des Klassenkampfes in der Bundesrepublik sowie über die Notwendigkeit der Durchsetzung einer neuen Politik und tiefgreifender demokratischer Umgestaltung.“
Die damalige Stimmung in Teilen der Gewerkschaften schilderte ein Flugblatt der IG-Metall-Jugend Nürnbergs: „Um einiges durchführen zu können, muss man die heiligen Kühe unserer Gesellschaftsordnung schlachten, den Rüstungsetat zusammenstreichen, dem hemmungslosen Gewinn- und Machtstreben der Monopole ein Ende setzen und eine stärkere Besteuerung der Reichen durchführen.“
Die SPD – modern, solide, führend
Dies war als Konferenzlosung zu lesen, betraf jedoch nur die eigene Wahrnehmung. Das war keine Antwort auf die Frage vieler Sozialdemokraten: „Wo steht die SPD?“ Auch nach Nürnberg war das für manche SPD-Genossen bzw. Genossinnen noch eine offene Frage. Für die SPD-Führung war die Regierungsmacht bzw. Beteiligung an ihr eine Existenzfrage. In den Hauptthemen konnte die SPD-Führung mit „relativ elastischen“ Beschlüssen nach dem Parteitag in die weiteren Verhandlungen mit der CDU gehen. Es fielen Sätze über die Notstandsgesetze wie „Die Zeit der Schuldemokratie ist endgültig vorbei“ oder die deutliche Warnung vor „radikalen Lösungen im Sozialen“, so Minister Leber. Der plädierte für eine „evolutionäre Lösung“ der Eigentumsfrage, damit die „revolutionäre Antwort“ nicht mehr an Boden gewinnen könne. Als wichtiges Gegenmittel wurde vom Minister das „öffentliche Anlagenpapier“ empfohlen, das man praktisch „im Discountladen kaufen kann“. Nachdem Brandt das Ja zur Großen Koalition mit der Vertrauensfrage verband, wurde der Eintritt in die Große Koalition mit 173 zu 129 Delegiertenstimmen nachträglich gebilligt.
Ein für diese Zeit wirklich großer Schritt auf diesem Parteitag war dagegen die Erklärung Willy Brandts zur Außenpolitik und zu den Nachkriegsgrenzen, der „Oder-Neiße-Linie“ (Polens Westgrenze). Mit dieser Aussage beschäftigten sich vorwiegend die internationalen Medien. Er hat „endlich gesagt, was die Deutschen in der Bundesrepublik lange wussten“. Die „Financial Times“ (London) schrieb, „Brandts Formulierung war ein Versuch, die ‚Jungtürken’ in der Partei zufriedenzustellen, die sowohl eine Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze als auch Ostdeutschlands verlangen … In beiden Fragen nimmt Brandt den Standpunkt ein, dass die wahren Tatsachen in Osteuropa nicht ignoriert werden können. Indem er den Austausch von Gewaltverzichtserklärungen mit Osteuropa anbietet, gibt er tatsächlich zu, dass er nichts ändern kann und es nicht versuchen will.“
Die Parlamentarier erobern die Macht in der SPD
Die bewusst unkonkret und flexibel formulierten anderen zentralen Forderungen ermöglichten es der Fraktion der Parlamentarier ihre Entscheidungen durchzusetzen. Daraus ergab sich auch die Lösung der Widersprüche zwischen der Regierungsverantwortung und den programmatischen Positionen der Partei. Der Widerspruch wurde zugunsten der Dominanz der parlamentarischen Politik entschieden. Es war der erste Parteitag in der Geschichte der Nachkriegs-SPD, auf dem sich die Parteiführung als Bestandteil der Regierung (Willy Brandt, der Parteivorsitzende, war Außenminister) fühlte und ihre „Mitverantwortung“ und Politik den Mitgliedern begründen musste. Es war auch ein SPD-Parteitag, auf dem die Außerparlamentarische Opposition der ehemaligen traditionellen Oppositionspartei Verrat und Machthunger vorwarf. Tatsächlich handelte es sich um nichts anderes als eine Weiterentwicklung und Praxis sozialdemokratischer Parlamentspolitik nach dem Godesberger Programm. Ein Parteitag, der die Sozialdemokratie an die Tröge der Macht band und die kleine Koalition von SPD und FDP nach der Wahl 1969 und die sozialdemokratische Kanzlerschaft von Willy Brandt vorbereitete.
Die Wut über die „Arbeiterpartei“ als Regierung des Großkapitals
Trotz der Bemühungen der SPD, als Volkspartei anerkannt zu werden und den Makel „Arbeiterpartei“ abzustreifen, war in vielen Köpfen die SPD immer noch eine Arbeiterpartei.
Entsprechend wurden die Themen, mit denen die Delegierten vor dem Parteitagsgebäude konfrontiert wurden, sehr strittig diskutiert: Jugend- und Studentenprotest, Bildungs- und Ausbildungsnotstand, Notstandsgesetze, Einbindung der Gewerkschaften in eine Konzertierte Aktion von Regierung, Unternehmerverbänden und Gewerkschaften, begrenzte Mitbestimmung in den Betrieben, Militarisierung und Atombewaffnung, Kalter Krieg usw.
Die Parteiführung setzte den Forderungen der Delegierten, Grundsätze nicht wegen der Regierungsbeteiligung fallen zu lassen, den Appell nach Verantwortung, Machbarkeit und Regierungsfähigkeit für die Zukunft entgegen. Der Parteivorsitzende und Außenminister Brandt versprach in seiner Rede: „Wir haben die Chance, aus diesem Staat das zu machen, was wir uns vorstellen, was unserem Programm entspricht. Wir haben die Chance, in diesem Prozess die führende Rolle der deutschen Sozialdemokratie zu vertreten und auszubauen.“
SPD kontra Außerparlamentarische Opposition
Der SPD-Parteitag und die Delegierten waren Adressaten von Appellen demokratischer Bündnisse und Gruppierungen. In diesen wurde die SPD aufgefordert, ihre demokratische und soziale Tradition nicht zu vergessen und ihre Beschlüsse und Politik auf Demokratie, Frieden und soziale Sicherheit zu orientieren.
350 prominente deutsche Schriftsteller, Professoren, Juristen und Gewerkschaftsfunktionäre hatten einen Brief an die Delegierten des Parteitages unterzeichnet, in dem sie die Delegierten aufforderten den US-amerikanischen Vietnamkrieg zu verurteilen, den Notstandsgesetzen nicht zuzustimmen und die Deutsche Demokratische Republik, die DDR, als zweiten deutschen Staat anzuerkennen. Zu den Unterzeichnern gehörten die Schriftsteller Arnau, Walser und Zwerenz, die Professoren Bloch, Dix, Flechtheim, Gollwitzer und Abendroth, die Theologen Niemöller und Dr. Kloppenburg. Die Zentrale Forderung hieß: Bonn dürfe den Amerikanern in der Vietnamfrage keine materielle, finanzielle und moralische Unterstützung gewähren. Die Bundesrepublik solle sich für ein Sicherheitssystem in Europa einsetzen, das an Stelle von NATO und Warschauer Pakt treten soll.
Der zweite große Appell an die Delegierten des Bundesparteitages der SPD trug zahlreiche Unterschriften aus der Arbeiterschaft und von Intellektuellen – der Appell des zentralen Arbeitsausschusses des Kuratoriums „Notstand der Demokratie“. In diesem Appell hieß es: Die Notstandsgesetze „bedeuten keine Sicherheit für die Bevölkerung, sondern ihre Unterwerfung unter ein überholtes militärisches Konzept“. Diese Gesetze brächten die Militarisierung des Arbeitslebens, die Ausschaltung der parlamentarischen Demokratie und der demokratischen Rechte.
Die massive Konfrontation der SPD-Führung mit der außerparlamentarischen und innerparteilichen Opposition wurde bei der Kundgebung des Kuratoriums „Notstand der Demokratie“ vor Beginn des SPD-Parteitages deutlich. Diesem Kuratorium gehörten drei Landtagsabgeordnete und sieben Stadträte der SPD, der DGB-Vorsitzende und fünf Führungskräfte aus Gewerkschaften an. Sie alle bezogen gegen die aktuelle Politik der SPD entschieden eine ablehnende Stellung. Die Kundgebungsteilnehmer belagerten das Parteitagsgebäude und forderten die Diskussion mit den Delegierten. Diese „basisdemokratische“ Forderung war aber nicht mit dem Selbstverständnis einer Regierungspartei zu vereinbaren. Die „Wut im Bauch“ steigerte sich wegen der Verweigerung der Debatte so weit, dass die Werbetransparente zum SPD-Parteitag umgestürzt wurden und zu brennen anfingen. Diese Aktion – nach der großen Protestkundgebung – wurde nicht von allen geteilt.
Die Tatsache, dass in Westberlin zwei linke führende Funktionäre (doch, es gab noch Sozialdemokraten in der SPD) wegen Beteiligung an einer Vietnam-Solidaritätsdemonstration aus der Westberliner SPD ausgeschlossen wurde, war für manche eine peinliche Sache. Harry Ristock hatte auf einer Demonstration ein Umhängeplakat mit der Aufschrift „Ich protestiere gegen den Krieg der Amerikaner in Vietnam. Ich bin SPD-Mitglied!“ getragen und wurde deshalb ausgeschlossen. Dies wurde wenige Tage später in Nürnberg per Beschluss korrigiert.
Während des Parteitages wurde in einer Zeitungsmeldung über eine weitere Kritik aus der Bewegung berichtet: „Kritik von links außen. Heftige Kritik am Verlauf des SPD-Parteitages übte gestern Abend in einer Pressekonferenz in Nürnberg das ‚Sozialistische Zentrum’, ein Zusammenschluss linksgerichteter Organisationen, dem auch Einzelpersonen, Mitglieder der DFU und des SDS, des Initiativausschusses für die Wiederzulassung der KPD […] angehören. Das ‚Sozialistische Zentrum’ beanstandete insbesondere, dass auf dem Parteitag nur „verbale Zugeständnisse“ gemacht, nicht aber Alternativen zur CDU/CSU-Politik aufgezeigt worden seien. Insbesondere zu den Themen Vietnam, Abrüstung, Sperrvertrag und Notstand waren den Sprechern des Sozialistischen Zentrums mit Lorenz Knorr an der Spitze nicht entschieden genug. […] Es ist der Auffassung, dass bei einer Fortsetzung des SPD-Kurses die Zeit für eine Spaltung dieser Partei reif werde […].“
Auf dem Nürnberger Parteitag musste die SPD auch um ihre eigene Jugend kämpfen. Sie verweigerte auf einer Seite den Dialog mit den „Radikalen“, andererseits versuchte sie, die „Kritischen“ wieder mehr in die Parteistruktur einzubinden. Dieser Parteitag wurde allgemein als „linker Parteitag/ Sieg der Partei-Linken“ gefeiert. Nach diesem Parteitag sahen die Linken in der Sozialdemokratie dies aber anders.
Der Hinweis, dass nach diesem SPD-Parteitag neue marxistische Organisationen, die SDAJ und die DKP, gegründet bzw. konstituiert wurden, stellt keine überflüssige Schlussbemerkung dar. Der Parteitag in Nürnberg und die spontanen Proteste dagegen waren ein Hinweis auf die Notwendigkeit einer organisierten marxistischen Arbeiterjugend- und Arbeiterbewegung. Dass die SPD, als Regierungspartei, gerade in dieser Zeit die Gründung eines marxistischen Jugendverbandes, der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend SDAJ im Mai 68, und die Neukonstituierung der Deutschen Kommunistischen Partei DKP, September 68, nicht mit Begeisterung aufnahm, sondern mit einer Reihe von Broschüren mit Warnungen vor den Kommunisten reagierte, ist nicht nur dem Antikommunismus zuzuschreiben. Sie kämpfte gegen jegliche Opposition von Links, die sie nicht integrieren konnte.