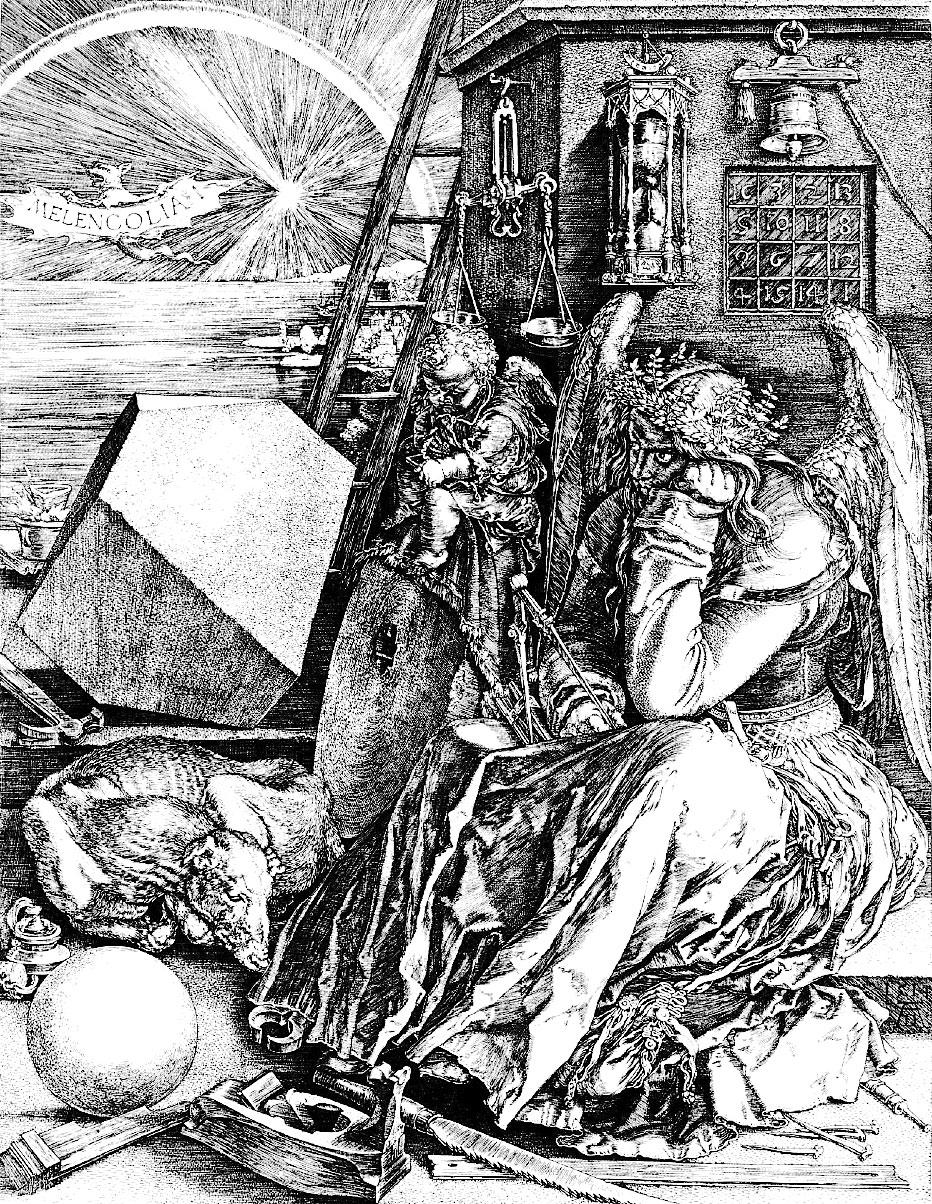Am 28. September 1864 hatten die Führungen der Londoner Gewerkschaften in der St. Martin’s Hall der Stadt eine große internationale Versammlung organisiert, auf der die Gründung der „Internationalen Arbeiterassoziation“, später bekannt als „Erste Internationale“, beschlossen wurde. Die zentrale Erklärung dieser Zusammenkunft – im damaligen Sprachgebrauch die „Inauguraladresse“ – entstand unter Federführung von Karl Marx, der an dieser Zusammenkunft teilnahm. Sie wurde erstmals Ende Dezember 1864 im „Social-Demokrat“ veröffentlicht.
Die Zehnstundenbill
Diese Geburtsurkunde der Ersten Internationale befasst sich mit dem „Elend der arbeitenden Massen (…) während der Periode 1848 bis 1864“, wendet sich aber nach dessen Geißelung der „Lichtseite“ dieser Periode zu. Zwei „große Ereignisse“ werden erwähnt und gleich das erste betraf die Frage der Arbeitszeit: „Nach einem dreißigjährigen Kampf, der mit bewundrungswürdiger Ausdauer geführt ward, gelang es der englischen Arbeiterklasse durch Benutzung eines augenblicklichen Zwiespalts zwischen Landlords und Geldlords, die Zehnstundenbill durchzusetzen. Die großen physischen, moralischen und geistigen Vorteile, die den Fabrikarbeitern aus dieser Maßregel erwuchsen und die man in den Berichten der Fabrikinspektoren halbjährig verzeichnet findet, sind jetzt von allen Seiten anerkannt. Die meisten kontinentalen Regierungen nehmen das englische Fabrikgesetz in mehr oder minder veränderter Form an, und in England selbst wird seine Wirkungssphäre jährlich vom Parlament ausgedehnt. Aber von der praktischen Wichtigkeit abgesehen, hatte der Erfolg dieser Arbeitermaßregel eine andre große Bedeutung. Die Mittelklasse hatte durch die notorischsten Organe ihrer Wissenschaft (…) vorhergesagt (…), dass jede gesetzliche Beschränkung der Arbeitszeit die Totenglocke der englischen Industrie läuten müsse, einer Industrie, die vampirmäßig Menschenblut saugen müsse, vor allem Kinderblut. (…) Der Kampf über die gesetzliche Beschränkung der Arbeitszeit wütete umso heftiger, je mehr er, abgesehen von aufgeschreckter Habsucht, in der Tat die große Streitfrage traf, die Streitfrage zwischen der blinden Herrschaft der Gesetze von Nachfrage und Zufuhr, welche die politische Ökonomie der Mittelklasse bildet, und der Kontrolle sozialer Produktion durch soziale Ein- und Vorsicht, welche die politische Ökonomie der Arbeiterklasse bildet. Die Zehnstundenbill war daher nicht bloß eine große praktische Errungenschaft, sie war der Sieg eines Prinzips. Zum ersten Mal erlag die politische Ökonomie der Mittelklasse in hellem Tageslicht vor der politischen Ökonomie der Arbeiterklasse.“
Der Kampf um den 8-Stunden-Tag
Der damals mit einem Sieg endende 30-jährige Kampf des Prinzips der politischen Ökonomie der Arbeiterklasse – die Verkürzung des Arbeitstages – setzte sich in den Jahrzehnten nach diesem Zwischenresümee unvermindert fort und dauert bis heute an. Der Kampf hat Siege, Niederlagen und Scheinsiege hervorgebracht. Nach dem Erreichen des 10-Stunden-Tages kämpfte die Arbeiterbewegung weltweit für den 8-Stunden-Tag, später für die Fünftagewoche und damit für die 40-Stunden-Woche. Diese Wegmarken wurden allesamt erreicht durch eine Kombination aus gewerkschaftlichem und politischem Kampf. Als im Jahr 1890 der 1. Mai als Internationaler Kampftag der Arbeiterklasse ins Leben gerufen wurde, stand der 8-Stunden-Tag von Anfang an in seinem Mittelpunkt. Durchgesetzt wurde er nicht durch rein gewerkschaftliche Kämpfe. Der Durchbruch kam – mehr als 50 Jahre nach dem 10-Stunden-Tag – erst im Zusammenhang mit dem revolutionären Schub, der sich im Gefolge des Ersten Weltkriegs und vor allem des Sieges der russischen Oktoberrevolution 1917 in Europa und den USA entfaltete und 1918 zur vorübergehenden, später durch die Reaktion immer wieder bekämpften gesetzlichen Einführung des 8-Stunden-Tages in Deutschland führte.
Ein versteckter Bürgerkrieg
In einem bis heute lesenswerten Überblick über den „Streit um die Arbeitszeit“ wies 2012 der damalige IG-Metall-Vertrauensmann bei VW Osnabrück Achim Bigus mit Verweis auf Marx‘ Referat „Lohn, Preis, und Profit“ gleich in der Überschrift seines Artikels in den „Marxistischen Blättern“ auf die „Notwendigkeit allgemeiner politischer Aktion“ hin, ohne die es keinen einzigen Schritt der Arbeitszeitverkürzung in den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten gegeben hätte. Dieses grundlegende Muster wurde schon durch die Kämpfe um den 10-Stunden-Tag deutlich.
Für den Gang in die St. Martin’s Hall hatte Marx 1864 seine intensiven Arbeiten am ersten Band des „Kapitals“ unterbrochen, an dem er zu dieser Zeit feilte. In seinem Hauptwerk widmet er dem „Arbeitstag“ ein ganzes, 70 Druckseiten umfassendes Kapitel. In diesem Kapitel wiederum befasst er sich in zwei großen Abschnitten mit dem „Kampf um den Normalarbeitstag“. Diesen hin und her wogenden Kampf resümiert er mit den Worten: „Die Geschichte der Reglung des Arbeitstags in einigen Produktionsweisen, in andren der noch fortdauernde Kampf um diese Reglung, beweisen handgreiflich, dass der vereinzelte Arbeiter, der Arbeiter als ‚freier‘ Verkäufer seiner Arbeitskraft, auf gewisser Reifestufe der kapitalistischen Produktion, widerstandslos unterliegt. Die Schöpfung eines Normalarbeitstags ist daher das Produkt eines langwierigen, mehr oder weniger versteckten Bürgerkriegs zwischen der Kapitalistenklasse und der Arbeiterklasse.“
Auf dem Weg steckengeblieben
Die letzten Siege in diesem jahrhundertelangen Bürgerkrieg liegen nun schon einige Jahrzehnte zurück. Sie sind allesamt mit politischen Kämpfen und Rahmenbedingungen verknüpft. So wie der 8-Stunden-Tag nur erklärt werden kann mit dem revolutionären Schub 1917/18, so ist die Durchsetzung der 40-Stunden-Woche in Deutschland nur verständlich durch die damals herrschende Systemkonkurrenz zwischen einem kapitalistischen und einem sozialistischen Deutschland, die die herrschende Klasse in Westdeutschland zu Zugeständnissen an die hiesigen Gewerkschaften zwang. Es ist daher kein Zufall, sondern hat eine traurige historische Logik, dass das nächste Etappenziel, das sich auch die deutsche Gewerkschaftsbewegung als Ergebnis der Beschlüsse unzähliger Gewerkschaftskongresse seit den 1970er Jahren auf die Fahne geschrieben hatte – die 35-Stunden-Woche –, bis heute nicht erreicht ist. Die deutschen Gewerkschaften sind, wie es Bigus mit Verweis auf den Arbeitszeitforscher Steffen Lehndorff 2012 schrieb, „auf dem Weg zur 35-Stunden-Woche“ steckengeblieben. Dieses Steckenbleiben hat zu tun mit dem Sieg der Konterrevolution 1989/90 in den um die Sowjetunion herum gruppierten sozialistischen Staaten, unter ihnen die DDR.
Der GDL-Streik – ein Erfolg?
Der jüngste Kampf um dieses Etappenziel auf dem ökonomisch schon heute möglichen Weg zur 30-Stunden-Woche war der Streik der „Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer“ (GDL) um die Einführung der 35-Stunden-Woche wenigstens für Schichtarbeiter. Für sie gilt dasselbe, was Marx – wie schon oben zitiert – im Gründungsdokument der „Internationale“ anmerkte: „Die großen (…) Vorteile, die (…) aus dieser Maßregel erwuchsen (…), sind (…) von allen Seiten anerkannt.“ Schichtarbeit ohne allgemeine Arbeitszeitverkürzung ist organisierter Raubbau an der menschlichen Gesundheit.
Der Abschluss zeigt überdeutlich die Notwendigkeit einer Stärkung der politischen Kräfte der Arbeitenden – bis dahin, dass in ihm sogar die Gefahr eines weiteren Rückschlags im Kampf um einen kürzeren Normalarbeitstag angelegt ist, wie sie aus früheren Etappen des Kampfes um eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung nur allzu bekannt ist.
Auf ihrer Website nennt die GDL das Ergebnis einen „wegweisenden Tarifabschluss“, lobt ein „präzises Ineinandergreifen“ und preist die „Selbstbestimmung in den Tarifverträgen“. Die 35-Stunden-Woche, die so dröhnend in allen Medien im scheinbaren Mittelpunkt dieses Konflikts stand, ist aus der Überschrift verschwunden. Sie taucht in den Darlegungen der Ergebnisse des Kampfes nun mit der Formulierung auf: „Basis ist die Referenz für Schichtarbeiter = 35-Stunden-Woche“. Erläuternd wird ausgeführt: „Dazu gibt es verschiedene Wahlmodelle, die die Selbstbestimmung fördern und den aktuellen Lebensumständen im Schichtdienst Rechnung tragen sollen. Individualität und Attraktivität der Berufe sollen gesteigert werden.“
Fast schon in Feierlaune ist der Tarifgegner, der bundeseigene Konzern Deutsche Bahn. Er verkündet auf seiner Website zum Abschluss: „Kernelement ist ein innovatives Optionsmodell, mit dem Mitarbeitende im Schichtdienst künftig selbst über ihre Wochenarbeitszeit entscheiden. Der Korridor geht am Ende von 35 bis 40 Stunden. Dabei gilt das Leistungsprinzip: Wer mehr arbeitet, verdient entsprechend mehr.“
Es liegt auf der Hand: Das ist keine 35-Stunden-Woche, keine allgemeine Arbeitszeitverkürzung, keine neu erkämpfte Obergrenze für den Normal-arbeitstag. Rainer Perschewski, selbst Bahner und aktiver Gewerkschafter, stellt denn auch nüchtern fest: „Allerdings müssen sich die Beschäftigten jeweils melden, wenn sie diese Arbeitsverkürzung auch wollen. Tun sie es nicht, erhalten sie statt der einen Stunde den Gegenwert von jeweils 2,7 Prozent des Gehaltes. Neue Beschäftigte müssen sich somit auch hier künftig entscheiden, wie viele Stunden in der Woche sie künftig arbeiten.“
Die erwähnten 2,7 Prozent für jede Stunde sind ein linearer Wert. Sie werden automatisch gezahlt – ohne Zuschläge. Das ist ein fundamentaler Unterschied zu allen früheren Abschlüssen, in denen es um die Arbeitszeit ging. Denn als beispielsweise im Gefolge der Kämpfe der IG Metall und der IG Druck und Papier selbst im Versicherungsgewerbe die 38 Stunden verankert wurden, war hier wie überall klar: Musste die Personalabteilung vorher für einen Kollegen, dessen Arbeitskraft dringend gebraucht wurde, bei einer Arbeitszeit von über 40 Stunden einen Überstundenantrag stellen, den der Betriebsrat genehmigen konnte oder nicht oder als Verhandlungsmasse für andere Ziele einsetzen konnte, mussten solche Anträge nun schon nach 38 Stunden Wochenarbeitszeit eingereicht werden. Das schwächte die Position der Betriebsräte nicht, sondern stärkte sie. Das individualisierte „Optionsmodell“ stärkt sie nicht, sondern schwächt sie.
Es kann sich darüber hinaus noch als verhängnisvoller Anknüpfungspunkt für künftige Kämpfe um die Arbeitszeit erweisen. Denn bei so viel gewerkschaftlicher Lobpreisung von „Selbstbestimmung“, von „Individualität und Attraktivität“ – welches Argument bliebe dann, wenn vorgeschlagen wird, doch bitte schön künftig den „Optionskorridor“ von 35 bis 40 auf 32 bis 42 Stunden zu erweitern? Eine solche Weichenstellung liegt in der Logik dieses Abschlusses und auf der Hand. Sie würde im weiteren Streckenverlauf dazu führen, dass diejenigen, die es sich leisten können, die keine Familie oder ein schuldenfreies Häuschen haben, sich für 35 Stunden in die Schichtfron begeben, aber diejenigen, die auf jeden Cent achten müssen, sich in die 40-Stunden-Schicht oder eine in der Perspektive noch längere Schicht zwingen lassen – alles im Namen der „Selbstbestimmung“.
Nein, dieser Abschluss ist ein Scheinsieg. Er ist kein Meilenstein auf dem Weg zu dem Ziel, an dem die internationale Gewerkschaftsbewegung zu Recht und im eigenen Interesse seit der Gründung der Ersten Internationale unbeirrt festhält: die kontinuierliche Verkürzung des Normalarbeitstages. Das Erreichen dieses Zieles ist, das zeigen erfolgreiche Kämpfe aus dem vorigen Jahrhundert wie das Steckenbleiben dieser Bewegung in unserer Zeit, davon abhängig, dass die der „Ökonomie der Arbeiterklasse“ verpflichteten Kräfte auch politisch wieder stärker werden.
Unser Autor ist Vorsitzender der Marx-Engels-Stiftung und veröffentlicht auf deren Internetseite monatlich die Rubrik „Marx Engels aktuell“.



![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)