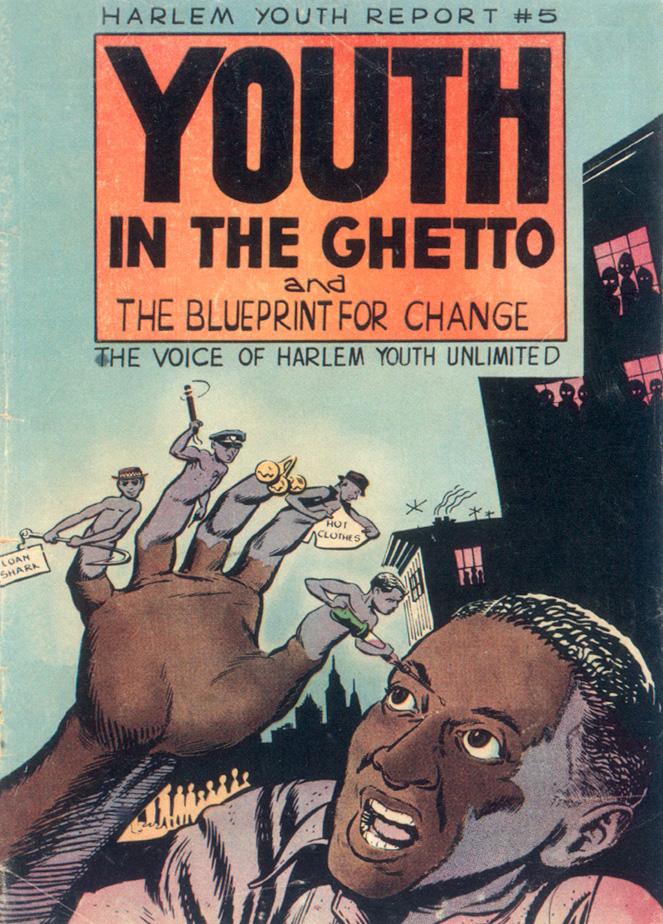Vor einigen Monaten vertrat ich hier die spinnerte These, Union habe auswärts bei den Bayern absichtlich 0:4 verloren, weil dieses Resultat danach einen positiven Saisonverlauf gewährleiste. Das war Anfang April und ich hatte noch gut Lachen. Inzwischen reib‘ ich mir eher verwundert die Augen, denn Union ist nun seit dreizehn Ligaspielen ungeschlagen und nach dem 6. Spieltag der neuen Saison sogar Tabellenführer. Jawohl: Ta-bel-len-füh-rer!
Die Freude über diesen Triumph ist natürlich riesig. Der Lauf, den Union aktuell hat, setzt Glücksgefühle frei, die einen emotional fast überfordern, und man vergegenwärtigt gerade noch, dass es sich um einen Moment für die Ewigkeit handelt: Platz 1 in der Bundesliga – das wird zukünftig in keiner Statistik mehr fehlen und ich werde es eines Tages noch meinen Enkelkindern erzählen (falls ich wirklich mal Opa werden sollte). Andererseits denkt man sich Woche um Woche: Das kann doch jetzt nicht einfach so weitergehen, das muss doch mal wieder aufhören. Und ja, das wird es auch – schon in Kürze oder in ein paar Monaten. Wer weiß das schon?
Allerdings soll die Freude gerade mein geringstes Problem sein (zumal sich in Zeiten des totalen Wirtschaftskrieges und der existenziellen Sorgen das Herz ohnehin nur noch selten erwärmen mag). Problematischer ist vielmehr: Gegen wen oder was kann der Kolumnist eigentlich noch ätzen, wenn er aus der Perspektive eines Klassenprimus schreibt? Kann er gegen „das System“ wettern, das ihn – wenn auch nur für den Augenblick – emporgespült hat? Lächerlich, das geht nicht. Kann er gegen „die da oben“ (die mit dem Geld, die sich im Ruhme sonnen) pöbeln? Das wäre kurz vor peinlich und geht also auch nicht. Tja, da hab‘ ich nun den Salat: Was nutzt die schönste Tabellenführung, wenn einem der Status des sympathischen Underdogs abhanden kommt?!
Dieses Dilemma betrifft gleichermaßen die inneren Angelegenheiten Berlins: Vor zehn, fünfzehn Jahren hatte man sich als Unioner noch mit der Großkotzigkeit der Herthaner herumzuschlagen, die pfauengleich durch die hauptstädtische Landschaft stolzierten und dieses „gallische Dorf“ in Köpenick belächelten, das sich partout nicht in die blau-weiße Glamour-Metropole eingemeinden lassen wollte. Dem war leicht zu begegnen, denn man brauchte den Kollegen nur ruhigen Blutes zu erklären, dass ihr Verein zwar größer, wohlhabender und erfolgreicher sein mochte, aber eben nicht so geil wie Union. Doch inzwischen hat sich das Blatt gewendet und ich bin so langsam um Worte verlegen. Triumphierende Äußerungen verbieten sich von selbst, denn Hochmut kommt vor dem Fall. Ein mitleidiges „Bestimmt geht’s bei euch bald wieder bergauf!“ scheint mir indes ebenso unangebracht, weil solch ein Von-oben-herab-Gehabe stets mit einer Arroganz schwanger geht, die eines Unioners nicht würdig ist. Und außerdem wär’s geheuchelt. Warum sollte ich dem Stadtrivalen einfach so die Daumen drücken?
Kurzum: Selbst so eine Tabellenführung lässt sich von einem Marxisten nur dialektisch betrachten: als ein Ding, das sein Gegenteil in sich trägt. Denn so prickelnd die Gewissheit ist, dass es sich für Union nicht gerächt hat, beharrlich seinen eigenen Weg zu gehen, ja dass – Achtung, jetzt kommt’s! – die Bayern jetzt Union-Jäger sind, so sehr denkt man eben auch, hier sei etwas aus den Fugen geraten. Man fühlt sich so unbehaglich wie ein Arbeiter, der in einer herrschaftlichen Villa zum Diner eingeladen ist, aber weder mit der Etikette klarkommt noch mit den exotisch anmutenden Bestecken umzugehen weiß.
Ich will nicht lügen, von mir aus darf das Märchen ruhig noch ein kleines Weilchen lang weitergehen. Aber klar ist auch: Schon am nächsten Wochenende gibt’s wieder Bratwurst, Bier und Fußball pur an der Alten Försterei, denn selbstredend werde ich die Entwicklung auch zukünftig „vom Stehplatz aus“ betrachten und nicht aus dem Plüschsessel. Eisern Union!


![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)