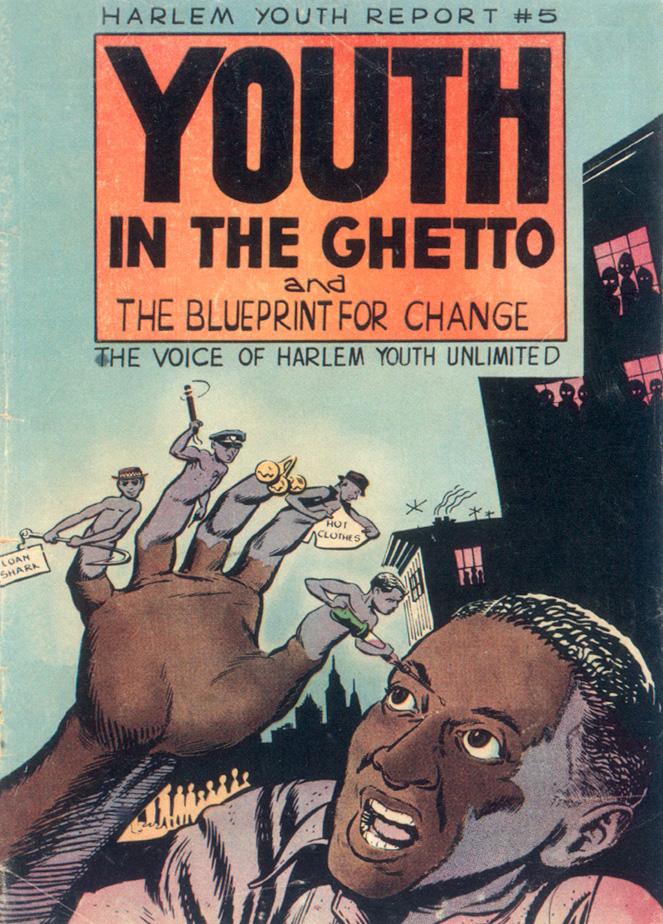Das Gerücht, in der DDR habe es keine trinkbaren Weine gegeben, ist falsch. Einerseits. Andererseits stimmt der vernichtende Satz aus dem DEFA-Spielfilm „Blonder Tango“ (1986), in dem ein chilenischer Emigrant das Leben in der DDR so zusammenfasst: „Ein Land, in dem der Wein gezuckert wird.“ Das war so. In Österreich wurden damals Weine mit Frostschutzmittel milder gemacht und in der Bundesrepublik mit einheimischem Zeug verrührt. In der DDR wurde zwar gesüßt, aber nicht kriminell. In einer Reportage über einen früheren Produktionsleiter des VEB Weinkellerei Neubrandenburg ist zu lesen: „Jeder Bezirk hatte damals einen eigenen Weinbetrieb, der aus ausländischen Grundweinen nach einer bestimmten Richtrezeptur, die als TGL (Abkürzung für: Technische Normen, Gütevorschriften und Lieferbedingungen – A. S.) überall in der DDR gleich war, Wein für seine Region herstellte und in Recyclingglas abfüllte. Die Weine trugen Namen wie Weinbergsstolz, Goldener Nektar, Sole Vino, Castello oder Mendoza.“ Auf Etiketten aus Neubrandenburg stand auch: „Importtraubenwein Goldberyll. Körperreicher Weißwein mit betonter Restsüße.“ Das muss das Zeug gewesen sein, das der traurige Chilene im Film meinte. Noch ekliger: „CherryLady. Weinhaltiges Getränk mit fruchtigem Kirscharoma und dezenter Mandelnote.“ Ein Liter, zwölf Mark. Das Gesöff war Resultat von Falschhören: Die Neubrandenburger sollen den Stampfsong „Cheri, Cheri Lady“ der „Dezibelbestie“ (Wiglaf Droste) Dieter Bohlen als „Cherry, Cherry Lady“ missdeutet haben. Heute wird die Plörre in den Niederlanden angerührt.
Dabei hatte für mich weinmäßig alles gut angefangen. Als ich 1967 in die DDR und nach Leipzig kam, schickte mich das zuständige Amt zunächst zur Arbeit in den VEB Getriebewerke im Vorort Böhlitz-Ehrenberg. Die Brigade junger Dreher, in die ich als Hilfskraft kam, suchte regelmäßig eines der besten Lokale in der Innenstadt auf, das damalige Café am Brühl. Seitdem trinke ich gern weißen Bordeaux. Der stand wie selbstverständlich auf der Karte neben Weinen aus der Bundesrepublik, aus Österreich und Ungarn. Das änderte sich später, als die DDR-Ökonomie nicht mehr so „störfrei“ war wie unter Walter Ulbricht. Es gab viele Weine aus dem westlichen Ausland nur in Restaurants, in denen mit DM oder Dollar bezahlt werden musste. Auch ein Weinsortiment ist eine Frage des Klassenkampfes.
Die Gewächse aus den sozialistischen Ländern, die zwischen fünf und zehn DDR-Mark kosteten (österreichische mehr als das Doppelte), waren zumeist gut bis sehr gut: Grauburgunder vom Balaton, dort „Szürkebarát – Grauer Mönch“ genannt. „Hárslevelu – Lindenblättriger“, eine ungarische Rebsorte. Schwieriger war es mit Rotwein. Die Abhängigkeit der DDR-Bürger von „Rosenthaler Kadarka“ soll bis heute nicht kuriert sein. Es genügt zu sagen: Kadarka muss nicht gezuckert werden, er klebt auch so. Der Standardrotwein meiner Studienkollegen war dagegen bulgarischer „Hügel“. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es sechs Flaschen für drei Mark. Dazugehöriger Spruch: „Mit Reißzwecken nachspülen, damit es richtig kratzt.“ Er war kartonweise bei Ausflügen zum Schwimmen oder Skatspielen dabei. Leider verschwand das angenehm raue Getränk bald aus dem HO-Sortiment. Der vermutlich populärste Rotwein hieß „Egri Bikavér – Erlauer Stierblut“ und kam ebenso wie „Kékfrankos – Blaufränkischer“ aus Ungarn. Böhmische und mährische Weine gab es damals wie heute im Einzelhandel faktisch nicht, nur in einigen Restaurants.
So existierte der Wein leider in einer Nische. Die ostdeutschen Gegenden waren traditionell Bier- und Schnapsland, die Anbauflächen für Wein nach Reblaus und Weltkriegen mickrig. Der Eiswinter 1986/1987 vernichtete an Saale und Unstrut die Hälfte der Reben, neue waren schwer zu beschaffen. Erst vor zwei Jahren erfuhr ich von Winzer Dr. Wolfgang Lindicke in Werder bei Potsdam, dass er 1985 von der „Gärtnerischen Produktionsgenossenschaft“, in der er für Erdbeeren zuständig war, den Auftrag erhielt, Wein anzubauen: „Werderaner Wachtelberg“. 1990 erntete er bereits 22 Tonnen Trauben, dann kam zunächst der Absturz. Gezuckerter Wein? Lindicke verneint: „Die sind im damaligen Staatsweingut des Bezirkes Halle trocken ausgebaut worden.“ Das war in Naumburg. Heute keltert Lindicke selbst. Ein Trost, der für den traurigen Chilenen zu spät kommt.



![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)