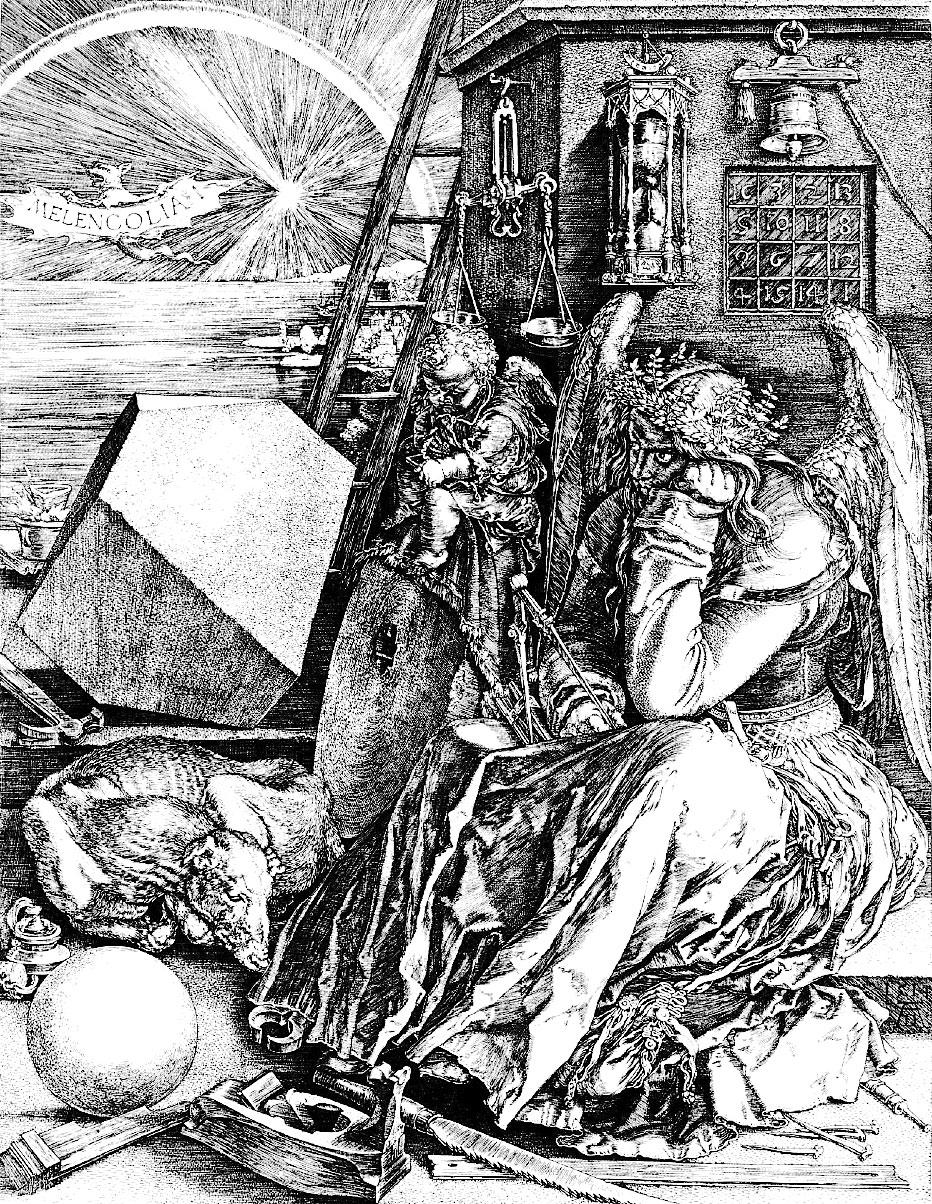Mit 16 Jahren wurde Vera Friedländer im Januar 1945 als sogenannte Halbjüdin zusammen mit polnischen, serbischen und französischen Arbeitern in den Reparaturbetrieb des Schuhkonzerns Salamander in der Berliner Köpenicker Straße 6–7 zwangsverpflichtet. Die körperlich schwere Arbeit unter SS-Aufsicht war nicht nur ungewohnt und anstrengend für das junge Mädchen, das eigentlich noch zur Schule hätte gehen wollen. Sie musste nicht nur unter der dauernden Drohung leben, in ein Lager gesteckt zu werden, wenn sie nicht schnell und gut genug arbeitete. Zusätzlich trug ihr die Schikane einer Aufseherin, die sie zwang,

Nähte der ihr zugeteilten Schuhe mit den bloßen Fingernägeln statt mit dem dafür vorgesehenen Werkzeug zu prüfen, blutende und eiternde Wunden an den Fingerspitzen ein. Der Solidarität polnischer Arbeitskollegen verdankte sie es, dass sie nicht entdeckt und bestraft wurde, als sie zu dieser Art „Gütekontrolle“ nicht mehr in der Lage war. Die Bombardierung der Köpenicker Straße machte ihrem Einsatz in der Werkstatt schließlich ein Ende.
„Die Zwangsarbeit ist meine Beziehung zu Salamander“, stellt Vera Friedländer gleich im ersten Satz ihres vorliegenden Buches klar.
Die Autorin will darin ausdrücklich keine eigene Forschung präsentieren, sondern stützt sich zu großen Teilen auf Sachliteratur, darunter Anne Sudrows „Der Schuh im Nationalsozialismus“ (2010). Trotzdem hat sie selbst u. a. im Landesarchiv Berlin recherchiert und dort wichtige Akten der Berliner Niederlassung aus dem Hauptamt für Kriegssachschäden gefunden, die sie erstmals ausgewertet hat.
Die Geschichte der Firma geht bis in das Jahr 1885 zurück, als der Schuhmachermeister Jakob Sigle in der Kleinstadt Kornwestheim bei Ludwigsburg eine große Werkstatt eröffnete, die sich mit Hilfe des Kapitals jüdischer Geschäftspartner bald zur Fabrik entwickelte. 1913 stellte der Betrieb bereits zwei Millionen Paar Schuhe im Jahr her. 1930 verfügte die Aktiengesellschaft über 32 Millionen Reichsmark Grundkapital, davon gehörten 14 Millionen den Familien Levi und Rothschild.
Doch 1934 hatte sich die Firma in Rekordzeit selbst arisiert, indem die „arischen“ Teilhaber von den jüdischen den größten Teil ihrer Aktien (möglichst günstig) übernahmen. Auch die Firmenleitung und der Aufsichtsrat waren nun „judenrein“. Damit nicht genug.
Vera Friedländer wirft Salamander – ausführlich begründet – folgende Verbrechen im „Dritten Reich“ vor:
H die Teilnahme am Kriegsgeschäft durch die Produktion von Uniformstiefeln und die Herstellung von Holzschuhen für Häftlinge,
H die Ausbeutung von Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern,
H den Test von Lederersatzstoffen an KZ-Häftlingen unter Benutzung der Schuhprüfstrecke in Sachsenhausen, die viele Menschenleben kostete, sowie
H die Verwertung und den Verkauf des Eigentums deportierter und ermordeter Juden, (nämlich der Berge von Damen- und Herrenschuhen, die die Autorin im Berliner Reparaturbetrieb sortieren musste).
Die Geschichte des Betriebs ist nicht erst seit kurzem Gegenstand der Forschung. Der Kornwestheimer Jurist Prof. Dr. Hanspeter Sturm hatte bereits 1958 in Kooperation mit der Schuhfirma sein mehrbändiges Werk „Die Salamander AG“ vorgelegt. Er hat danach u. a. auch eine Geschichte seiner Heimatstadt im „Dritten Reich“ publiziert.
Dabei hat er die Verbrechen verschwiegen, die Realität erheblich beschönigt und verfälscht, wie Vera Friedländer nachweist. „So gut wie alle Firmen, die etwas zu verbergen haben, verhalten sich wie Salamander und ihr Historiker Hanspeter Sturm“, merkt sie dazu an.
Der bis heute in seiner Heimat hoch angesehene Autor, der wenige Jahre nach dem Krieg seine Genugtuung über das Ende der von ihm als übertrieben betrachteten „Entnazifizierung“ zum Ausdruck brachte – eine Haltung, von der er zeitlebens nicht abrückte – war viele Jahre Leiter der Polizeidirektion Stuttgart I und nach der „Wende“ Dozent für Staats- und Verwaltungsrecht in Sachsen. Er wurde mit dem Bundesverdienstorden 1. Klasse und der Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg in Gold ausgezeichnet. Nach seinem Tod 2011 wurde in Kornwestheim ein Stadion nach ihn benannt.
Vera Friedländer (eigentlich Prof. Dr. Veronika Schmidt) hat nach dem Krieg an der Arbeiter-und-Bauern-Fakultät das Abitur nachgeholt und anschließend an der Berliner Humboldt-Universität Germanistik studiert. Sie promovierte und habilitierte sich, arbeitete als Verlagslektorin und als Dozentin, bevor sie auch als Schriftstellerin hervortrat. Sie hat bereits in ihrem in der DDR in den 80er Jahren erschienenen autobiographischen Bericht „Späte Notizen“ ein Kapitel über ihre Zwangsarbeit bei Salamander veröffentlicht, obwohl der Betrieb damals mit der DDR kooperierte, was für beide Seiten ein gutes Geschäft war. Mehr als dreißig Jahre mussten vergehen, bis nun diese scharfe und außerordentlich prägnant geschriebene Abrechnung vorliegt, die von Stéphane Hessels Aufruf „Empört Euch!“ inspiriert sein könnte. Tatsächlich war Vera Friedländer empört, wie ignorant und sogar diffamierend Salamander und deren Pressesprecherin auf ihre in den 90er Jahren vorgetragenen Vorwürfe reagierten. Sie ließ sich jedoch nicht einschüchtern.
In „Späte Notizen“ hat sie erzählt, wie sie nach der Befreiung 1945 die ihr jahrelang aufgezwungene Demutshaltung überwand und zum ersten Mal gegen eine Benachteiligung aufbegehrte, als sie wegen mangelnder Kenntnisse nicht zum Vorstudium zugelassen werden sollte. Sie protestierte – und setzte sich durch: „Mein erster selbsterkämpfter Sieg. Wie wohltuend es war, freiweg zu widersprechen. Wie ein Sommergewitter. So ganz von allein kommt die Gerechtigkeit eben nicht.“
Das könnte als Motto über ihrer vorliegenden Schrift stehen.
Bei der Buchpremiere in der Ladengalerie der „jungen Welt“ in Berlin fragte eine junge Frau, was man daraus für die Gegenwart lernen solle. Es gibt verschiedene mögliche Antworten darauf. Meiner Meinung nach kann man vor allem eins von der fast 90-jährigen, energischen Vera Friedländer lernen: Widerstandsgeist.
Ich war Zwangsarbeiterin bei Salamander
Das Neue Berlin, Berlin 2016
223 S. mit Abb., 14,99 Euro.
Eine Anmerkung sei noch gestattet. Ein Journalist der „taz“ hat im Dezember 1999 einen Bericht über Vera Friedländers Geschichte gebracht. „Als sie einen Antrag auf Anerkennung als Opfer des Faschismus stellen wollte“, so behauptet er darin abschließend, „wurde ihr auf der Behörde gesagt: ‚Wieso, Ihnen ist doch gar nichts passiert.‘ Seit 1990 bekommt sie eine kleine Rente als ‚rassisch Verfolgte’.“
Diese Darstellung ist tendenziös und missverständlich. Richtig ist, dass Vera Friedländer (damals Veronika Rudau) bis 1951 den Ausweis der VVN als Opfer der Nürnberger Gesetzgebung besaß und demzufolge in den schweren Nachkriegsjahren Vergünstigungen in Anspruch nehmen konnte – abgesehen von der bereits erwähnten Ausbildung, die sie selbstverständlich kostenlos erhielt.
Meiner Meinung nach hat die DDR in diesen wie in vielen anderen Fällen eine durchaus beachtliche „Wiedergutmachung“ (ein unsinniges Wort) auch an jüdischen Verfolgten geleistet, obwohl sie sich, anders als die Bundesrepublik, explizit nicht als Rechtsnachfolgerin des „Dritten Reiches“ verstand.


![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)