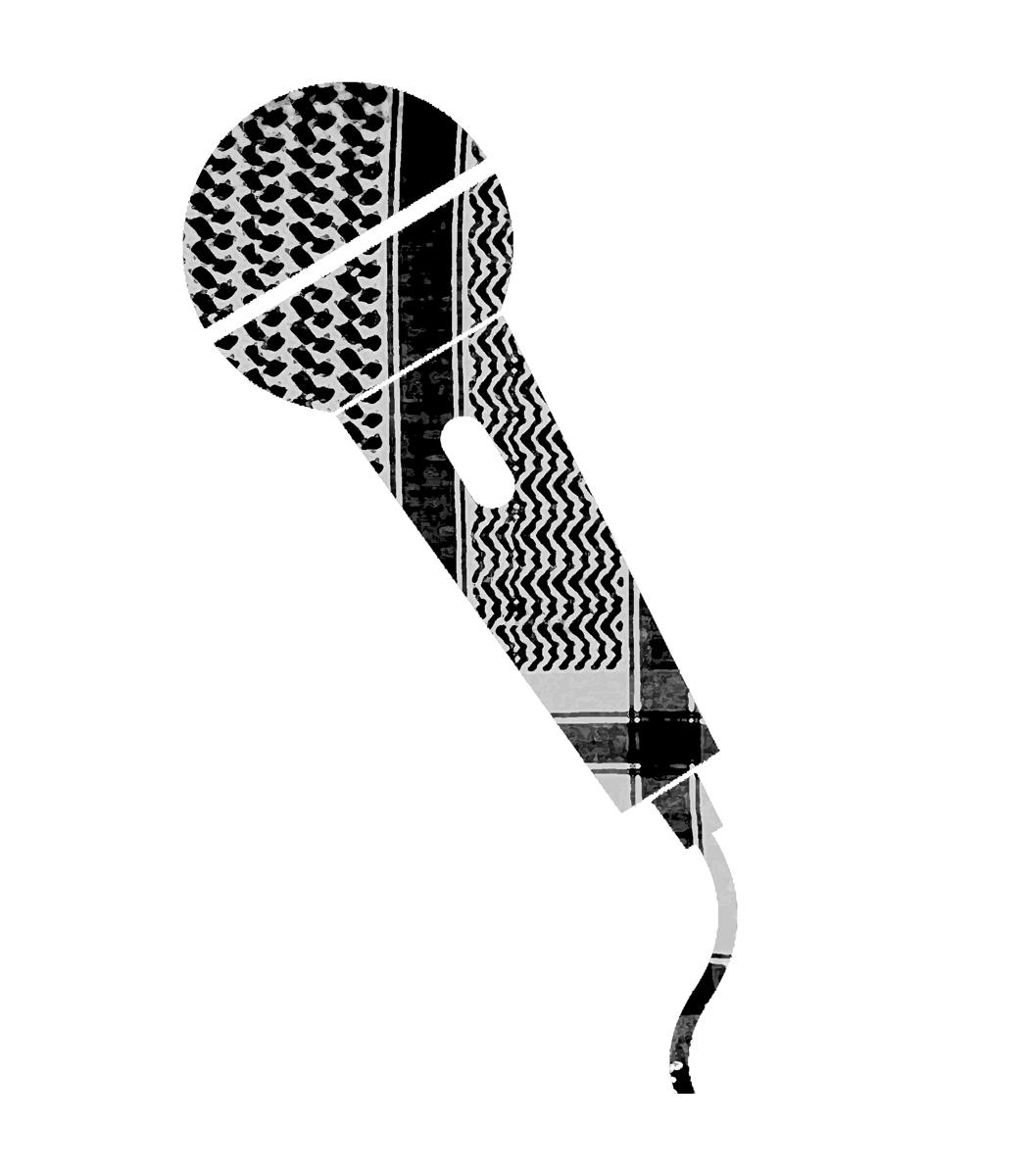Die Sache mit dem Kompass ist eine ältere. In China fällt die Entdeckung in die Zeit der „Streitenden Reiche“, also irgendwo zwischen 475 und 221 vor unserer Zeitrechnung. Während der Kreuzzüge soll er nach Europa gekommen sein. Grundsätzlich untermauert der Kompass, bis heute, die Existenz von Nord- und Südpol und den zu ihnen im rechten Winkel stehenden Himmelsrichtungen Ost und West. Zu behaupten, es gebe nur noch diese oder jene geografische Richtung, ist rein subjektiv und selbst das nur aus Extremperspektiven: Stehe ich an den Polen, na, dann geht es von da aus nur gen Süd oder Nord, je nachdem. Stand man in Westberlin, so der Witz aus Ronald M. Schernikaus „Legende“, na, dann ging es von da aus immer nur in den Osten.
Die Leugnung, dass es noch Osten gäbe, ist mancherorts alltägliche Sprachpraxis: „Mario findet alles, was früher Osten und DDR war, scheiße. Sein Vater sagt das wohl auch“, heißt es in Daniel Schulz’ Debütroman „Wir waren wie Brüder“. „Als noch Osten war“ – Schulz hat sich beim Sprachschatz seiner ostdeutschen Herkunft bedient.
Nicht nur der Duktus verweist sehr wohl darauf, dass der Osten noch da ist – nur eben abgewickelt, abgestempelt und abgehangen. „Wir waren wie Brüder“ spielt im fiktiven Kaff Markheide in Brandenburg zwischen 1989 und 2000. Die Naivität des Coming-of-Age gerät bei Schulz an manchen Stellen zu knuffigem Humor: „Mariam redet weiter, und wenn ich das richtig kapiere, ist Ecstasy eine Droge, die die Leute bei der Loveparade nehmen. Dann tanzen sie besser. Das hätten wir Jungs in der Ferienlagerdisco gebrauchen können.“
Im Kontrast dazu das Großwerden in den sogenannten Baseballschlägerjahren der 1990er, in denen die Neuen Bundesländer von neuem faschistischen Straßenterror überzogen wurden. Migrantinnen und Migranten, Nichtheterosexuelle, Wohnungslose und Linke – und jene, die von Nazischlägern als diese ausgemacht wurden – lebten als permanente Zielscheiben. „Wir fahren mit dem Zug, also trage ich meine Zugfahrklamotten“, sagt Schulz’ Ich-Erzähler, „schwarze Cargohose, schwarze Stiefel, schwarzes T-Shirt. Kein Strick, keine Wolle, kein Filz, kein labbriger Stoff, kein Batik, kein Lila, kein Gelb, kein Rot.“ Die, die es können, passen sich den Nichtfarben um sie her an. Der Erzähler laviert zwischen linken und rechten Freundeskreisen, die sich wiederum vermengen. Nie gutes Gewissen, weil er das Maul zu selten für Widerworte gegen rassistische Sprüche aufmacht, bevor er dann so oder so eins drauf bekommt.
Zwischen allen herrscht Spannung, nicht nur in den Wahlverwandtschaften. Über die Mutter des Erzählers auf einer Familienfeier Anno ’89 sagt er: „Sie hasst das. Bei uns zu Hause hat sie schon mal geweint, weil sie noch kocht und macht, wenn die Männer schon trinken. Aber sie bleibt.“ Sie bleibt. Stakkato zeichnet trübe Zustände nach und ist dabei zärtlicher als der Gegenstand selbst. Man fragt sich, wer hier eigentlich noch Bruder sein mochte und konnte. Was der Erzähler noch zu Anfang aushält – religiöser Haushalt, Vater NVA-Offizier, ja selbst das der streitenden Reiche Ost vs. West beginnt sich auf irrsten, kindlich-kriegsgeilen Wegen zu einer Haltung zu formen –, gerät als Teenager zum unerträglichen Wiederkäuen von Widersprüchen.
Die autofiktionale Robinsonade „Wir waren wie Brüder“ ist eine Sekundärliteratur. 2018 veröffentlichte der Leiter im Reportageressort der „Taz“ in ebenjener Zeitung den gleichnamigen Essay. Den Roman hat der 1979 in Potsdam geborene Journalist nun nachgeschoben.
Im Essay heißt es zu Anfang: „Die eigene Hässlichkeit kann ein Rausch sein. Wenn man sie umarmt und das Grauen in den Gesichtern derer sieht, die einen beobachten und verachten, aber sich nicht an einen herantrauen, dann strömt Macht durch die Adern wie elektrischer Strom.“ Das Deformierte wird ausgestellt, es auratisiert sich schon von alleine. Das zeigt sich an den vielen Romanen der letzten Jahre, die, ähnlich, aber ungeschickter als „Wir waren wie Brüder“, auf die Authentizitätstube drücken und dabei wenig herausbekommen, weil sie die Zerstörungen abbilden, die sich vor den Augen der Schreibenden abspielten, die sie selbst mitunter zu spüren bekamen und die in ihren Köpfen zu Knäueln geworden sind: Romane wie Manja Präkels „Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß“ (2017) oder „Mit der Faust in die Welt schlagen“ (2018) von Lukas Rietzschel sind gegen das Papier geweint, geschrien, geboxt. Schreibtherapeutische Mechaniken, ausgequetschte Verzweiflung.
Die ist verdreckter Treibstoff für jede Art von Ursachenforschung – der Motor stottert: „Daran knüpft die AfD an“, heißt es in Schulz’ Essay und gemeint ist nicht etwa die treuhänderisch eingerichtete Verzweiflung, sondern der Kampf der DDR gegen „Auswüchse einer Dekadenz, die nur aus dem Westen kommen konnte“. Was sagen Gauland, Höcke und Weidel dazu? Was stottern drei Wessis über ihre angebliche Wahlverwandtschaft zum Sozialismus? Egal, nicht mehr hören.
Daniel Schulz: Wir waren wie Brüder, Hanser Berlin, München 2022, 288 Seiten, 23 Euro


![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)