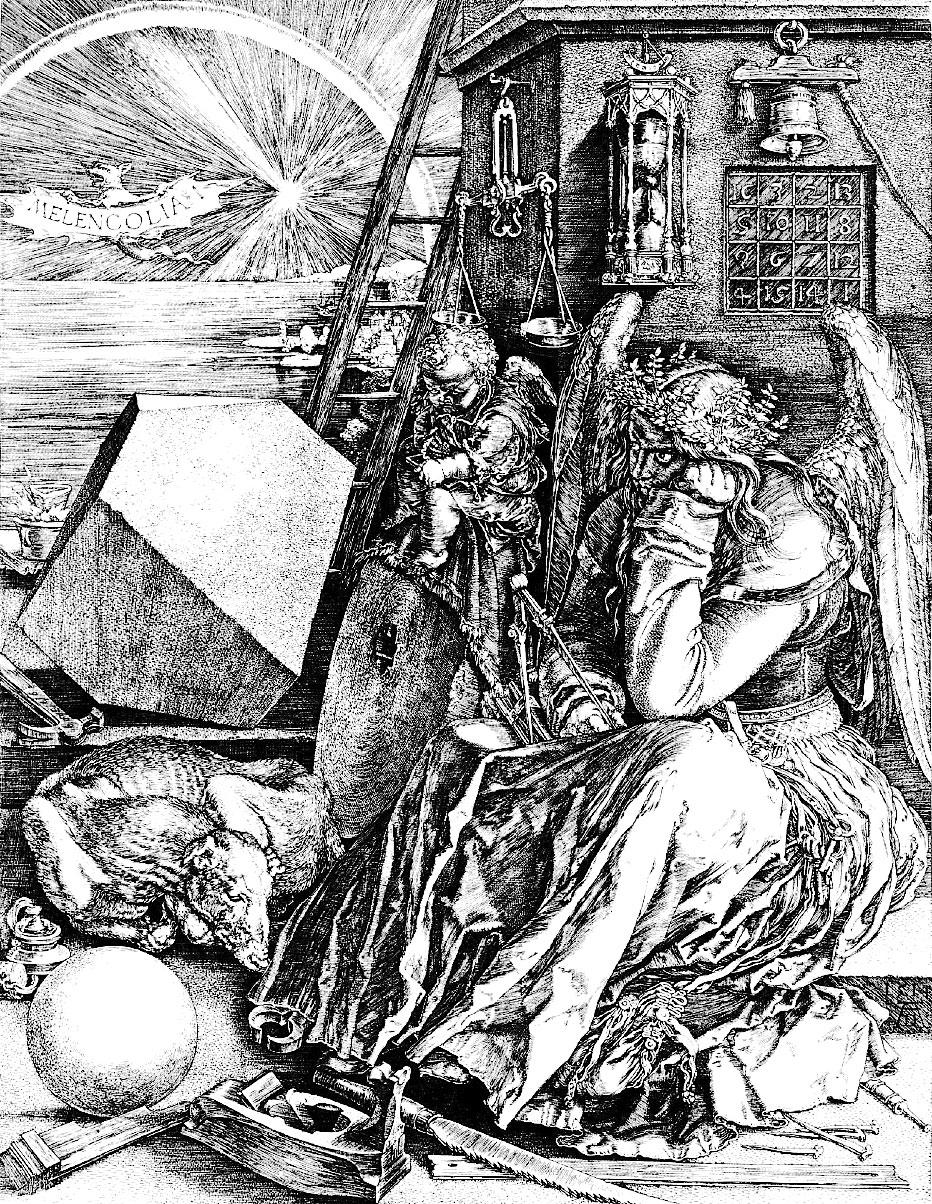Didier Eribon, Rückkehr nach Reims, Suhrkamp Verlag Berlin, 1. Auflage 2016, 237 S., 18 Euro, – franz. Originaltitel: Retour à Reims, erschienen 2009 bei Librairie Arthème Fayard, Paris.
Das Buch „Rückkehr nach Reims“ von Didier Eribon ist im Wesentlichen eine stark psychoanalytisch angelegte Autobiographie eines französischen Linksintellektuellen, den vor allem zwei Probleme bewegen: von seiner Herkunft aus einem kommunistischen Arbeitermilieu in der Provinz, der Bruch mit diesem Milieu und der gesellschaftliche Aufstieg bis zum Universitätslehrer, und der Umgang mit seiner Homosexualität.
Der 1953 geborene Autor konnte als erster aus der Familie ein Gymnasium absolvieren. Als Oberschüler schloss er sich für einige Jahre einer trotzkistischen Organisation an. Der Bruch mit dem Vater erfolgt wegen dessen sehr autoritärem Verhalten in der Familie und dessen homophober Grundhaltung. Eribon studiert Philosophie und Soziologie, scheitert mit dem Versuch, Oberschullehrer zu werden, publiziert Artikel zu philosophischen und literarischen Themen und wird Mitarbeiter linksliberaler Zeitungen. Sein Buch über die Biographie des Philosophen Michel Foucault wird zu einem Erfolg und auch seine Arbeiten zur Homosexualität machen ihn bekannt. Er bekommt Einladungen zu Vorträgen und Gastvorlesungen in anderen Ländern, auch in die USA. Schließlich öffnet ihm dies den Weg zu einer Professur auch in Frankreich, an der Universität von Amiens.
Eribons Buch ging der Ruf voraus, dass darin auch Aufschlussreiches zu lesen sei, warum ein Teil der französischen Arbeiterschaft zum Front National (FN) überlief. Allerdings wird dieses Thema nur in einem relativ kleinen Teil des Buches abgehandelt, nämlich auf rund 30 Seiten im Kapitel III. Und da das Buch in Frankreich schon 2009 veröffentlicht worden ist, konnte es den neuesten Stand nach der Amtszeit des Sozialisten? Hollande mit ihren enttäuschenden Ergebnissen nicht mehr erfassen.
Der Autor stützt sich ausschließlich auf persönliche Eindrücke aus dem familiären Umfeld. Seine Kernthese lautet, dass die „offizielle Linke?“ selbst einen „riesigen Anteil? Schuld daran habe, dass Arbeiter sich dem FN zuwendeten. Seit dem „sozialistischen“ Präsidenten Mitterrand und der Beteiligung der Kommunisten an der damaligen Regierung 1982 sei ein Prozess des Abrückens der Linken von ihren „Gründungsmerkmalen“, nämlich einer klassenmäßigen Betrachtung gesellschaftlicher Verhältnisse zu verzeichnen. Dies habe bis zur Übernahme neoliberaler Politikrezepte in „linke?“ Regierungspolitik geführt. Viele Arbeiterwähler hätten sich dadurch im Stich gelassen gefühlt. Mit der Zeit sei das frühere Selbstverständnis als soziale Klasse schließlich durch ein neues Selbstverständnis als „Franzosen“ im Gegensatz zu „Immigranten“ ersetzt worden. Die Zustimmung zum FN müsse „zumindest teilweise als eine Art politische Notwehr der unteren Schichten“ interpretiert werden, die sich von den Linken nicht mehr vertreten fühlen.
Damit spricht Eribon zweifellos wesentliche Elemente dessen an, was sich in Teilen der französischen Arbeiterklasse in den letzten Jahrzehnten vollzogen hat. In der Tat hatten die „Linksregierungen“? unter Mitterrand und dann wieder unter Jospin 1997 bis 2002 für die Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung überwiegend enttäuschende Ergebnisse. Die Hollande-Periode hat diese Gefühle weiter verstärkt.
Dennoch wäre eine differenziertere Betrachtung in mancher Hinsicht wünschenswert gewesen. Die Darstellung leidet an pauschalisierenden Verallgemeinerungen. Immer wieder wird allgemein von „der Linken?“ von der „offiziellen Linken“ oder „institutionalisierten Linken“ gesprochen. Die französischen „Sozialisten?“ (Sozialdemokraten) mit ihren verschiedenen Strömungen werden ziemlich unterschiedslos mit den Kommunisten und anderen antikapitalistischen Linken in einen Topf geworfen.
Hart geht der Autor mit den Linksradikalen der 68er Bewegung ins Gericht. Die selbsterklärte „Avantgarde der Arbeiterklasse“? habe ihr früheres Engagement gar nicht schnell genug als Jugendsünde abtun können, um „in der Komfortzone der sozialen Ordnung“ anzukommen.
Aber auch die Kommunistische Partei (PCF) wird pauschal in die Kritik an „den Linken“ einbezogen. Ihr wird „Entwicklungsunfähigkeit?“ bescheinigt, weil sie „ungenügend entstalinisiert“ gewesen sei. Man fragt sich, ob der Autor nicht Restbestände früherer trotzkistischer Ansichten reproduziert, wenn er der PCF unterstellt, dass es ihr „in erster Linie darum ging, den Marsch der Revolution aufzuhalten.“ Auch das alte antikommunistische Argument, dass die PCF „großzügig von Moskau finanziert“ worden sei, wird wieder aufgewärmt. Die inneren Entwicklungsprozesse in der PCF seit Ende der 80er Jahre und die daraus jeweils herrührenden politischen Handlungsorientierungen sind dem Autor offenbar einfach entgangen oder zu unbedeutend erschienen, um sie einer differenzierteren Betrachtung zu unterziehen.
Eine umfassendere wissenschaftliche Untersuchung des Zulaufs zum FN hätte auch die objektiven Ursachen stärker ins Visier nehmen müssen als dies in Eribons Buch geschieht: die rasanten technologischen Umbrüche, die Strukturveränderungen in der Wirtschaft, die Verwandlung ganzer Industrieregionen in Notstands- und Armutsgebiete und nicht zuletzt die Strukturveränderungen in der Arbeiterklasse selbst mit ihren Folgen für die Bewusstseinsentwicklung. Ebenso bleiben internationale Faktoren wie der Zusammenbruch der sozialistischen Staaten Osteuropas und seine ideologischen Auswirkungen des generellen Glaubwürdigkeitsverlusts sozialistischer Ideen in Eribons Darstellung unbeachtet. Auch die massive Förderung fremden- und einwanderungsfeindlicher Stimmungen durch die etablierten bürgerlichen Parteien und Massenmedien, das Interesse führender Kapitalkreise am Aufbau rechtsextremer Parteien als Reserveformationen für ihre Politik sind nicht berücksichtigt.
Eribons Buch liefert also zweifellos eine zum Nachdenken auffordernde kritische Analyse eines Teils des Problems. Aber was ist nun zu tun? Eine bloße Rückwende zur „klassenkämpferischen“ Agitation früherer Jahre kann es ja wohl nicht sein – sonst müssten linksradikale Formationen wie die aus dem Trotzkismus abstammende „Nouveau Parti Anticapitaliste“ heute weitaus stärker sein. Eribon schreibt, die Aufgabe sei es nun, „einen theoretischen Rahmen und eine politische Sichtweise auf die Realität zu konstruieren?, die es ermöglichen, die „negativen Leidenschaften, die in der Gesellschaft insgesamt und insbesondere in den populären Klassen zirkulieren“, weitgehend zu neutralisieren?. Das bleibt abstrakt und ziemlich vage.



![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)