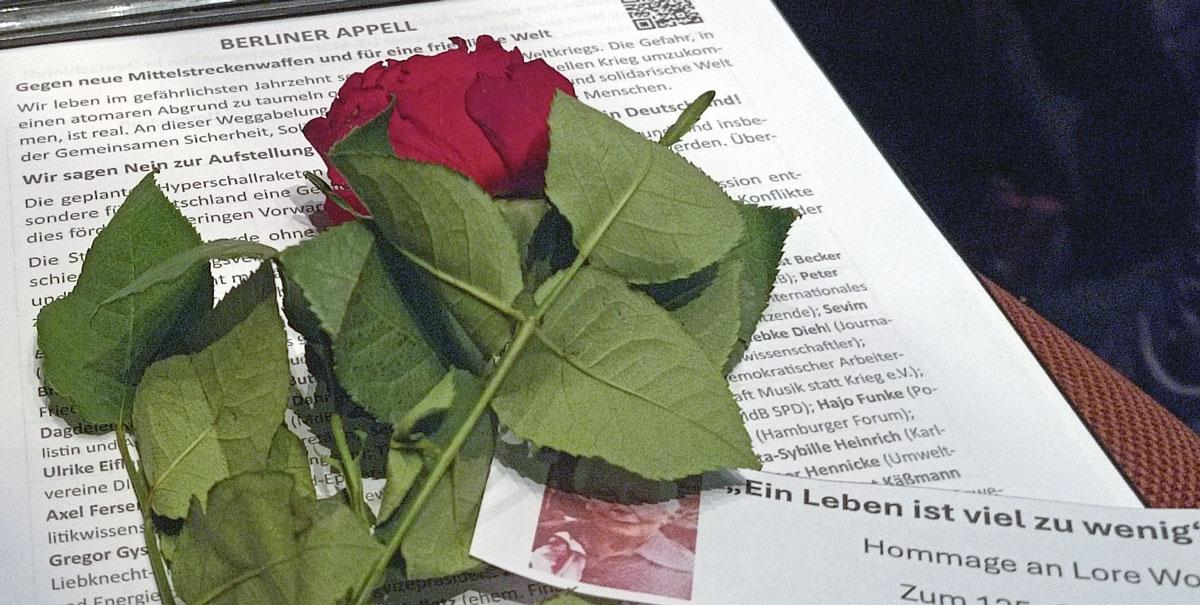Auf der Veranstaltung der DKP „DDR – der Zukunft zugewandt“ hielt Achim Bigus ein Referat über die Folgen der „Wende 1989/90“ für die westdeutschen Arbeiterinnen und Arbeiter. An dieser Stelle dokumentieren wir es in Gänze.
Ich bin gelernter Westdeutscher. Mein Thema ist nicht: „Wie war es in der DDR?“ Mein Thema ist: „Wie war es in der BRD, als es die DDR noch gab, und was hat sich im Westen nach dem Ende der DDR geändert?“
Erlaubt mir dazu eine persönliche Vorbemerkung. Der bekannte Gedanke, dass im Rahmen der Systemkonkurrenz die DDR bei westdeutschen Tarifrunden als unsichtbarer Partner mit am Verhandlungstisch saß, war mir lange Zeit eher fremd. Ich bin zwar seit Anfang der Siebziger Jahre aktiv in der linken sozialistischen Bewegung, aber erst seit 1994 in der Deutschen Kommunistischen Partei. Mein politischer Weg war zunächst lange Zeit geprägt durch ausgesprochene Distanz zu den Staaten des Realen Sozialismus, wie bei nicht wenigen West-Linken meiner Generation damals und auch heute.
Meine politischen Um- und Irrwege führte mich zuerst – sehr jung und für relativ kurze Zeit – in eine Schülergruppe im Umfeld einer der maoistischen K-Gruppen. Aus dieser Gruppierung ging später der erste grüne Ministerpräsident eines deutschen Bundeslandes hervor. Später war ich lange bei der trotzkistischen „Vierten Internationale“ unter Führung von Ernest Mandel.
Den Gedanken vom Realen Sozialismus als unsichtbarem Tarifpartner – wenn auch nicht so klar formuliert – hatte ich erstmals Anfang der achtziger Jahre von einem älteren Kollegen gehört, der bei uns im Betriebsrat war. Dieser Kollege war eher sozialdemokratisch orientiert, aber in dieser Frage damals wohl realistischer und klarer als ich.
An den Realen Sozialismus habe ich mich dann erst ab Mitte der achtziger Jahre langsam angenähert, zunächst vor allem durch die Eindrücke einer Reise nach Kuba. Und wie das dann im Leben so ist: welche Bedeutung manche Dinge oder Personen für einen hatten, erkennt man manchmal ja erst dann so richtig, wenn sie weg sind, wenn man sie verloren hat. So ging es mir mit der DDR und den anderen realsozialistischen Gesellschaften Osteuropas.
Heute finde ich: der Gedanke vom Realen Sozialismus als Faktor in den Klassenauseinandersetzungen im Westen hat sich gerade durch die Entwicklung nach dem Anschluss der DDR eindrucksvoll bestätigt.
„Wiederkehr der Proletarität“
1993, also kurz nach dem Anschluss, eröffnete der linke Sozialwissenschaftler und Historiker Karl-Heinz Roth eine Debatte über die Veränderungen der Klassenbeziehungen in Ost- und Westdeutschland, und zwar mit einem Aufsatz unter der etwas sperrigen Überschrift „Wiederkehr der Proletarität“. Was war damit gemeint?
Karl-Heinz Roth meinte zunächst nicht so sehr die grundlegenden Veränderungen für die Arbeitenden in Ostdeutschland. Diese wurden durch die Restauration kapitalistischer Verhältnisse, durch die Privatisierung der ehemals Volkseigenen Betriebe wieder „doppelt freie Lohnarbeiter“ im Sinne von Marx: sie können ihre Arbeitskraft ohne Einschränkungen frei an einen Kapitalbesitzer verkaufen – wofür z. B. die Staatsgrenze ja ein Hindernis war -, aber sie müssen es auch, weil sie eben auch frei sind von Besitz an Produktionsmitteln.
Diese Grundmerkmale einer proletarischen Klassenlage hatten für die Arbeitenden im Westen ja immer bestanden. Darauf hat in dieser Debatte z. B. Heinz Jung auch hingewiesen.
Allerdings hatten diese Grundmerkmale in den Nachkriegsjahrzehnten erhebliche Modifikationen in ihrer konkreten Form erfahren. Darauf bezog sich Karl-Heinz Roth, als er beschrieb, „was die Verkäuferinnen und Verkäufer von Arbeitskraft inzwischen wieder massenhaft erleben: unsichere Arbeitsplätze, wegbrechende ‚Normalarbeitszeiten‘, plötzliche Lohnsenkungen, wackelig werdende Garantien für die Risiken von Krankheit, Invalidität und Alter“. Diese Erfahrungen waren nicht nur für die Arbeitenden aus der DDR neu, sondern auch für die breite Masse der Arbeitenden in Westdeutschland und Westberlin.
„Rheinischer Kapitalismus“
Denn nach der Weltwirtschaftskrise und dem Zweiten Weltkrieg veränderten sich die Verhältnisse in den entwickelten kapitalistischen Gesellschaften (nicht in den abhängigen Ländern des globalen Südens!). Roth zitiert dazu den linkskeynesianischen Wirtschaftswissenschaftler Michal Kalecki. Dieser vertrat Ende der sechziger Jahre die Meinung, der Kapitalismus sei zu seiner „entscheidenden Reform“ gezwungen worden. Durch staatliche Interventionen in die Wirtschaft und den Ausbau der sozialen Sicherungssysteme sei für die Arbeiterklasse eine unbefristete Ära der Vollbeschäftigung und der hohen Realeinkommen angebrochen. Damit sei im Ergebnis des Zweiten Weltkrieges und unter dem Druck der Systemkonkurrenz die „soziale Frage“ zum partnerschaftlichen Verteilungskonflikt innerhalb eines sozialstaatlichen Status Quo gezähmt worden.
Dieses Bild hat mit dem heutigen Kapitalismus offensichtlich nichts mehr gemein. Es passt aber zu der Erfahrungswelt der Generation meiner Eltern bis Mitte der sechziger Jahre: Überwindung von Arbeitslosigkeit und Not der Nachkriegszeit, Reallohnsteigerungen bei etwa 5 % jährlich, stetige Verkürzungen der Arbeitszeit, Leistungsverbesserungen und die Gleichstellung von Arbeitern und Angestellten in der Renten- und Krankenversicherung – und das „alles unter den Bedingungen einer kapitalistischen Wirtschaft und unter der Regierungsführung der CDU/CSU“.
Diese Errungenschaften bekamen die Arbeitenden nicht kampflos geschenkt. Auch in den 50er Jahren mussten die westdeutschen Gewerkschaften einige große Kämpfe führen, wie z. B. den 16 Wochen dauernden Streik der MetallerInnen in Schleswig-Holstein für die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 1956/57. Doch alles in allem waren die Lohnabhängigen der Bundesrepublik „im Hinblick auf Lebensstandard und soziale Absicherung … an die Spitze der Durchschnittswerte in Westeuropa gerückt“ und mussten dafür doch weit weniger Kampfkraft aufwenden als die Arbeitenden in anderen kapitalistischen Staaten. Für diesen „rheinischen Kapitalismus“ waren zwei Rahmenbedingungen entscheidend.
Zum einen war in der langen Nachkriegskonjunktur von Mitte der 50er bis Mitte der 60er Jahre die Nachfrage nach Arbeitskräften relativ hoch. Auch nach dem Konjunktureinbruch 1966/67 stieg diese zunächst wieder an. Erst mit der Weltwirtschaftskrise Mitte der 70er Jahre kehrte anhaltende Massenarbeitslosigkeit wieder in die Realität des westdeutschen Kapitalismus zurück.
Zum anderen aber wurde die BRD seit ihrer Gründung zum „Frontstaat“ im Kalten Krieg aufgebaut. Schon Bismarck hatte seinen Kampf gegen die damals noch revolutionäre Sozialdemokratie mit „Zuckerbrot und Peitsche“ geführt (Sozialistengesetze gegen die SPD, Sozialversicherungen für die Arbeitermassen). Auch Adenauer und Erhard nutzen „Zuckerbrot und Peitsche“ für den Ausbau der BRD zum „Bollwerk gegen den Kommunismus“.
Einerseits war die bürgerlichen Demokratie in dieser Bonner Republik besonders eingeschränkt: alte Nazis in Justiz, Polizei, Geheimdiensten und Militär, Antikommunismus als Staatsdoktrin (nicht nur gegen kommunistische, sondern auch gegen linkssozialistische, antifaschistische und militärkritische Kräfte), Verbot der kommunistischen Partei (als einziger „westlicher“ Staat neben den faschistischen Diktaturen Portugal und Spanien), besonders eingeschränktes Streikrecht usw.
Auf der anderen Seite erfüllte auch der „sozialstaatliche Klassenkompromiss“ eine Funktion als Waffe im Kalten Krieg. Nach außen war der „Sozialstaat“ BRD das Schaufenster des „freien“ Westens für die Menschen im Osten. Ideologisch sollte er den Beweis liefern, wie „sozial“ der Kapitalismus funktionieren kann. Materiell diente er zur Abwerbung von Fachkräften, vor allem aus der DDR, und damit zur ökonomischen Schädigung des realen Sozialismus.
Nach innen ging es um die politische Integration der westdeutschen Arbeiterklasse, bei gleichzeitiger Verfolgung ihrer revolutionären Minderheit durch KPD-Verbot und Antikommunismus. Die Lage der BRD an der Nahtstelle der Gesellschaftssysteme, ihre Funktion als Schaufenster gegenüber der DDR und den anderen sozialistischen Ländern, wurde so zu einem Faktor neben anderen im Kräfteverhältnis der Klassen innerhalb der BRD – stärker als in England, Frankreich, Italien oder anderen westlichen Ländern.
Offensive des „Neoliberalismus“
Doch das Kapital kündigte den „Klassenkompromiss“ der Nachkriegszeit wieder auf, und das nicht erst 1989. Zum ersten großen Einschnitt wurde weltweit die Weltwirtschaftskrise 1974/1975. In Westdeutschland saß damit nicht mehr nur die DDR in den Tarifrunden mit am Tisch, sondern nun auch die Massenarbeitslosigkeit, auf Seiten des Kapitals.
Die weltweite Offensive des „Neoliberalismus“ und der Deregulierung begann in Chile. Dort legte Pinochet nach seinem blutigen Putsch die Wirtschaftspolitik des Landes in die Hände der „Chicago-Boys“. Es folgte die Regierungszeit von Margaret Thatcher in Britannien nach ihrem Wahlsieg 1978 und die Reagan-Zeit in den USA. Karl-Heinz Roth nennt auch Beispiele von Anfang der achtziger Jahre aus Italien, Mexiko und Frankreich.
Aber gerade in Deutschland schafften es das Großkapital und seine politischen Hilfstruppen zunächst nicht so recht, in der Offensive gegen Gewerkschaften und Sozialstaat grundlegende Durchbrüche zu erreichen, trotz der „Wende“ von 1982/83 zur Regierung Kohl. Die IG Metall konnte noch Mitte der achtziger Jahre den Einstieg in die 35-Stunden-Woche durchsetzen, wenn auch nicht ohne Zugeständnisse an die Flexibilisierungsstrategien des Kapitals.
Erst die weitere „Wende“ von 89/90, also das Ende der DDR und die Restauration des Kapitalismus in Ostdeutschland, machte den Weg frei für Kapital und Kabinett. Dazu schrieb Karl-Heinz Roth 1993: „Ein gravierender und irreversibler Einbruch erfolgte erst durch den Anschluss der DDR, deren volkswirtschaftliche Substanz im Herbst 1990 mit Hilfe monetärer Instrumente schlagartig zerstört wurde. Parallel dazu wurden die bislang eher zögerlich gehandhabten Deregulierungsmodelle in Gestalt der Treuhandanstalt mit voller Wucht auf die ‚neuen Bundesländer‘ übertragen. In der untergehenden DDR wurde ein neoliberaler Privatisierungsexzess in Gang gebracht, dem unzweideutig experimentelle Funktion für den gesamten Wirtschaftsstandort Deutschland zukommt(…) der Anschluss der DDR wurde 1990 zum Ausgangspunkt für einen nachholenden Deregulierungsprozess auf allen Ebenen der Wirtschafts- und Sozialpolitik…“ und „verhalf der bisher nur schleichend in Gang gebrachten Erosion sozialpartnerschaftlicher und sozialstaatlicher Sicherungen in Westdeutschland zum Durchbruch auf eine qualitativ neue Ebene.“
Umbruch der Klassenstrukturen in Ost – und West
Gerade die letzte Einschätzung hat sich seither bestätigt. Im DDR-Gebiet gab es zunächst statt „blühender Landschaften“ eine weitgehende Deindustrialisierung und Massenverarmung. Statt „Angleichung der Lebensverhältnisse“ sind auch heute noch, dreißig Jahre später, die Arbeitslosigkeit höher, die Einkommen niedriger, die Arbeitszeiten länger und die Tarifbindung deutlich geringer als im Westen.
Die neu aufgebauten Betriebe waren für das Kapital Versuchslabore zur Erprobung neuer, profitablerer Methoden, wie Opel in Eisenach für den damals aktuellsten Stand der sogenannten „schlanken Produktion“ oder BMW in Leipzig für einen extrem hohen Anteil an Leiharbeit und Fremdvergaben über Werkverträge.
Und auch die „Rückwirkungen auf den nationalen Gesamtarbeitsmarkt“ und damit auch auf die Klassenverhältnisse im Westen zeigten sich schon sehr bald. Auch in westdeutschen Betrieben gab es in den frühen Neunzigern „Entlassungswellen…, Säuberungsaktionen in den Zuliefersektoren und… Angriffe auf das Normalarbeitsverhältnis“ , also die Ausweitung prekärer Arbeitsverhältnisse, welche nicht vor Armut schützen.
Damit einher gingen Angriffe auf die Tarifverträge. Für die ostdeutsche Metallindustrie war im Frühjahr 1991 vereinbart worden, angesichts der raschen Angleichung der Lebenshaltungskosten die Ostlöhne bis zum 1. April 1994 an das Westniveau anzupassen. Doch im März 1993 kündigte die Kapitalseite diesen laufenden Tarifvertrag während der Friedenspflicht, drohte mit einer weiteren Beschleunigung des Deindustrialisierungsprozesses und setzte damit im ostdeutschen Metalltarifvertrag erstmals „Öffnungsklauseln“ durch, die Abweichungen von den Tarifverträgen nach unten zuließen. So etwas hatte es bis dahin in der (west-)deutschen Tarifgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben
Die IG Metall rief dagegen nicht nur zu Warnstreiks in Ostdeutschland auf, sondern auch zu Solidaritätsaktionen im Westen. Das Echo darauf unter den Arbeitenden in Westdeutschland war allerdings überschaubar. Die Bereitschaft der „Wessis“, vermeintlich für die „Ossis“ auf die Straße zu gehen, war beschränkt. Davon ermuntert, gingen die Kapitalverbände nun auch im Westen zu einem zunehmend aggressiveren Kurs in Tarifverhandlungen über.
Auch in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik wurde in den neunziger Jahren der Weg eingeschlagen, der später zu den Hartz-Gesetzen führte. Übrigens: mit dem Angriff auf die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 1996 und mit der schrittweisen Demontage der paritätisch umlagefinanzierten gesetzlichen Rente nahmen das Kapital und seine Regierungen gerade die Elemente des „Sozialstaates“ unter Beschuss, die in den 50er Jahren zugestanden worden waren.
Das Schaufenster hatte seine Funktion erfüllt, das ausgelegte Zuckerbrot wurde ausgeräumt – und ersetzt durch die Peitsche von Erwerbslosigkeit und sozialem Abstieg, um die Etablierung eines breiten Niedriglohnsektors zu erzwingen.
Im Ergebnis dieser Prozesse haben sich die Kräfteverhältnisse zwischen Kapital und Arbeit tiefgreifend und nachhaltig zugunsten des Kapitals verschoben. Armut trotz Arbeit, Prekarisierung und zunehmende Existenzunsicherheit, abnehmende Tarifbindung und wachsende betriebsratsfreie Zonen vor allem im Osten, aber zunehmend auch im Westen, sind die Zeugnisse davon.
„Dem Anschluss ‚von oben‘ die Einheit ‚von unten‘ entgegensetzen“…
…so formulierte eine marxistische Zeitschrift zur Bundestagswahl 1990 unsere zentrale Aufgabe. Diese ist bis heute ungelöst. Stattdessen haben wir es inzwischen mit vielfältigen Spaltungslinien innerhalb der Klasse der lohnabhängig Arbeitenden zu tun, welche sich gegenseitig durchdringen und überlagern: zwischen West und Ost, Stamm- und Randbelegschaften, Konzernbetrieben und Zulieferern, Beschäftigten und Erwerbslosen, Männern und Frauen, Deutschen und Einwanderern, Belegschaften mit und ohne Tarif usw. Viele dieser Spaltungslinien gab es schon in der Alt-BRD, andere sind nach dem Anschluss der DDR entstanden, alle wurden in der Folge der sogenannten „Vereinigung“ vertieft und verschärft.
Doch immer wieder flammt an unterschiedlichen Punkten auch Gegenwehr der Arbeitenden gegen die Zumutungen des Kapitals auf. Eine erneute Verschiebung des Kräfteverhältnisses zu unseren Gunsten, ein Stopp der Offensive des Kapitals ist nicht unmöglich. Dies wird aber abhängen von der Lösung der oben genannten Aufgabe – und davon, dass die Arbeitenden den Satz von Brecht verstehen und danach handeln, den die Kalikumpel von Bischofferode 1993 zur Losung ihres Kampfes gegen die Abwicklung durch die Treuhandanstalt gemacht hatte:
Um uns selber müssen wir uns selber kümmern!
Ein Ausschnitt des Referats erschien in der UZ vom 15. November 2019



![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)