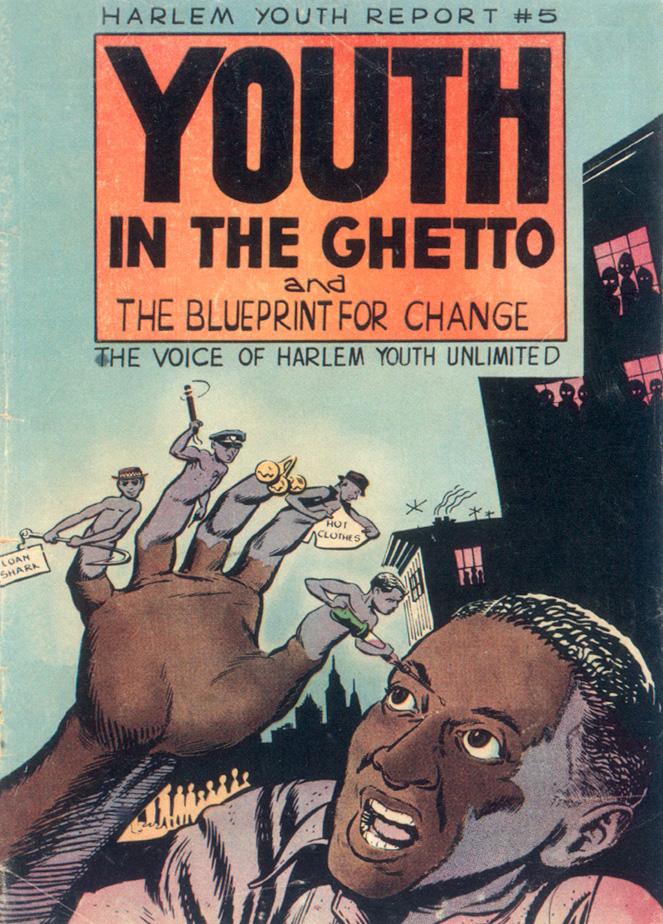Endlich (endlich!!!) hat June Hayword den Bestseller, auf den sie so hingearbeitet hat. Endlich nimmt ihr Literaturagent sie ernst, endlich hat sie einen großen Verlag mit einem Lektorat, das wirklich mit ihr arbeiten möchte, statt ihr Buch nur als Füllmasse fürs Verlagsprogramm zu sehen, endlich hat sie Fans, gut besuchte Lesungen, Presseinterviews und am Horizont winkt sogar ein Filmdeal. Schnell noch den Namen geändert, so dass er mehr zum neuen Buch passt und weniger an ihren gefloppten Erstlingsroman erinnert, und schon steht der erträumten Literaturkarriere nichts mehr im Weg. Das einzige Problem: June hat den Roman nicht geschrieben. Und irgendjemand scheint das zu wissen.
Der Plot von Rebecca F. Kuangs neuem Roman „Yellowface“ klingt wie ein Krimi: Zwei befreundete Autorinnen, eine erfolglos, eine erfolgreich. Als die erfolgreiche stirbt, findet die erfolglose ein bisher unveröffentlichtes Manuskript – roh und unbearbeitet. Sie steckt ihr Herzblut in die Arbeit an dem Werk und wird erfolgreich, doch lebt sie nun in ständiger Angst vor der Enthüllung. Mit einem Krimi hat der Roman allerdings höchstens gemeinsam, dass man ihn nicht aus der Hand legen kann.
„Yellowface“ bietet eine Auseinandersetzung mit dem Literaturbetrieb, der Selbstvermarktung auf Social Media und der allgegenwärtigen Identitätspolitik. Auf welcher Seite die Autorin in der Auseinandersetzung steht, bleibt stellenweise unklar (man kann sich den Spaß an der Lektüre allerdings dadurch mindern, dass man eins ihrer Interviews googelt und das Geheimnis lüftet).
Das Manuskript, das Athena Liu hinterlassen hat und das June Hayward, die sich ab da Juniper Song nennen wird, geklaut hat, handelt vom Schicksal des chinesischen Arbeiterkorps. Und wer das Recht hat, über das Leben und Leiden der ungefähr 140.000 Chinesen zu erzählen, die Britannien 1916 für den Ersten Weltkrieg rekrutiert hat, das ist die große Frage in „Yellowface“.

Dabei gelingt der 1996 in Guangzhou geborenen und in Texas aufgewachsenen Kuang ein Verwirrspiel, das den Leser zwingt, sich jenseits aller Feuilleton-Debatten mit den Fragen auseinanderzusetzen, wer wie was berichten darf. Gestohlen wird der Roman (oder zumindest sein unausgegorener erster Entwurf) einer erfolgreichen Autorin mit chinesischen Wurzeln, die in vielem an Kuang selbst erinnert. Der Literaturbetrieb zwingt June (ob nun explizit oder ob sie im vorauseilenden Gehorsam handelt) ihren Namen so zu ändern, dass er chinesisch klingen könnte (Juniper ist ihr voller erster, Song ihr zweiter Vorname – die Mutter war Hippie und nicht aus China eingewandert).
Der Shitstorm auf Twitter und Co lässt nicht lange auf sich warten: Lange bevor sich kleine Trüffelschweine auf den Weg machen und versuchen nachzuweisen, dass der Roman nicht von Juniper ist, geht es um kulturelle Aneignung, Kolonialismus in der Kultur und Rassismus. Eine Weiße, so ist sich das Internet einig (oder zumindest die, die am lautesten schreien), darf diese Geschichte nicht erzählen. Auf der Strecke bleiben dabei die auf die Schlachtfelder der Westfront verschleppten chinesischen Zwangsarbeiter.
Kuang erzählt die Geschichte mit präzse-bissiger Satire, geschickt nutzt sie den Gegensatz zwischen der erfolgsverwöhnten Athena und der opportunistisch handelnden, aber hart arbeitenden June aus, um Fragen zu stellen und Nadelstiche zu setzen: gegen den Internetmob, aber auch gegen den etablierten Kulturbetrieb.
Wermutstropfen dabei ist leider die deutsche Übersetzung. Sie kann mit der feinen Sprache Kuangs nicht mithalten und verfällt dabei leider in klischeehafte Übersetzungsfehler. „Pushing papers“ zum Beispiel bedeutet nicht, „Papiere zu bearbeiten“, sondern nichts zu tun außer Papiere auf dem Schreibtisch hin und her zu schieben. Doch so wird in der Eichborn-Übersetzung von Jasmin Humburg aus dem unwichtigen Angestellten schlicht ein Bürokrat. Da hätte Rebecca F. Kuangs Roman Besseres verdient.
Rebecca F. Kuang
Yellowface
Eichborn Verlag, 380 Seiten, 24 Euro



![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)